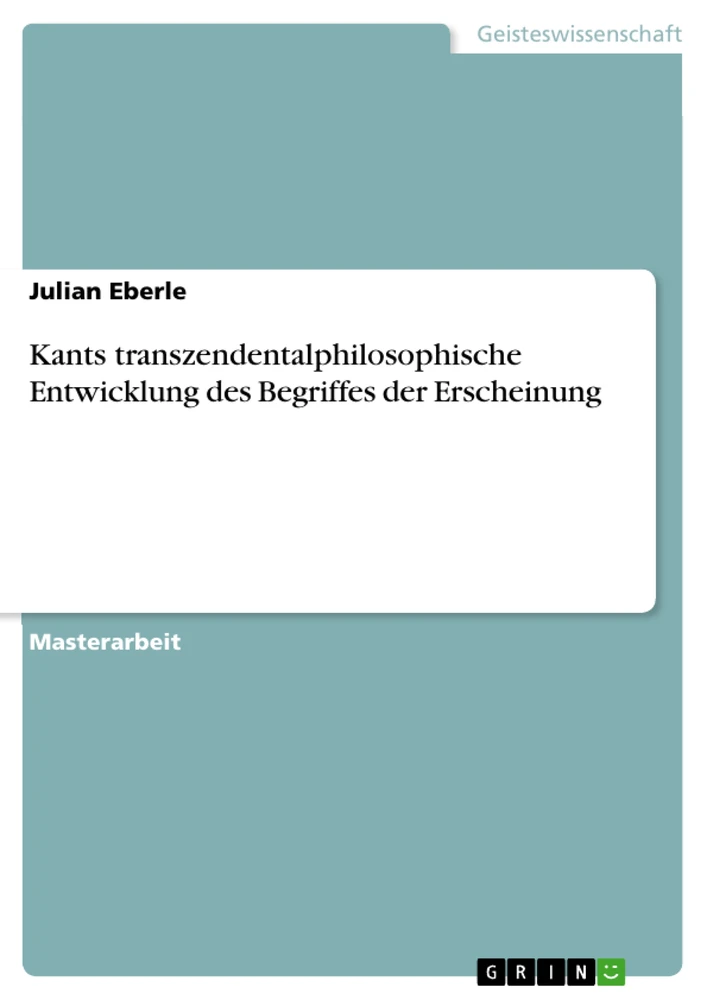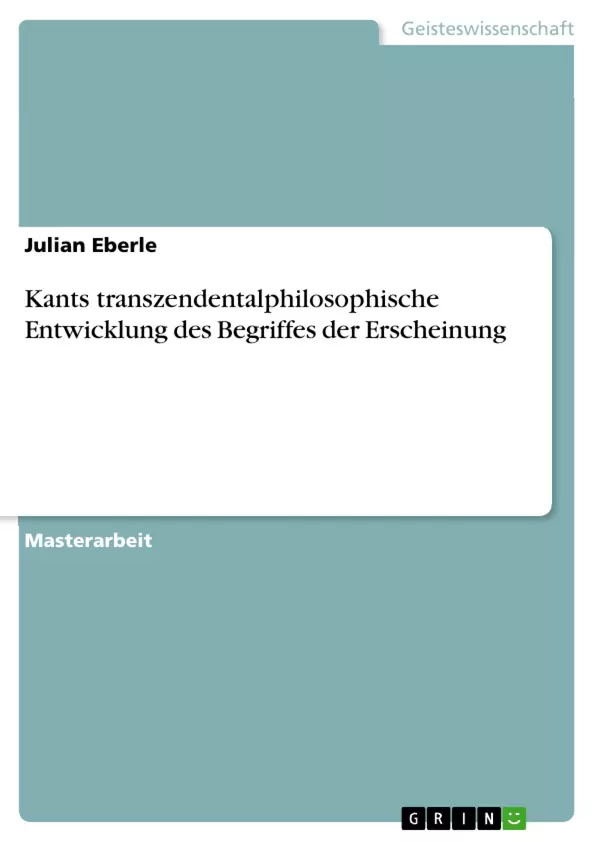Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entfaltung des Erscheinungsbegriffes in den ersten Teilen der Kritik der reinen Vernunft so nachzuvollziehen, dass sich aus der methodischen Einheit, die dieser Entfaltung zugrunde liegt, in klarer Weise ergibt, dass sich die Beiträge der beiden Erkenntnisstämme, Sinnlichkeit und Verstand, zum Ganzen der empirischen Erkenntnis nicht unabhängig voneinander begreifen lassen.
Wie das Verhältnis von Geist und Welt zu denken ist, ist eines der zentralen Probleme, aus dessen Spannungsfeld heraus die Philosophie sich immer wieder neu aktualisiert. Im Laufe der Philosophiegeschichte haben sich unterschiedliche Ansätze entwickelt, die mit unterschiedlichen Erklärungen dazu aufwarten, wie sich die Welt als objektiver Bezugsgegenstand des Denkens in diesem Denken selbst zum Ausdruck bringt, und wie sich das Denken die Welt auf diese Weise aneignet. Denn einerseits geht der Mensch in seinem Umgang mit der ihn umgebenden Welt davon aus, dass diese Welt einen Einfluss auf sein Denken hat, der hinreichend ist, die Einstellungen und Überzeugungen, die sich in diesem Denken kundtun, zu modifizieren. Andererseits ist aber auch klar, dass dieser Einfluss schon eine gewisses Form aufweisen muss, um diese Modifikationen zu bewirken, und dass diese Form der Form des Denkens auch nicht komplett äußerlich sein kann. In der „Kritik der reinen Vernunft“ entwickelt Kant den Begriff der Erscheinung als einen Begriff, der sich durch die sukzessive Entfaltung dieses wechselseitigen Verhältnisses von Welt und Denken zu einem philosophischen Verständnis der wesentlich einheitlichen Struktur dieses Bezugsverhältnisses erhebt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I - Der Ursprung des kantischen Erscheinungsbegriffs
- 1.1. Wo Erkenntnis beginnt - Eine erste Annäherung an den Begriff Erscheinung
- 1.2. Das skeptische Schicksal des Empirismus
- 1.2.1. Das Problem des empiristischen Repräsentationalismus
- 1.2.2. Das Problem mit der Substanz
- 1.2.3. Keine Rechtfertigung von Urteilen, die sowohl allgemein als auch informativ sind
- 1.3. Der Rationalismus und das Problem des entgrenzten Verstandes
- 1.3.1 Sinnliche Wahrnehmung als Denkfunktion
- 1.3.2. Das Ich, das denkt
- 1.3.3. Synthetische Urteile a priori
- 1.4. Das Problem der Bewusstseinseinheit
- Teil 2 - Der Begriff der Erscheinung in der transzendentalen Ästhetik
- 2.1. Kants Perspektivenwechsel – Erscheinung und Ding-an-sich
- 2.2. Die Kernbegriffe der transzendentalen Ästhetik
- 2.2.1 Das Verhältnis von Anschauung, Empfindung und Erscheinung in empirischer Erkenntnis
- 2.3 Weitere Differenzierung des Erscheinungsbegriffs
- 2.4. Raum und Zeit als reine Formen der Anschauung
- 2.4.1. Das Argument der transzendentalen Ästhetik
- Teil 3 - Die begriffliche Präformation von Erscheinung
- 3.1. Bestimmung als Deutung - der Ansatz von Prauss
- 3.2. Verstand und Spontaneität
- 3.3. Kants transzendentale Urteilstheorie
- 3.3.1. Urteil, Begriff und Funktion
- 3.3.2. Von Urteilsformen zu reinen Verstandesbegriffen
- 3.4. Die transzendentale Deduktion der B-Ausgabe
- 3.4.1 Intellektuelle Synthesis der Anschauung
- 3.4.2 Die figürliche Synthesis sinnlicher Anschauung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Kants Entwicklung des Erscheinungsbegriffs in der "Kritik der reinen Vernunft" nachzuvollziehen und dabei die methodische Einheit seines Ansatzes herauszustellen. Es soll gezeigt werden, dass Sinnlichkeit und Verstand in der empirischen Erkenntnis untrennbar miteinander verbunden sind, im Gegensatz zu gängigen Schichtkuchenmodellen des menschlichen Geistes. Die Arbeit analysiert kritisch empiristische und rationalistische Ansätze, um die Überlegenheit von Kants transzendentalphilosophischem Ansatz aufzuzeigen.
- Die kritische Auseinandersetzung mit empiristischen und rationalistischen Erkenntnistheorien.
- Die Rekonstruktion von Kants Begriff der Erscheinung als Einheit von Sinnlichkeit und Verstand.
- Die Analyse der strukturellen Bestandteile empirischer Erkenntnis.
- Die Untersuchung von Kants Argument für die begriffliche Präformation sinnlicher Anschauungen.
- Die detaillierte Auseinandersetzung mit der transzendentalen Deduktion der B-Ausgabe.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: das Verhältnis von Geist und Welt und die Entwicklung des Erscheinungsbegriffs bei Kant als Lösungsansatz. Sie kritisiert vereinfachte Modelle des menschlichen Geistes, die Sinnlichkeit und Verstand als getrennte Schichten betrachten, und kündigt den Aufbau der Arbeit an: einen ideengeschichtlichen Überblick über den Erscheinungsbegriff, gefolgt von einer Rekonstruktion von Kants transzendentalphilosophischem Ansatz und einer Analyse der begrifflichen Präformation sinnlicher Anschauungen.
Teil I - Der Ursprung des kantischen Erscheinungsbegriffs: Dieser Teil untersucht die erkenntnistheoretischen Ansätze des Empirismus und des Rationalismus und zeigt deren systematische Schwierigkeiten auf. Er dient als Grundlage für die Darstellung von Kants transzendentalphilosophischem Ansatz als überlegenere Lösung der dargestellten Probleme. Die Analyse beleuchtet die Schwächen des empiristischen Repräsentationalismus, das Problem der Substanz und die Unmöglichkeit, allgemeine und informative Urteile zu rechtfertigen. Gleichzeitig wird die Problematik des entgrenzten Verstandes im Rationalismus und die Frage der Bewusstseinseinheit thematisiert, um die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes aufzuzeigen.
Teil 2 - Der Begriff der Erscheinung in der transzendentalen Ästhetik: Dieser Teil rekonstruiert Kants Perspektivenwechsel, der Erscheinung und Ding-an-sich unterscheidet. Er analysiert die Kernbegriffe der transzendentalen Ästhetik, insbesondere das Verhältnis von Anschauung, Empfindung und Erscheinung in empirischer Erkenntnis. Die weitere Differenzierung des Erscheinungsbegriffs wird diskutiert, wobei Raum und Zeit als reine Formen der Anschauung im Zentrum stehen. Das Argument der transzendentalen Ästhetik wird detailliert erläutert, um die kantische Position zu verdeutlichen.
Teil 3 - Die begriffliche Präformation von Erscheinung: Der dritte Teil präsentiert Kants Argument für die begriffliche Präformation sinnlicher Anschauungen. Hierbei wird der Ansatz von Prauss diskutiert, die Rolle von Verstand und Spontaneität analysiert und Kants transzendentale Urteilstheorie im Detail untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der transzendentalen Deduktion der B-Ausgabe, mit einer ausführlichen Erörterung der intellektuellen und figürlichen Synthesis sinnlicher Anschauung. Dieser Teil zeigt auf, wie der Verstand aktiv an der Gestaltung von sinnlicher Anschauung beteiligt ist.
Schlüsselwörter
Kants Transzendentalphilosophie, Erscheinungsbegriff, Kritik der reinen Vernunft, Empirismus, Rationalismus, Sinnlichkeit, Verstand, Anschauung, empirische Erkenntnis, transzendentale Ästhetik, transzendentale Deduktion, begriffliche Präformation, Synthetische Urteile a priori, Bewusstseinseinheit, Ding-an-sich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit über Kants Erscheinungsbegriff?
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, Kants Entwicklung des Erscheinungsbegriffs in der "Kritik der reinen Vernunft" nachzuvollziehen und dabei die methodische Einheit seines Ansatzes herauszustellen. Sie soll zeigen, dass Sinnlichkeit und Verstand in der empirischen Erkenntnis untrennbar miteinander verbunden sind.
Welche erkenntnistheoretischen Ansätze werden in Teil I kritisch untersucht?
In Teil I werden die erkenntnistheoretischen Ansätze des Empirismus und des Rationalismus kritisch untersucht, um deren systematische Schwierigkeiten aufzuzeigen und die Überlegenheit von Kants transzendentalphilosophischem Ansatz zu verdeutlichen.
Was sind die Kernthemen der transzendentalen Ästhetik in Teil 2?
Die Kernthemen der transzendentalen Ästhetik in Teil 2 umfassen Kants Perspektivenwechsel (Erscheinung und Ding-an-sich), das Verhältnis von Anschauung, Empfindung und Erscheinung in empirischer Erkenntnis sowie Raum und Zeit als reine Formen der Anschauung.
Was wird in Teil 3 über die begriffliche Präformation von Erscheinung argumentiert?
In Teil 3 wird Kants Argument für die begriffliche Präformation sinnlicher Anschauungen präsentiert, wobei der Ansatz von Prauss diskutiert, die Rolle von Verstand und Spontaneität analysiert und Kants transzendentale Urteilstheorie im Detail untersucht wird. Der Schwerpunkt liegt auf der transzendentalen Deduktion der B-Ausgabe.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind Kants Transzendentalphilosophie, Erscheinungsbegriff, Kritik der reinen Vernunft, Empirismus, Rationalismus, Sinnlichkeit, Verstand, Anschauung, empirische Erkenntnis, transzendentale Ästhetik, transzendentale Deduktion, begriffliche Präformation, Synthetische Urteile a priori, Bewusstseinseinheit und Ding-an-sich.
Was kritisiert die Arbeit an traditionellen Modellen des menschlichen Geistes?
Die Arbeit kritisiert vereinfachte Modelle des menschlichen Geistes, die Sinnlichkeit und Verstand als getrennte Schichten betrachten, anstatt sie als untrennbar miteinander verbunden zu sehen.
Was wird über die transzendentale Deduktion der B-Ausgabe gesagt?
Die transzendentale Deduktion der B-Ausgabe wird detailliert erörtert, insbesondere die intellektuelle und figürliche Synthesis sinnlicher Anschauung. Dies zeigt, wie der Verstand aktiv an der Gestaltung von sinnlicher Anschauung beteiligt ist.
Was ist das Problem des empiristischen Repräsentationalismus?
Das Problem des empiristischen Repräsentationalismus, das Problem der Substanz und die Unmöglichkeit, allgemeine und informative Urteile zu rechtfertigen werden als Schwächen empiristischer Ansätze beleuchtet.
Was wird über den Rationalismus und das Problem des entgrenzten Verstandes gesagt?
Die Problematik des entgrenzten Verstandes im Rationalismus und die Frage der Bewusstseinseinheit werden thematisiert, um die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes, wie dem Kantischen, aufzuzeigen.
- Citation du texte
- Julian Eberle (Auteur), 2023, Kants transzendentalphilosophische Entwicklung des Begriffes der Erscheinung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1523953