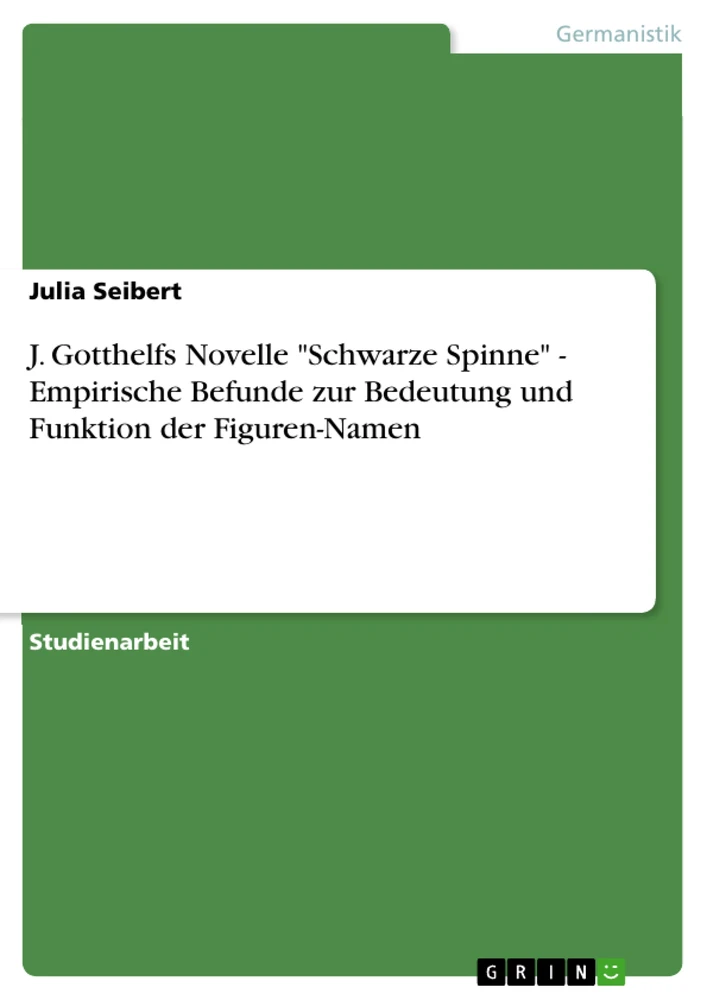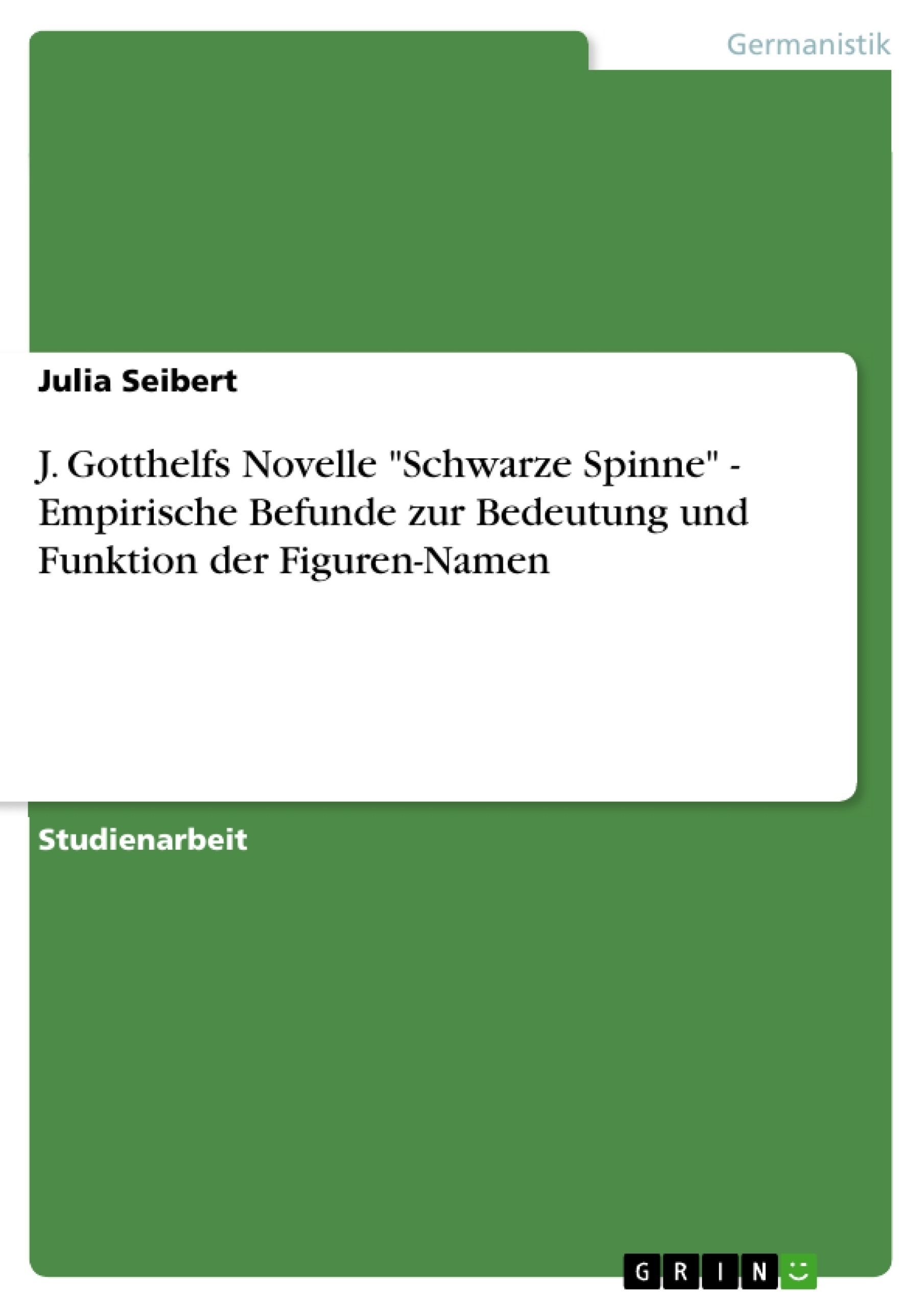Der Untersuchungsgegenstand der Hauptseminarbeit sind die Figurennamen in Gotthelfs Novelle "Schwarze Spinne". Mit Hilfe der hermeneutischen und philologischen Methoden wie Kontentanalyse werden die Namen der Figuren in der Novelle hinsichtlich der Semantik und Pragmatik vor dem Hintergrund der Grundidee des Werkes untersucht. Dabei findet eine Namenklassifizierung statt nach Typen und Gruppen. Zum Schluss wird erläutert, warum Gotthelf eben diese Namen für seine Figuren und genau auf diese Weise verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Empirische Befunde zur Bedeutung und Funktion der Figuren-Namen in Gotthelfs Novelle „Schwarze Spinne“
- 2.1 Eigennamen
- 2.2 Sozionyme
- 2.3 „Sozionymische Eigennamen“: „Teufel“ und „Spinne“
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Onomastik in Gottfried Kellers Novelle „Schwarze Spinne“, analysiert die semantisch-pragmatischen Charakteristika der Figurennamen und überprüft, inwieweit diese als konstruktiver Bestandteil der Welt der Novelle deren Sinn mitbestimmen. Es wird untersucht, ob die Namen der menschlichen und nichtmenschlichen Figuren (Spinne, Teufel) Bedeutung und Funktion für das Verständnis des Werkes haben.
- Bedeutung und Funktion von Eigennamen in der Novelle
- Analyse der semantischen und pragmatischen Aspekte von Figurennamen
- Der Einfluss der Onomastik auf die Konstruktion der Welt der Novelle
- Beziehung zwischen Onomastik und der Grundaussage des Werkes
- Untersuchung der Namen "Spinne" und "Teufel" als sozionymische Eigennamen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand: die Onomastik in Gotthelfs „Schwarze Spinne“. Sie erläutert das Ziel der Untersuchung – die Beschreibung der semantisch-pragmatischen Charakteristiken der Figurennamen – und begründet die Themenwahl aufgrund des Mangels an bestehenden Untersuchungen zu diesem Aspekt. Die Arbeit skizziert die Methodik (hermeneutisch, semiotisch, linguistisch-philologisch, Inhaltsanalyse) und die Gliederung. Der Forschungsgegenstand wird durch den Ausschluss bestimmter Onyma (Toponyme, Ethnonyme etc.) abgegrenzt, die für zukünftige Untersuchungen vorgesehen sind.
2. Empirische Befunde zur Bedeutung und Funktion der Figuren-Namen in Gotthelfs Novelle „Schwarze Spinne“: Dieses Kapitel analysiert die Eigennamen, Sozionyme und die sozionymischen Eigennamen "Teufel" und "Spinne". Die Analyse der Eigennamen ("Christine," "Christen," "Hans," "Uli") untersucht deren Bedeutung und Funktion im Kontext der Handlung und der Charaktere. Es wird der Gegensatz zwischen Christine als Symbol des Bösen und Christen als Vertreter des Guten herausgearbeitet. Die Analyse der weiteren Eigennamen wie "Hans Uli" in ihren verschiedenen Ausprägungen beleuchtet deren Rolle in der Erzählung und die Bedeutung des Namens "Hans" im Kontext des Werkes. Die Namen der Nebenfiguren (Benz, Sigrist, Türk) werden hinsichtlich ihrer Funktion im Handlungsgeschehen analysiert. Das Kapitel legt dar wie die Namen zur Charakterisierung der Figuren beitragen und wie sie die Handlung und die Beziehungen zwischen den Figuren beeinflussen.
Schlüsselwörter
Gotthelf, Schwarze Spinne, Onomastik, Figurennamen, Eigennamen, Sozionyme, Semantik, Pragmatik, Christentum, Gut und Böse, Symbol, Antiheldin, Held, Textanalyse, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Onomastik in Gotthelfs „Schwarze Spinne“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Onomastik (Namensgebung) in Gottfried Kellers Novelle „Schwarze Spinne“. Der Fokus liegt auf der Analyse der semantisch-pragmatischen Charakteristika der Figurennamen und deren Einfluss auf das Verständnis des Werkes. Es wird geprüft, inwieweit die Namen (menschliche und nichtmenschliche Figuren) Bedeutung und Funktion für den Sinn der Novelle haben.
Welche Namen werden analysiert?
Die Analyse umfasst Eigennamen (z.B. Christine, Christen, Hans, Uli), Sozionyme und die sozionymischen Eigennamen „Teufel“ und „Spinne“. Die Analyse der Eigennamen betrachtet deren Bedeutung und Funktion im Kontext der Handlung und der Charaktere. Die Nebenfiguren (Benz, Sigrist, Türk) werden ebenfalls hinsichtlich ihrer Namensgebung und deren Rolle im Handlungsgeschehen untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine hermeneutische, semiotische, linguistisch-philologische und inhaltsanalytische Methodik. Es wird die Bedeutung und Funktion der Namen im Kontext des Werkes untersucht, wobei die semantischen und pragmatischen Aspekte der Namensgebung im Vordergrund stehen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung und Funktion von Eigennamen, die Analyse der semantischen und pragmatischen Aspekte der Figurennamen, den Einfluss der Onomastik auf die Konstruktion der Welt der Novelle, die Beziehung zwischen Onomastik und der Grundaussage des Werkes und die Untersuchung der Namen "Spinne" und "Teufel" als sozionymische Eigennamen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit den empirischen Befunden zur Bedeutung und Funktion der Figurennamen, und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand, die Zielsetzung, die Methodik und die Gliederung. Das Hauptkapitel analysiert die verschiedenen Kategorien von Namen und deren Bedeutung im Kontext der Novelle. Der Ausschluss bestimmter Onyma (Toponyme, Ethnonyme etc.) für zukünftige Untersuchungen wird ebenfalls erwähnt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit legt dar, wie die Namen zur Charakterisierung der Figuren beitragen, die Handlung beeinflussen und die Beziehungen zwischen den Figuren verdeutlichen. Der detaillierte Inhalt der Schlussfolgerungen ist aus der gegebenen Zusammenfassung nicht vollständig ersichtlich, jedoch wird der Einfluss der Namensgebung auf das Verständnis der Novelle hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Gotthelf, Schwarze Spinne, Onomastik, Figurennamen, Eigennamen, Sozionyme, Semantik, Pragmatik, Christentum, Gut und Böse, Symbol, Antiheldin, Held, Textanalyse, Literaturwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Julia Seibert (Autor:in), 2010, J. Gotthelfs Novelle "Schwarze Spinne" - Empirische Befunde zur Bedeutung und Funktion der Figuren-Namen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152447