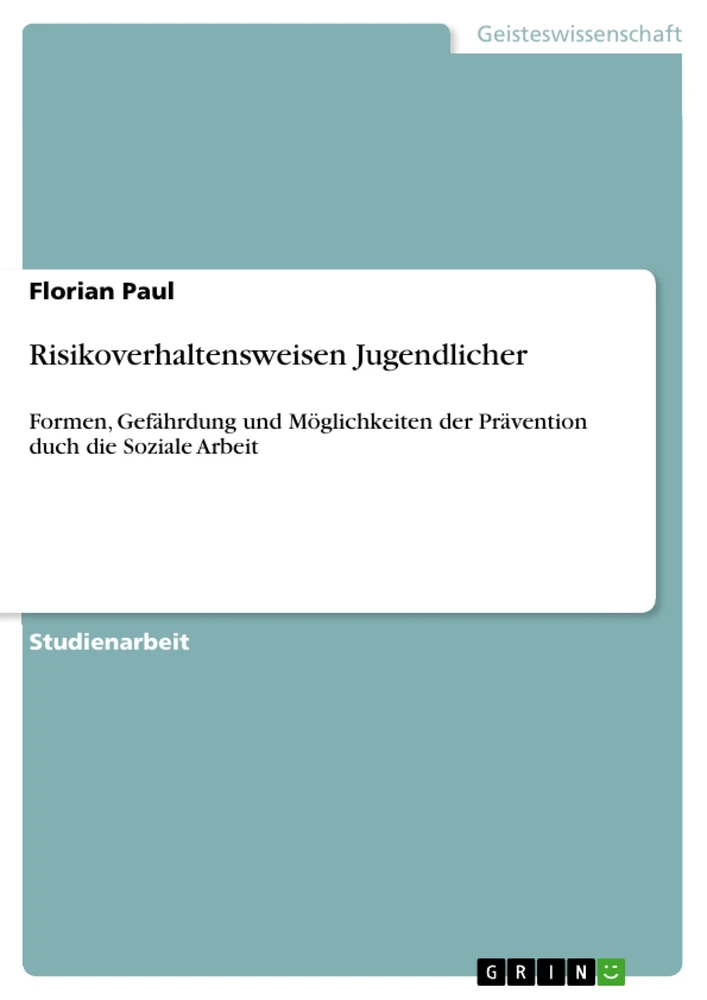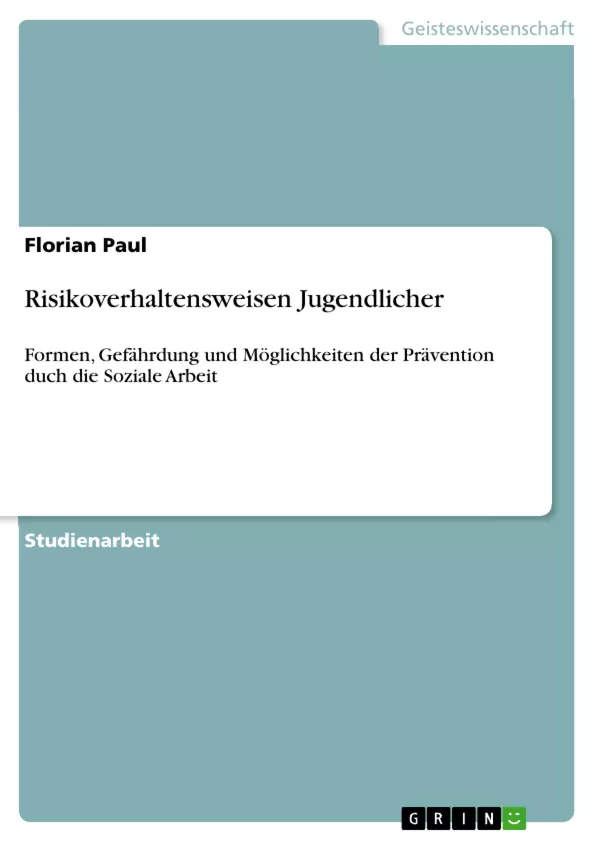Die Jugendgesundheitsforschung hat in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass die statistische Erhebung von Daten zu Mortalitäts- und Morbiditätsverteilung kein adäquates, ausreichendes Abbild des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen hergibt. Die gesundheitliche Lage kann sich z.B. auch in Verhaltensweisen, Lebensstilen oder Ressourcen ausdrücken, diese müssen daher ebenfalls berücksichtigt werden. Ziel der Arbeit ist es daher, ausgehend von einer Bergriffsklärung und Definition über die Kategorisierung jugendlichen Risikoverhaltens, das Gefährdungspotential anhand der Beispiele des Substanzenkonsums und Sexualverhaltens darzustellen und im Anschluss Möglichkeiten der Prävention durch die soziale Arbeit aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Formen des Risikoverhaltens Jugendlicher
- 1.1 Begriffsklärung und Definition
- 1.2 Kategorisierung des Risikoverhaltens
- 1.3 Gesundheitliches Risikoverhalten
- 2. Erklärungsmodelle und Gefährdungspotential
- 2.1 Substanzenkonsum
- 2.2 Sexualverhalten
- 3. Möglichkeiten der Prävention durch die Soziale Arbeit
- 3.1 Substanzenkonsum
- 3.2 Sexualverhalten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Risikoverhalten Jugendlicher, analysiert dessen Formen und Gefährdungspotenzial und beleuchtet die Möglichkeiten der Prävention durch die Soziale Arbeit. Die Arbeit geht dabei von einer Definition des Risikoverhaltens aus und kategorisiert verschiedene Formen, insbesondere im Hinblick auf gesundheitliche Risiken.
- Begriffliche Abgrenzung und Definition von Risikoverhalten im Jugendalter
- Kategorisierung des Risikoverhaltens in gesundheitliche, delinquente und finanzielle Bereiche
- Analyse des Gefährdungspotenzials anhand der Beispiele Substanzenkonsum und Sexualverhalten
- Möglichkeiten der Prävention durch die Soziale Arbeit im Bereich des Substanzenkonsums und Sexualverhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Risikoverhalten von Jugendlichen ein und stellt den aktuellen Forschungsstand sowie die Relevanz des Themas dar. Kapitel 1 widmet sich der Begriffsklärung und Definition von Risikoverhalten. Es werden verschiedene Kategorien des Risikoverhaltens vorgestellt und die Bedeutung des gesundheitlichen Risikoverhaltens hervorgehoben. Kapitel 2 befasst sich mit Erklärungsmodellen und Gefährdungspotenzialen, insbesondere im Hinblick auf Substanzenkonsum und Sexualverhalten. In Kapitel 3 werden Möglichkeiten der Prävention durch die Soziale Arbeit aufgezeigt, wobei die Schwerpunkte auf dem Umgang mit Substanzenmissbrauch und riskantem Sexualverhalten liegen.
Schlüsselwörter
Risikoverhalten, Jugendliche, Prävention, Soziale Arbeit, Gesundheit, Substanzenkonsum, Sexualverhalten, Gefährdungspotenzial, Erklärungsmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Risikoverhalten bei Jugendlichen definiert?
Risikoverhalten umfasst Handlungen mit potenziell negativen Folgen für die Gesundheit oder soziale Lage, die oft Teil der Identitätsfindung im Jugendalter sind.
In welche Kategorien lässt sich jugendliches Risikoverhalten einteilen?
Man unterscheidet grob zwischen gesundheitlichem (z.B. Substanzkonsum), delinquentem und finanziellem Risikoverhalten.
Welche Gefahren birgt der Substanzkonsum im Jugendalter?
Neben unmittelbaren Gesundheitsrisiken besteht die Gefahr von Abhängigkeit und negativen Auswirkungen auf die schulische und soziale Entwicklung.
Warum ist riskantes Sexualverhalten ein Thema der Jugendforschung?
Es geht um den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten und ungewollten Schwangerschaften sowie die Förderung einer selbstbestimmten Sexualität.
Wie kann Soziale Arbeit zur Prävention beitragen?
Durch Aufklärung, Stärkung der Lebenskompetenzen und das Angebot von niederschwelligen Beratungs- und Schutzräumen für Jugendliche.
- Citation du texte
- Florian Paul (Auteur), 2010, Risikoverhaltensweisen Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152571