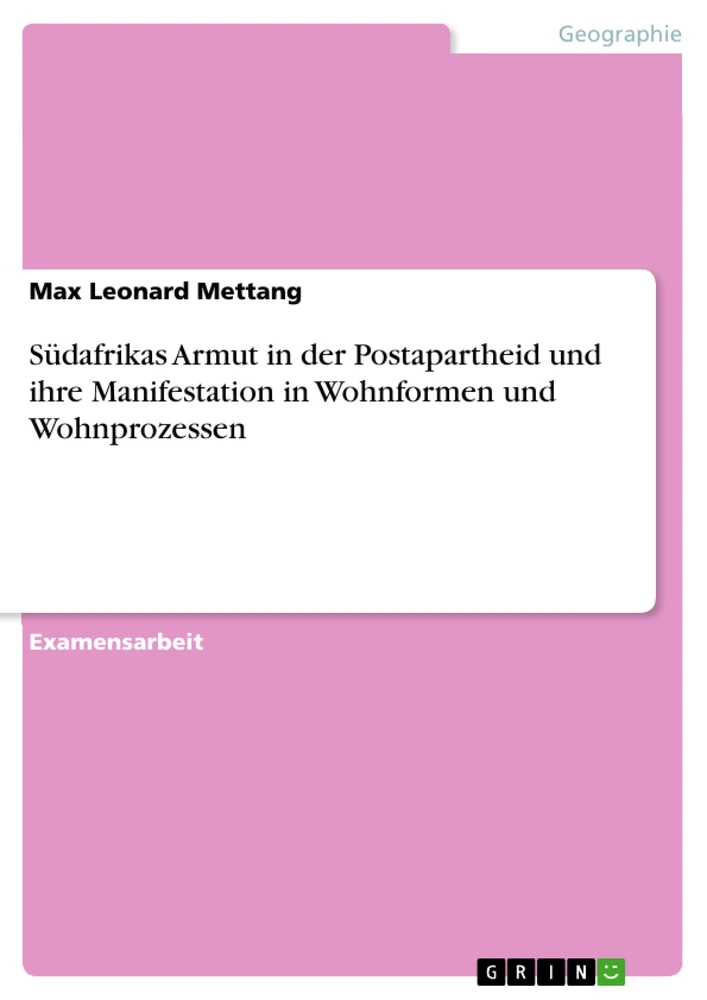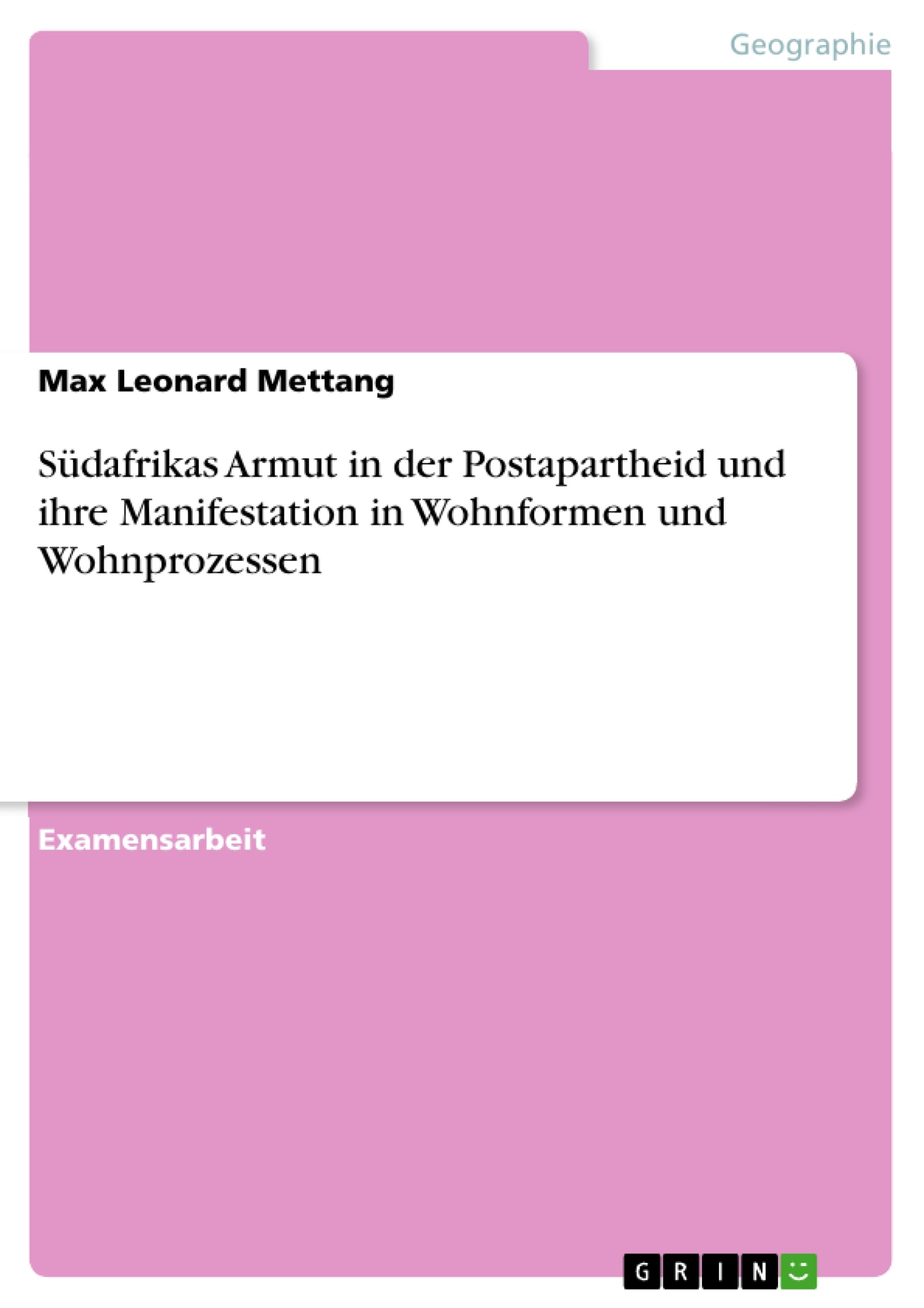Gegenstand dieser Arbeit ist es, die Armut Südafrikas in der Postapartheid auf multidimensionaler Ebene zu analysieren und ihre Manifestation in Wohnformen und Wohnprozessen zu erfassen. Um kontemporäre Armutswerte und Entwicklungen nachvollziehen zu können, bedarf es zu Beginn der Klärung des historischen Kontextes der Apartheid, der ökonomischen Situation des Landes sowie der Terminologie, der im Zusammenhang mit Armut verwendeten Begriffe. Daraufhin wird ein Armutsprofil Südafrikas generiert, in welchem Messwerte und Entwicklungen der letzten Jahre dargelegt werden. Im nächsten Schritt werden die wichtigsten Wohnformen der Armutsbevölkerung vorgestellt und Wohnprozesse, die aus migratorischen, politischen und familiären Strukturen resultieren, fokussiert.
Der empirische Teil „Household structures of economically disadvantaged settlements“ präsentiert Ergebnisse einer eigens durchgeführten Untersuchung von Siedlungsgebieten der in Stellenbosch (Western Cape) ansässigen Armutsbevölkerung, anhand deren Erhebungskriterien ein Bild der vorgefundenen Lebens- und Wohnsituation gezeichnet werden kann. Zum Schluss werden die Themengebiete dieser Arbeit im Bildungsplan der Werkrealschulen Baden-Württembergs (2012) verortet und didaktische Umsetzungsmöglichkeiten dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Südafrikas Apartheid
- 1.1 Terminologie und Überblick
- 1.2 Population Registration Act
- 1.3 Job Reservation
- 1.4 Natives Land Act
- 1.5 Abolition of Passes
- 1.6 Bantu Education
- 1.7 Monetärer Vergleich
- 1.8 Fazit
- 2 Wirtschaftssituation Südafrikas
- 2.1 Ökonomische Entwicklungen in den Folgejahren der Apartheid
- 2.2 Ökonomische Strukturen
- 2.3 Korruption
- 3 Armutsprofil Südafrikas
- 3.1 Terminologie und Messung
- 3.2 Südafrikas Armut im Überblick
- 3.3 Südafrikas Armut im internationalen Vergleich
- 3.4 Provinzielle Armutsunterschiede
- 3.5 Armutsrate nach Siedlungstyp
- 3.6 Ethnische Armutsverteilung
- 3.7 Armutsrate nach Altersgruppen
- 3.8 Armut nach Bildungsniveau
- 3.9 Arbeitslosigkeit
- 3.10 Genderspezifische Armutsunterschiede
- 4 Wohnformen der Armutsbevölkerung Südafrikas
- 4.1 Informelle Siedlungen und Shacks
- 4.2 RDP-Programme und sozialer Wohnungsbau
- 5 Wohnprozesse der Armutsbevölkerung Südafrikas
- 5.1 Urbanisierung südafrikanischer Metropolen
- 5.2 Urbanisierung als Vehikel informeller Siedlungsexpansion
- 5.3 Translokale Livelihood-Systeme
- 6 Gesamtfazit der Wohnformen und Wohnprozesse
- 7 Household structures of economically disadvantaged settlements
- 7.1 Verortung
- 7.2 Forschungsstand
- 7.3 Hypothesen-Formulierung
- 7.4 Erhebungsverfahren
- 7.5 Forschungsdesign
- 7.5.1 Studiendesign
- 7.5.2 Untersuchungshergang
- 7.5.3 Messinstrument
- 7.6 Fehleranalyse
- 7.7 Auswertung der Ergebnisse in Groendal
- 7.7.1 Fazit der Ergebnisse Groendals
- 7.8 Auswertung der Ergebnisse in Cloetesville
- 7.8.1 Fazit der Ergebnisse Cloetesvilles
- 7.9 Auswertung der Ergebnisse in Kayamandi
- 7.9.1 Fazit der Ergebnisse Kayamandis
- 7.10 Gesamtfazit der Erhebung
- 8 Lösungsansätze
- 8.1 Reduktion der Kluft zwischen ruralen und urbanen Zonen
- 8.2 Paradigmenwechsel im sozialen Wohnungsbau
- 8.3 Intelligente urbane Verkehrssysteme
- 9 Schulische Umsetzungsmöglichkeiten
- 9.1 Schulbuchanalyse „Terra 6“
- 9.2 Zeitschrift „Politik & Unterricht“ – Südafrika, Land der Gegensätze
- 9.3 Didaktisches Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert multidimensional die Armut in Südafrika nach der Apartheid und deren Auswirkungen auf Wohnformen und -prozesse. Ziel ist es, ein umfassendes Armutsprofil zu erstellen und didaktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Schulunterricht aufzuzeigen.
- Die sozioökonomischen Folgen der Apartheid
- Armutsindikatoren und deren Verteilung in Südafrika
- Wohnformen der Armutsbevölkerung (informelle Siedlungen, RDP-Häuser)
- Wohnprozesse und Migration
- Didaktische Implikationen für den Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Südafrikas Apartheid: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Apartheid in Südafrika, fokussiert auf die ethnische Disparität in sozialer und räumlicher Mobilität. Es werden wichtige Gesetze (Population Registration Act, Natives Land Act etc.) erläutert und deren Auswirkungen auf die dunkelhäutige Bevölkerung hinsichtlich Arbeit, Wohnraum und Bildung dargelegt. Der monetäre Vergleich verdeutlicht die eklatante Einkommensungleichheit während der Apartheid.
2 Wirtschaftssituation Südafrikas: Der Abschnitt beschreibt die ökonomische Entwicklung Südafrikas nach der Apartheid, einschließlich des BIP-Wachstums und ausländischer Direktinvestitionen. Es wird auf ökonomische Strukturen, die Herausforderungen eines Schwellenlandes und das Problem der Korruption eingegangen.
3 Armutsprofil Südafrikas: Dieses Kapitel erstellt ein Armutsprofil Südafrikas, indem verschiedene Armutslinien und Messmethoden (untere/obere Armutslinie, Gini-Koeffizient, HDI) erklärt werden. Es analysiert die Armutsrate nach verschiedenen Faktoren wie Provinz, Siedlungstyp, Ethnie, Alter und Bildungsniveau und vergleicht Südafrika mit anderen Ländern.
4 Wohnformen der Armutsbevölkerung Südafrikas: Hier werden die verschiedenen Wohnformen der Armutsbevölkerung Südafrikas beschrieben, mit einem Fokus auf informelle Siedlungen (Shacks, Backyard Shacks) und staatlich geförderten Wohnprojekten (RDP-Programme). Die unterschiedlichen Wohnqualitäten und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen werden beleuchtet.
5 Wohnprozesse der Armutsbevölkerung Südafrikas: Dieser Teil behandelt die Dynamik des Wohnens in Südafrika, insbesondere die Rolle der Urbanisierung und Migration. Es wird das Push-Pull-Modell erläutert und die translokale Perspektive von Livelihood-Systemen, die Verbindungen zwischen ländlichen und städtischen Räumen, untersucht.
6 Gesamtfazit der Wohnformen und Wohnprozesse: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Kapitel 4 und 5 zusammen und zeigt die engen Verflechtungen zwischen Armut, Wohnformen und Migrationsprozessen auf. Es hebt die anhaltende Wirkung der Apartheid auf die räumliche Segregation hervor.
7 Household structures of economically disadvantaged settlements: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Stellenbosch. Die Methodik (quantitative Erhebung, Fragebögen), die Hypothesen und die Auswertung der Daten in verschiedenen Siedlungsgebieten (Groendal, Cloetesville, Kayamandi) werden detailliert beschrieben. Die Ergebnisse werden im Kontext des bestehenden Forschungsstandes und der zuvor dargestellten Thematik interpretiert.
Schlüsselwörter
Südafrika, Armut, Postapartheid, Wohnformen, Wohnprozesse, informelle Siedlungen, RDP-Programme, Urbanisierung, Migration, soziale Ungleichheit, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert multidimensional die Armut in Südafrika nach der Apartheid und deren Auswirkungen auf Wohnformen und -prozesse. Ziel ist es, ein umfassendes Armutsprofil zu erstellen und didaktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Schulunterricht aufzuzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte umfassen die sozioökonomischen Folgen der Apartheid, Armutsindikatoren und deren Verteilung, Wohnformen der Armutsbevölkerung (informelle Siedlungen, RDP-Häuser), Wohnprozesse und Migration sowie didaktische Implikationen für den Schulunterricht.
Was beinhaltet das Kapitel über die Apartheid in Südafrika?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Apartheid, fokussiert auf ethnische Disparität in sozialer und räumlicher Mobilität. Es werden wichtige Gesetze (Population Registration Act, Natives Land Act etc.) erläutert und deren Auswirkungen auf die dunkelhäutige Bevölkerung hinsichtlich Arbeit, Wohnraum und Bildung dargelegt. Der monetäre Vergleich verdeutlicht die Einkommensungleichheit.
Wie wird die Wirtschaftssituation Südafrikas nach der Apartheid beschrieben?
Der Abschnitt beschreibt die ökonomische Entwicklung Südafrikas nach der Apartheid, einschließlich des BIP-Wachstums und ausländischer Direktinvestitionen. Es wird auf ökonomische Strukturen, die Herausforderungen eines Schwellenlandes und das Problem der Korruption eingegangen.
Was ist der Inhalt des Armutsprofils Südafrikas?
Dieses Kapitel erstellt ein Armutsprofil Südafrikas, indem verschiedene Armutslinien und Messmethoden (untere/obere Armutslinie, Gini-Koeffizient, HDI) erklärt werden. Es analysiert die Armutsrate nach verschiedenen Faktoren wie Provinz, Siedlungstyp, Ethnie, Alter und Bildungsniveau und vergleicht Südafrika mit anderen Ländern.
Welche Wohnformen der Armutsbevölkerung werden behandelt?
Hier werden die verschiedenen Wohnformen der Armutsbevölkerung Südafrikas beschrieben, mit einem Fokus auf informelle Siedlungen (Shacks, Backyard Shacks) und staatlich geförderten Wohnprojekten (RDP-Programme). Die unterschiedlichen Wohnqualitäten und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen werden beleuchtet.
Was wird unter Wohnprozessen der Armutsbevölkerung verstanden?
Dieser Teil behandelt die Dynamik des Wohnens in Südafrika, insbesondere die Rolle der Urbanisierung und Migration. Es wird das Push-Pull-Modell erläutert und die translokale Perspektive von Livelihood-Systemen, die Verbindungen zwischen ländlichen und städtischen Räumen, untersucht.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter im Zusammenhang mit dieser Arbeit?
Südafrika, Armut, Postapartheid, Wohnformen, Wohnprozesse, informelle Siedlungen, RDP-Programme, Urbanisierung, Migration, soziale Ungleichheit, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, empirische Forschung.
Was beinhaltet das Kapitel über die empirische Untersuchung?
Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Stellenbosch. Die Methodik (quantitative Erhebung, Fragebögen), die Hypothesen und die Auswertung der Daten in verschiedenen Siedlungsgebieten (Groendal, Cloetesville, Kayamandi) werden detailliert beschrieben. Die Ergebnisse werden im Kontext des bestehenden Forschungsstandes und der zuvor dargestellten Thematik interpretiert.
- Arbeit zitieren
- Max Leonard Mettang (Autor:in), 2016, Südafrikas Armut in der Postapartheid und ihre Manifestation in Wohnformen und Wohnprozessen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1525717