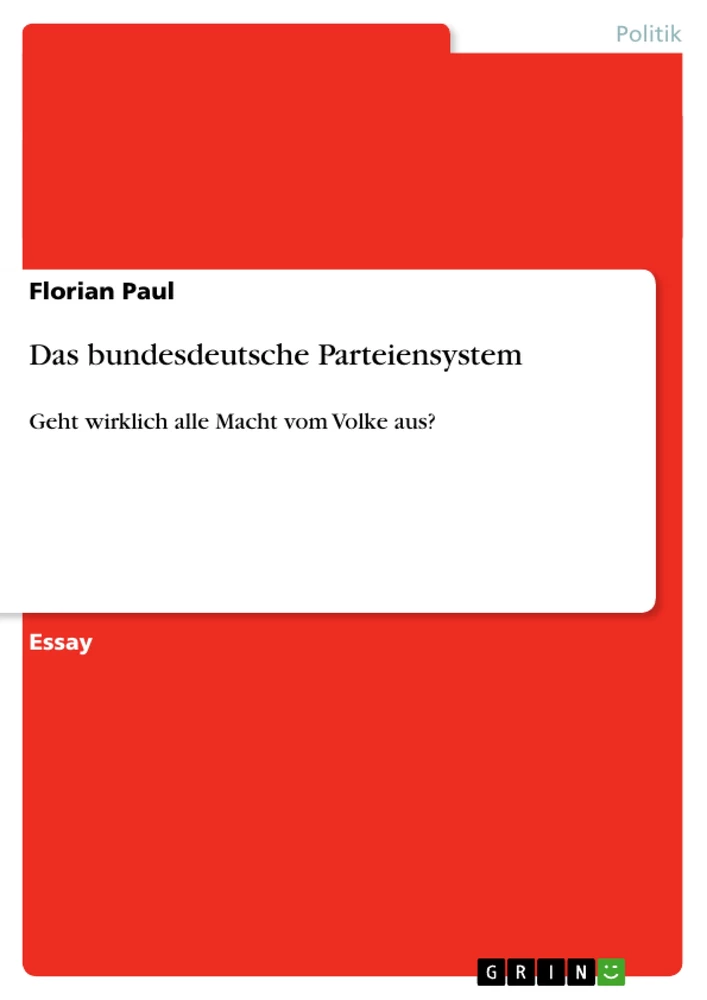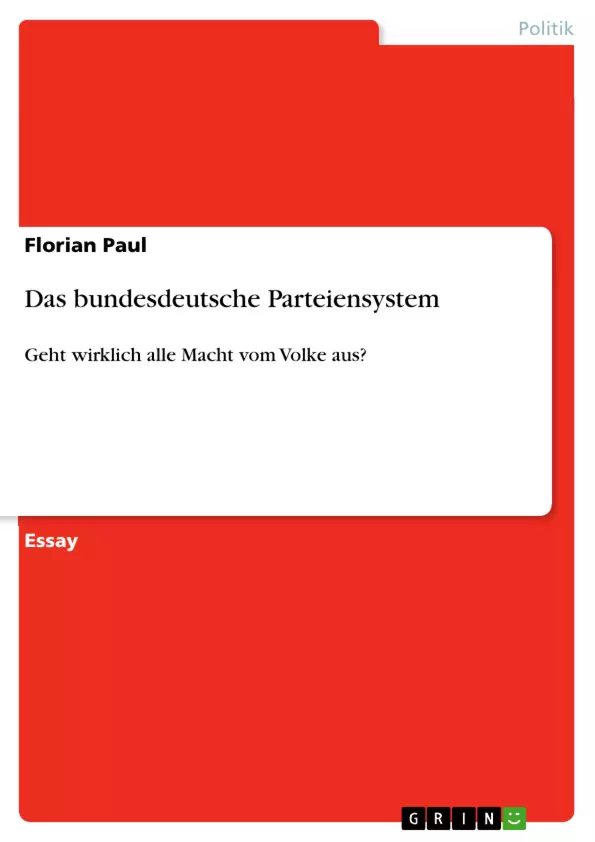Politische Parteien haben in Deutschland genau definierte Aufgaben und Funktionen. Sie kommen diesen Funktion allerdings faktisch nicht mehr nach und verlieren die Verbindung zu den Wählern.
Ohne Verbindung zu den Menschen und faktisch unkontrolliert von diesen sind Politiker und ihre Parteien aber auch größtenteils nicht mehr an den Interessen bzw. an dem Wohl des Volkes interessiert. Vielmehr treten eigene Interessen an Macht, Geld und Ämtern in den Vordergrund, die dargestellten Aufgaben werden kaum mehr wahrgenommen, sie geraten insbesondere zwischen
den Wahlkämpfen ins Hintertreffen.
Inhaltsverzeichnis
- Politische Parteien in Deutschland: Aufgaben und Funktionen
- Das Grundgesetz und die Parteien
- Das Parteiengesetz und seine Relevanz
- Innerparteiliche Demokratie: Anspruch und Wirklichkeit
- Politische Bildung durch Parteien
- Macht und Einfluss der Parteien: Demokratiedefizite
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das deutsche Parteiensystem und hinterfragt, inwieweit es dem Grundsatz „Macht vom Volke aus“ gerecht wird. Sie analysiert die Aufgaben und Funktionen politischer Parteien im Lichte des Grundgesetzes und des Parteiengesetzes, beleuchtet die innerparteiliche Demokratie und deren Defizite sowie die Rolle der Parteien in der politischen Bildung. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, ob und wie Parteien ihre verfassungsmäßigen Aufgaben erfüllen und welche Herausforderungen das System aktuell bewältigen muss.
- Aufgaben und Funktionen deutscher Parteien
- Innerparteiliche Demokratie und ihre Defizite
- Die Rolle der Parteien in der politischen Bildung
- Demokratiedefizite im deutschen Parteiensystem
- Machtstrukturen und der Einfluss auf politische Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Politische Parteien in Deutschland: Aufgaben und Funktionen: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Aufgaben und Funktionen politischer Parteien in Deutschland. Es beleuchtet ihre Rolle bei Wahlen, die Repräsentation von Interessen und die Beteiligung an der politischen Willensbildung. Es wird auf die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Parteien und ihrer tatsächlichen Umsetzung in der Praxis eingegangen, wobei der Fokus auf den oft beschränkten Aktivitäten der Parteien außerhalb von Wahlkampfzeiten liegt. Der immer größer werdende Rückzug der Bürger aus den Parteien und der Zuwachs an Engagement in NGOs wird ebenfalls diskutiert.
Das Grundgesetz und die Parteien: Dieser Abschnitt analysiert Artikel 21 des Grundgesetzes, der die Aufgaben und die rechtlichen Grundlagen der Parteien in Deutschland definiert. Die Bedeutung der Willensbildung, innerparteiliche Demokratie und die öffentliche Rechenschaft werden eingehend untersucht. Der Artikel beleuchtet die Möglichkeit des Verbots verfassungswidriger Parteien durch das Bundesverfassungsgericht und hebt die Bedeutung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hervor. Es wird der Gegensatz zwischen dem Anspruch des Grundgesetzes und der tatsächlichen Praxis der Parteien thematisiert.
Das Parteiengesetz und seine Relevanz: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Parteiengesetz von 1967 und seinen Bestimmungen zur Organisation und Finanzierung politischer Parteien. Es wird analysiert, inwieweit das Gesetz den Anforderungen des Grundgesetzes gerecht wird und ob es die Parteien in die Lage versetzt, ihre verfassungsmäßigen Aufgaben effektiv zu erfüllen. Die Bedeutung der "freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes" wird beleuchtet. Die Frage der Neutralität in der politischen Bildung, die das Parteiengesetz als Parteiaufgabe nennt, wird kritisch hinterfragt.
Innerparteiliche Demokratie: Anspruch und Wirklichkeit: Dieser Abschnitt analysiert die innerparteiliche Demokratie deutscher Parteien. Es wird kritisch untersucht, inwieweit die in der Theorie geforderte Mitwirkung der Mitglieder an der Willensbildung tatsächlich umgesetzt wird. Das oft undurchsichtige Delegiertensystem und der Mangel an Mitgliederbefragungen werden als zentrale Probleme hervorgehoben. Die Gefahr des „Verschmorens im eigenen Saft“ und die geringe Bereitschaft zur personellen Öffnung werden diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Widerspruch zwischen dem Anspruch auf innerparteiliche Demokratie und der Realität in vielen Parteien.
Politische Bildung durch Parteien: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Parteien in der politischen Bildung. Es wird hinterfragt, inwieweit Parteien dieser Aufgabe, wie sie im Parteiengesetz verankert ist, tatsächlich gerecht werden. Die fehlende konkrete Definition von "politischer Bildung" im Gesetz lässt Parteien große Freiräume, was die Umsetzung betrifft. Die Problematik der Neutralität in der politischen Bildung wird erneut thematisiert.
Macht und Einfluss der Parteien: Demokratiedefizite: Der letzte Abschnitt des Vorschaubeitrags thematisiert Demokratiedefizite im deutschen Parteiensystem. Er beleuchtet die fehlende direkte Macht des Volkes, die eingeschränkte Möglichkeit zur Mitbestimmung bei wichtigen politischen Entscheidungen und die weitreichenden Folgen dieser Machtkonzentration. Der Text betont die mangelnde Verbindung zwischen Politikern und Wählern und die daraus resultierende mangelnde Verantwortlichkeit gegenüber den Interessen der Bevölkerung. Die Notwendigkeit von Veränderungen und die Entwicklung hin zu mehr direkter Demokratie werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Parteiendemokratie, Grundgesetz, Parteiengesetz, Willensbildung, innerparteiliche Demokratie, politische Bildung, Demokratiedefizit, Macht vom Volke aus, Wahlbeteiligung, NGOs.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des deutschen Parteiensystems
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das deutsche Parteiensystem und untersucht, inwieweit es dem Grundsatz „Macht vom Volke aus“ entspricht. Sie beleuchtet die Aufgaben und Funktionen politischer Parteien, die innerparteiliche Demokratie, die Rolle der Parteien in der politischen Bildung und Demokratiedefizite im System.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. die Aufgaben und Funktionen deutscher Parteien im Lichte des Grundgesetzes und des Parteiengesetzes, die innerparteiliche Demokratie und deren Defizite, die Rolle der Parteien in der politischen Bildung, Machtstrukturen und deren Einfluss auf politische Entscheidungen sowie die Frage der Erfüllung verfassungsmäßiger Aufgaben durch die Parteien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Politische Parteien in Deutschland: Aufgaben und Funktionen; Das Grundgesetz und die Parteien; Das Parteiengesetz und seine Relevanz; Innerparteiliche Demokratie: Anspruch und Wirklichkeit; Politische Bildung durch Parteien; Macht und Einfluss der Parteien: Demokratiedefizite.
Was wird im Kapitel "Politische Parteien in Deutschland: Aufgaben und Funktionen" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Aufgaben und Funktionen politischer Parteien, ihre Rolle bei Wahlen und der Interessenvertretung. Es analysiert die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, den Rückzug der Bürger aus Parteien und den Zuwachs an Engagement in NGOs.
Was wird im Kapitel "Das Grundgesetz und die Parteien" behandelt?
Dieser Abschnitt analysiert Artikel 21 des Grundgesetzes, der die rechtlichen Grundlagen der Parteien definiert. Die Bedeutung der Willensbildung, innerparteiliche Demokratie und öffentliche Rechenschaft werden untersucht, ebenso die Möglichkeit des Verbots verfassungswidriger Parteien.
Was wird im Kapitel "Das Parteiengesetz und seine Relevanz" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Parteiengesetz von 1967 und seinen Bestimmungen zur Organisation und Finanzierung. Es analysiert, inwieweit das Gesetz den Anforderungen des Grundgesetzes gerecht wird und die Parteien in die Lage versetzt, ihre verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen. Die Frage der Neutralität in der politischen Bildung wird kritisch hinterfragt.
Was wird im Kapitel "Innerparteiliche Demokratie: Anspruch und Wirklichkeit" behandelt?
Dieser Abschnitt analysiert die innerparteiliche Demokratie und untersucht kritisch, inwieweit die Mitwirkung der Mitglieder an der Willensbildung tatsächlich umgesetzt wird. Probleme wie das Delegiertensystem und der Mangel an Mitgliederbefragungen werden hervorgehoben.
Was wird im Kapitel "Politische Bildung durch Parteien" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Parteien in der politischen Bildung und hinterfragt, inwieweit sie dieser Aufgabe gerecht werden. Die fehlende konkrete Definition von "politischer Bildung" im Gesetz und die Problematik der Neutralität werden thematisiert.
Was wird im Kapitel "Macht und Einfluss der Parteien: Demokratiedefizite" behandelt?
Der letzte Abschnitt thematisiert Demokratiedefizite im deutschen Parteiensystem, die fehlende direkte Macht des Volkes, die eingeschränkte Mitbestimmung und die Folgen der Machtkonzentration. Die mangelnde Verbindung zwischen Politikern und Wählern und die Notwendigkeit von Veränderungen werden angesprochen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Parteiendemokratie, Grundgesetz, Parteiengesetz, Willensbildung, innerparteiliche Demokratie, politische Bildung, Demokratiedefizit, Macht vom Volke aus, Wahlbeteiligung, NGOs.
- Arbeit zitieren
- Florian Paul (Autor:in), 2009, Das bundesdeutsche Parteiensystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152573