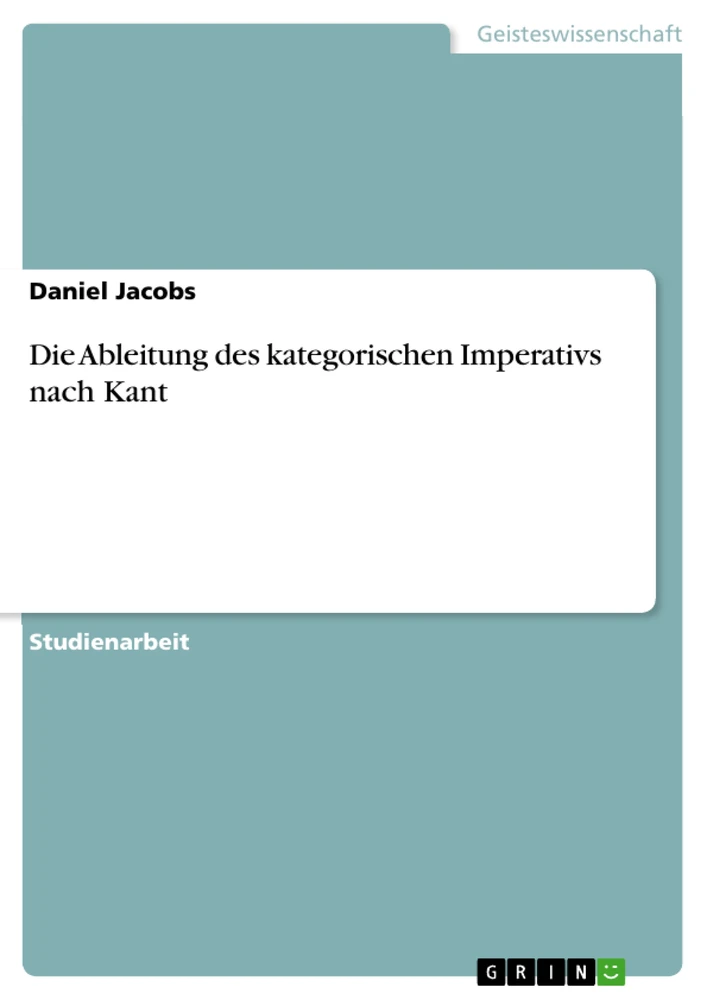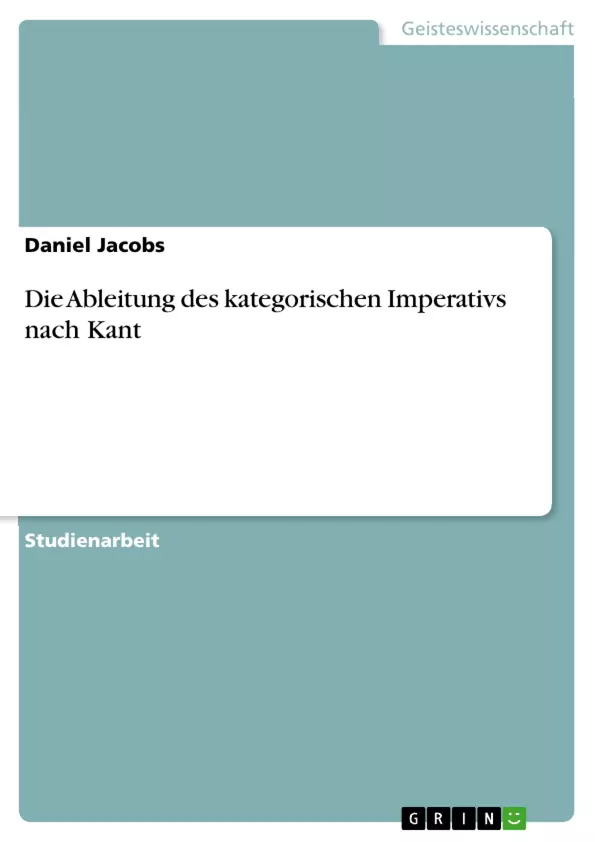Was ist moralisches Handeln? Wann handeln wir moralisch richtig? Was spielt bei der moralischen Bewertung von Handlungen die entscheidende Rolle? Sind es die Absichten die entscheidend sind? Oder sollte das Hauptaugenmerk auf den Konsequenzen der Handlungen liegen? Diese Fragen dominieren schon seit der Antike die Moralphilosophie und es ist die Aufgabe der praktischen Philosophie diese zu untersuchen und angemessen zu beantworten. Erst durch seine Entwicklung des Pflichtbegriffs und die daraus resultierende Erklärung, was es bedeutet moralisch wertvoll zu handeln, läutete Immanuel Kant den Wendepunkt für die Bewertung moralischer Handlungen in der Philosophiegeschichte ein. In der nachfolgenden Arbeit soll daher gezeigt werden, wie Kant, aufbauend auf seinem Begriff des guten Willens und der Pflicht, seinen kategorischen Imperativ ableitet. Die Vorgehensweise ist daher wie folgt: In Kapitel 2.1 wird zunächst der gute Wille erklärt und verdeutlicht, was seine Güte im Wesentlichen ausmacht. Anschließend wird illustriert, in wie weit dieser gute Wille im Zusammenhang mit moralischen Pflichten steht, um letzten Endes zu beantworten, was es eigentlich bedeutet moralisch gut zu handeln. Um so diese Frage angemessen beantworten zu können wird zu diesem Zweck in Kapitel 2.2 Kants Auffassung von dem Begriff der Pflicht verdeutlicht und gezeigt, in wie fern dieser den Begriff eines guten Willens beinhaltet. Anschließend unterscheidet Kant zwischen zwei Arten von Handlungen, um herauszuarbeiten welche Handlungen überhaupt moralischen Wert besitzen. Resultierend aus diesen Ergebnissen, wird schlussendlich Kants kategorischer Imperativ dargestellt, den er dann schließlich aus seiner Definition, was es bedeutet aus Pflicht zu handeln ableitet. In diesem ist ein allgemeiner Leitsatz zu verstehen, der uns verdeutlichen soll, wann unsere moralischen Pflichten, nach denen wir uns bei moralisch wertvollen Handlungen richten, als moralisch gut zu bewerten sind. Des Weiteren beschäftigt sich dann Kapitel 3 mit den problematischen Ansätzen von Kants Moralphilosophie. Speziell die Definition der Handlungen aus Pflicht, wirft im Hinblick auf die Beteiligung der persönlichen Neigungen einige Schwierigkeiten auf und es wird dort anhand von Beispielen versucht zu zeigen, warum Kants Ethik für den praktischen Gebrauch als zu streng angesehen werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der kategorische Imperativ
- Der gute Wille
- Kants Pflichtbegriff und die Ableitung des kategorischen Imperativs
- Kritische Beurteilung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ableitung des kategorischen Imperativs nach Immanuel Kant, einem zentralen Konzept der praktischen Philosophie. Dabei wird untersucht, wie Kant aus dem Begriff des guten Willens und der Pflicht seinen kategorischen Imperativ ableitet. Die Arbeit analysiert Kants Definition des guten Willens, seine Auffassung von Pflicht und zeigt, wie er die Beziehung zwischen beiden zum Verständnis moralischer Handlungen nutzt.
- Definition und Bedeutung des guten Willens
- Kants Pflichtbegriff und seine Relevanz für moralische Handlungen
- Die Ableitung des kategorischen Imperativs aus dem Begriff der Pflicht
- Die Bedeutung des kategorischen Imperativs für die moralische Beurteilung von Handlungen
- Kritik an Kants Moralphilosophie und die Frage der Praktikabilität seiner Ethik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Moralphilosophie vor und führt in Kants Beitrag zur Debatte über moralische Handlungen ein. Sie skizziert die Vorgehensweise der Arbeit und beschreibt die einzelnen Kapitel.
Der kategorische Imperativ
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Ableitung des kategorischen Imperativs aus dem Begriff des guten Willens und der Pflicht. Es untersucht Kants Definition des guten Willens, analysiert seinen Pflichtbegriff und zeigt, wie beide Konzepte zusammenhängen. Die Analyse gipfelt in der Darstellung des kategorischen Imperativs als allgemeiner Leitsatz für moralisch wertvolles Handeln.
2.1 Der gute Wille
Dieses Unterkapitel erklärt Kants Definition des guten Willens als das einzige uneingeschränkt Gute und diskutiert, wie er den Begriff vom guten Willen und der Pflicht zusammenbringt. Es werden verschiedene Gütertypen und ihre Beziehung zum guten Willen erörtert, um zu verdeutlichen, warum der gute Wille unabhängig von seinen Folgen gut ist.
2.2 Kants Pflichtbegriff und die Ableitung des kategorischen Imperativs
Dieses Unterkapitel beleuchtet Kants Verständnis von Pflicht und zeigt, wie es mit dem guten Willen zusammenhängt. Es beschreibt verschiedene Arten von Handlungen und erörtert, welche Handlungen moralischen Wert besitzen. Schließlich wird Kants Ableitung des kategorischen Imperativs aus seiner Definition von Handeln aus Pflicht dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der praktischen Philosophie wie den guten Willen, die Pflicht, den kategorischen Imperativ und die moralische Beurteilung von Handlungen. Sie analysiert Kants Definition des guten Willens und seine Ableitung des kategorischen Imperativs aus dem Begriff der Pflicht. Dabei werden wichtige Begriffe wie moralische Handlungen, Gesinnungsethik, kategorischer Imperativ, Pflicht und die Verbindung von Willen und Pflicht im Zentrum der Diskussion stehen.
Häufig gestellte Fragen
Wie leitet Kant den kategorischen Imperativ ab?
Kant leitet ihn aus den Begriffen des „guten Willens“ und der „Pflicht“ ab, wobei der Imperativ als allgemeines Gesetz fungiert, das moralisch wertvolles Handeln definiert.
Was macht den „guten Willen“ bei Kant so besonders?
Der gute Wille ist laut Kant das einzige uneingeschränkt Gute, da er unabhängig von den Folgen einer Handlung allein durch das Wollen an sich wertvoll ist.
Was ist der Unterschied zwischen Handeln „aus Pflicht“ und „pflichtgemäßem“ Handeln?
Nur Handeln „aus Pflicht“ (aus Achtung vor dem Gesetz) hat moralischen Wert. „Pflichtgemäßes“ Handeln kann auch aus Eigennutz oder Neigung erfolgen und ist daher moralisch neutral.
Welche Kritikpunkte an Kants Ethik werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit problematisiert die Strenge der kantischen Ethik, insbesondere den Ausschluss persönlicher Neigungen, was die praktische Anwendbarkeit im Alltag erschwert.
Was ist die zentrale Frage der praktischen Philosophie bei Kant?
Die zentrale Frage lautet: „Was soll ich tun?“ bzw. nach welchen Maximen muss ich handeln, damit mein Tun moralisch richtig und allgemeingültig ist.
- Citar trabajo
- Daniel Jacobs (Autor), 2009, Die Ableitung des kategorischen Imperativs nach Kant, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152645