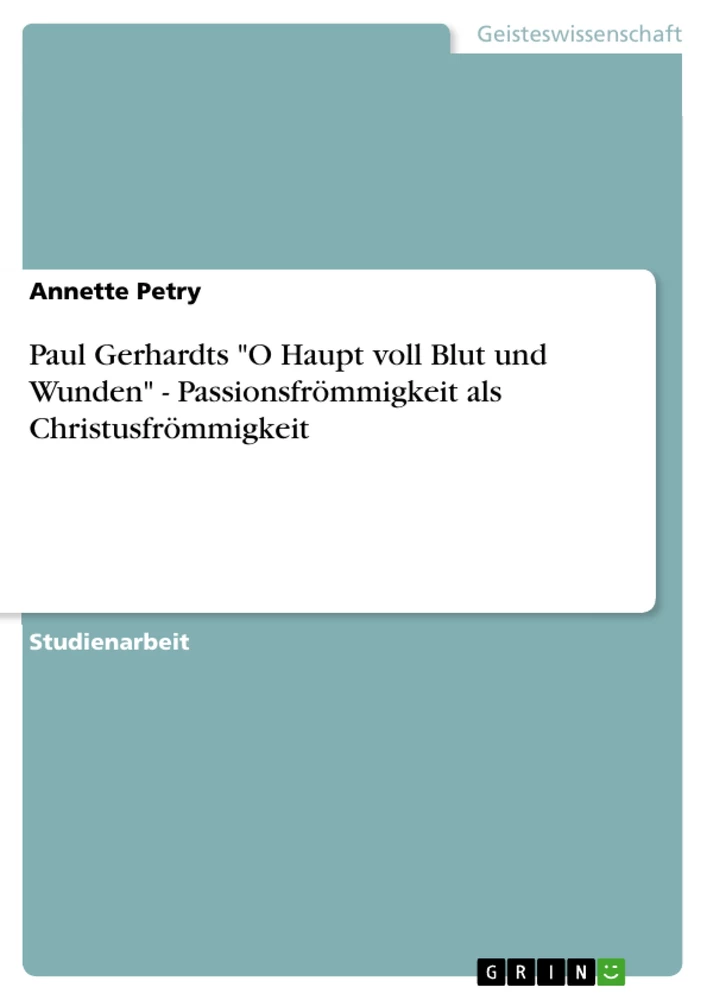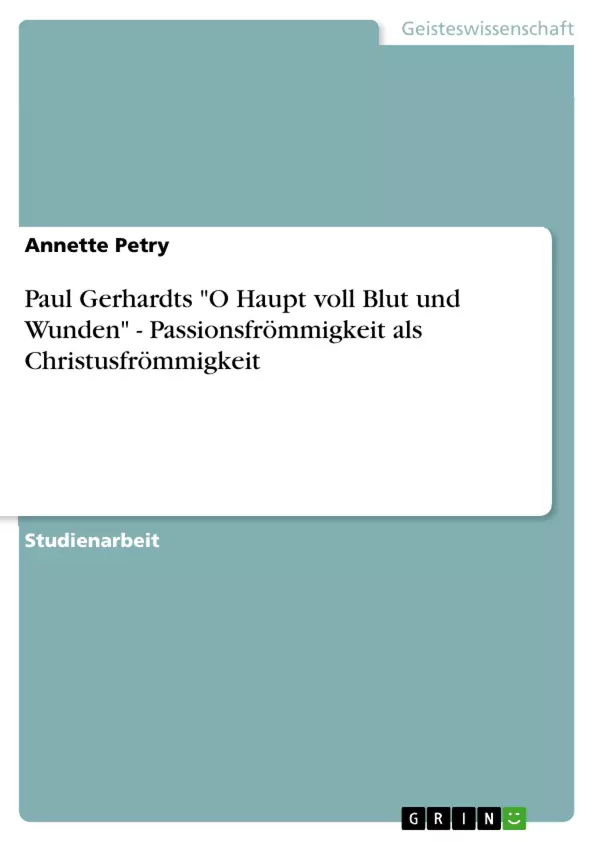Der deutsche Theologe Paul Gerhardt ist wohl einer der bekanntesten Dichter im Evangelischen Gesangbuch (EG). Neben Martin Luther stehen von Gerhardt die meisten Gedichte im EG. Mit etwa 30 Liedern macht dies 7,6% des Gesamtbestandes. Gerhardt hat aber im Vergleich zu Luther längere Gedichte verfasst und mit 327 Strophen sind fast doppelt so viele wie von Luther im EG abgedruckt. Bekannte Lieder, die ihren festen Platz im Kirchenjahr haben, wie beispielsweise „Wie soll ich dich empfangen“ , „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ oder „O Haupt voll Blut und Wunden“ sind weithin bekannt und beliebt. Dabei fällt vor allem auf, dass Gerhardt zu jedem Anlass, zu jeder Zeit des Kirchenjahres etwas zu sagen hatte. Fröhliches und Trauriges fasste er gleichermaßen in zum Teil schonungslose Worte. Trotz allem ließ er aber die Zuversicht und den tiefen Glauben an Gott nicht außen vor, wenn es um Trauer und Tod ging.
Gerade „O Haupt voll Blut und Wunden“ befasst sich in eindringlicher Weise mit dem gekreuzigten Jesus, der voller Schmerz und geschändet doch noch so viel Kraft und Zuversicht gibt. Mit diesem Gedicht, das heutzutage nach der Melodie von Hans Leo Haßler von 1601 gesungen wird, befasst sich diese Arbeit.
Zu Beginn soll Paul Gerhardt in Leben und Werk vorgestellt werden. Danach wird der Begriff der Passionsfrömmigkeit geklärt und ein kurzer geschichtlicher Überblick zur Entstehung derselben vorgelegt. Passionsmystik, Erscheinungsformen der Passionsfrömmigkeit und Entstehung und Form von Passionsliedern und Passionsmusik werden in den darauffolgenden Unterkapitel näher erläutert. Nach einer kurzen Einführung in Stephan Fridolins Werk „Schatzbehalter“ schließt das Kapitel mit einer Erläuterung der protestantischen Passionsfrömmigkeit.
Das vierte Kapitel veranschaulicht schließlich anhand des Gedichts „O Haupt voll Blut und Wunden“ die Passionsfrömmigkeit, die sich zur Christusfrömmigkeit gewandelt hat.
Ein kurzer Ausblick auf die Passionsfrömmigkeit in anderen Passionslieder Paul Gerhardts, wird in Kapitel fünf gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paul Gerhardt - Leben und Werk
- Kurze Biographie
- Werk in Auswahl
- Passionsfrömmigkeit
- Begriffsklärung
- Geschichtlicher Überblick
- Passionsmystik
- Erscheinungsweisen der Passionsfrömmigkeit seit dem Spätmittelalter
- Zeiten des Passionsgedenkens
- Formen des Passionsgedenkens
- Medien des Passionsgedenkens
- Passionslied und Passionsmusik
- Stephan Fridolins „Schatzbehalter“
- Passionsfrömmigkeit im Protestantismus
- Passionsfrömmigkeit in „O Haupt voll Blut und Wunden“
- Text des Gedichts
- Passionsfrömmigkeit in „O Haupt voll Blut und Wunden“
- Weitere Passionslieder Paul Gerhardts unter dem Aspekt der Passionsfrömmigkeit betrachtet
- „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“
- Text des Gedichtes
- Passionsfrömmigkeit in „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“
- „O Welt, sieh hier dein Leben“
- Text des Gedichtes
- Passionsfrömmigkeit in „O Welt, sieh hier dein Leben“
- „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Bildnachweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hauptseminararbeit befasst sich mit der Passionsfrömmigkeit in den Werken des deutschen Theologen und Kirchenlieddichters Paul Gerhardt. Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung und Bedeutung der Passionsfrömmigkeit im Kontext des 17. Jahrhunderts zu beleuchten und anhand ausgewählter Gedichte Gerhardts, insbesondere „O Haupt voll Blut und Wunden“, zu analysieren.
- Die Entwicklung der Passionsfrömmigkeit im historischen Kontext
- Die Rolle der Passionsmystik in der Frömmigkeit des 17. Jahrhunderts
- Die Bedeutung von Passionsliedern und Passionsmusik in der Verbreitung der Passionsfrömmigkeit
- Die Transformation der Passionsfrömmigkeit in eine Christusfrömmigkeit in den Werken Paul Gerhardts
- Die Analyse ausgewählter Gedichte Paul Gerhardts unter dem Aspekt der Passionsfrömmigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Paul Gerhardt als einen der bedeutendsten Kirchenlieddichter des 17. Jahrhunderts vor und führt in das Thema der Passionsfrömmigkeit ein. Das zweite Kapitel beleuchtet Leben und Werk Paul Gerhardts, wobei die Biographie und ausgewählte Werke des Dichters näher betrachtet werden.
Das dritte Kapitel widmet sich der Passionsfrömmigkeit. Es wird eine Begriffsklärung vorgenommen, ein geschichtlicher Überblick über die Entstehung der Passionsfrömmigkeit gegeben und die Rolle der Passionsmystik sowie die Erscheinungsformen der Passionsfrömmigkeit im Spätmittelalter beleuchtet. Des Weiteren werden Passionslied und Passionsmusik sowie das Werk Stephan Fridolins „Schatzbehalter“ behandelt. Das Kapitel schließt mit einer Erläuterung der protestantischen Passionsfrömmigkeit.
Das vierte Kapitel analysiert das Gedicht „O Haupt voll Blut und Wunden“ im Hinblick auf die Passionsfrömmigkeit und zeigt, wie sich diese in eine Christusfrömmigkeit wandelt.
Das fünfte Kapitel gibt einen Ausblick auf die Passionsfrömmigkeit in weiteren Passionsliedern Paul Gerhardts, wie „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ und „O Welt, sieh hier dein Leben“.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Passionsfrömmigkeit, die Christusfrömmigkeit, Paul Gerhardt, Kirchenlieddichtung, Passionsmystik, Passionslied, Passionsmusik, Stephan Fridolin, „Schatzbehalter“, Protestantismus, „O Haupt voll Blut und Wunden“, „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“, „O Welt, sieh hier dein Leben“.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Paul Gerhardt?
Paul Gerhardt (1607–1676) war ein bedeutender deutscher Theologe und neben Martin Luther der wichtigste Kirchenlieddichter im Evangelischen Gesangbuch.
Was bedeutet Passionsfrömmigkeit?
Es bezeichnet die religiöse Konzentration auf das Leiden und Sterben Jesu Christi, oft verbunden mit einer tiefen emotionalen Anteilnahme des Gläubigen.
Wie wandelt sich Passionsfrömmigkeit bei Gerhardt zur Christusfrömmigkeit?
Das Leiden Jesu wird nicht nur als historisches Ereignis betrachtet, sondern als persönliche Zuwendung Christi zum Einzelnen, was Vertrauen und Zuversicht im Glauben stärkt.
Was ist das Besondere an dem Lied „O Haupt voll Blut und Wunden“?
Es beschreibt eindringlich den leidenden Christus am Kreuz und vermittelt gleichzeitig Trost und die Gewissheit des Heils für den sündigen Menschen.
Welche Rolle spielt Stephan Fridolin in diesem Kontext?
Sein Werk „Schatzbehalter“ wird als Beispiel für die spätmittelalterliche Passionsfrömmigkeit herangezogen, die Gerhardts protestantische Dichtung beeinflusste.
Welche weiteren Passionslieder von Paul Gerhardt sind bekannt?
Weitere wichtige Beispiele sind „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ und „O Welt, sieh hier dein Leben“.
- Quote paper
- Annette Petry (Author), 2009, Paul Gerhardts "O Haupt voll Blut und Wunden" - Passionsfrömmigkeit als Christusfrömmigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152684