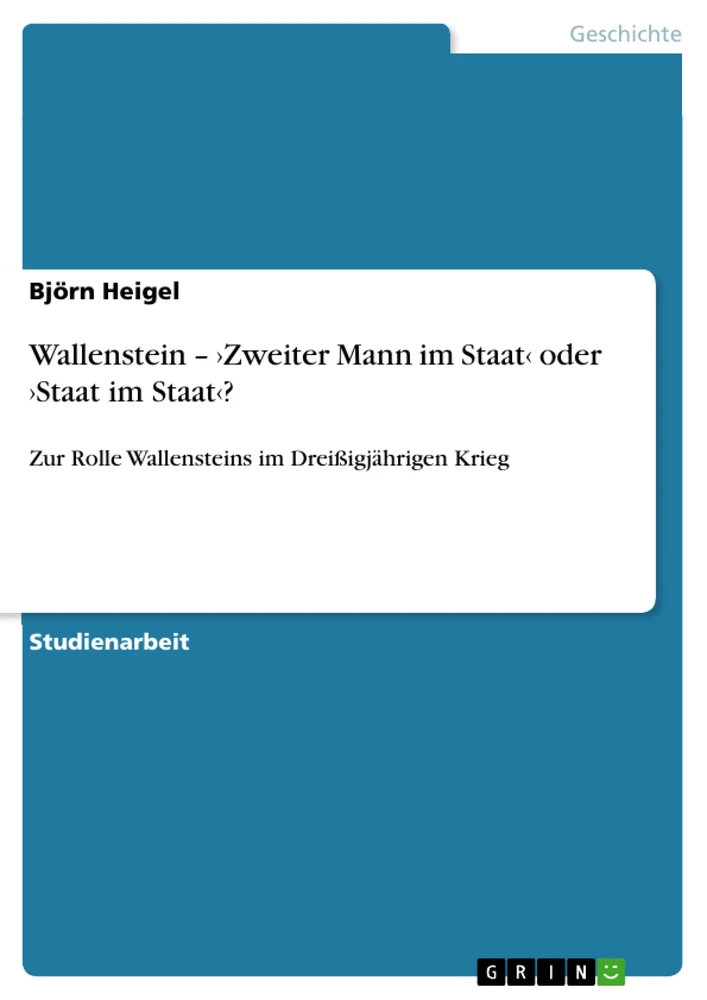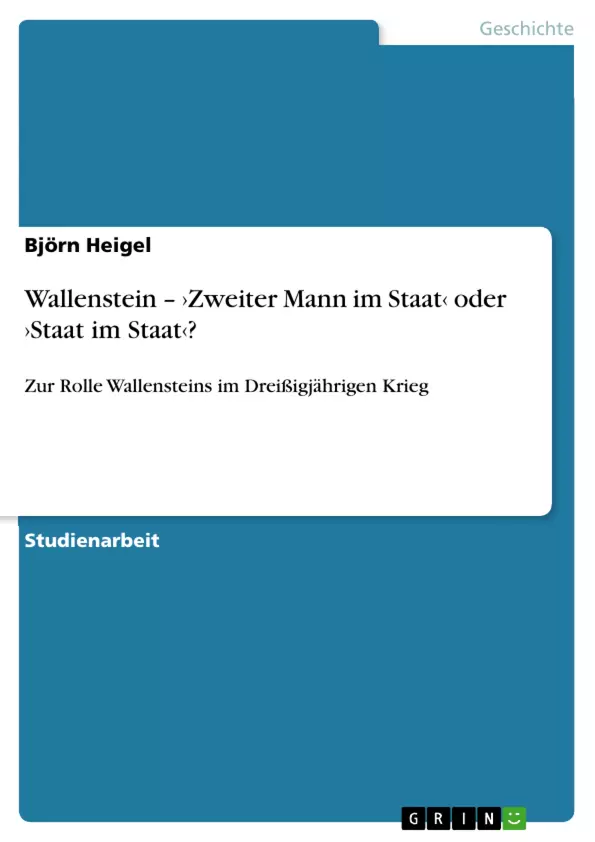Seit seinem Auftauchen im Umfeld des Dreißigjährigen Krieges ist Wallenstein immer wieder ins Interessengebiet der Geschichtsforschung gerückt. Bereits in der zeitgenössischen Publizistik wurde seine Stellung und seine ungewöhnliche Machtposition in Bezug auf den damaligen Kaiser Ferdinand II. diskutiert und kritisch hinterfragt. Aber auch Jahrhunderte später ist die Aufmerksamkeit, mit der man dem Feldherrn begegnet, nicht abgerissen. Monographien und literarische Verarbeitungen des Wallenstein Stoffes finden sich nicht nur in der deutschen Klassik und als expressionistische Romandarstellung bei Alfred Döblin, sondern auch bei so bekannten Historikern wie Leopold von Ranke, Golo Mann und einer Reihe von anderen bekannten Geistesgrößen.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, zu klären, inwieweit Wallenstein als zweiter Mann im Reich hinter Kaiser Ferdinand II. verstanden werden kann oder ob die Bezeichnung Wallensteins als ›Staat im Staat‹ eine höhere historische Legitimation besitzt. Nach einer kurzen Einordnung des Themas in die historische Forschung, dient ein Aufsatz Christoph Kampmanns, Professor für Neuere Geschichte und Frühe Neuzeit an der Philipps-Universität Marburg, als Ausgangspunkt für das wissenschaftliche Arbeiten.
Im weiteren Verlauf der hier dargelegten forschungsorientierten Vertiefung wird untersucht, inwieweit Golo Mann in seiner hochgelobten Wallenstein-Biographie über die Zeit des zweiten Generalats des Feldherren schreibt – und ob hier Inidizien für eine eindeutige Stellungnahme zur Ausgangsfrage zu finden sind. Dem wird die Wallenstein-Biographie Hellmut Diwalds, die bereits 1969, also zwei Jahre bevor Manns Geschichtserzählung erschienen ist, gegenübergestellt.
Anhand der folgenden Quellenarbeit mit dem Ersten Pilsner Revert wird versucht, Anhaltspunkte für die Legitimation von Wallensteins Anklage des Hochverrates zu finden. Ausgehend von den hier vorgestellten Ergebnissen soll abschließend Rückbezug auf den Kampmann-Aufsatz genommen werden. Diese Diskussion stellt den abschließenden Teil der hier vorliegenden Arbeit dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzer biographischer Abriss und das zweite Generalat Wallensteins in der historischen Debatte
- Darstellung der relevanten Forschungsliteratur
- Wallensteins Herrschaft als ›Staat im Staat‹ als Voraussetzung für seine Administration als zeitweiliger >zweiter Mann< als Ausgangspunkt
- Darstellung des wallensteinschen Staates in Friedland und seiner höchsten Machtposition bei Golo Mann
- Friedland als >>glückliche Erde« bei Hellmut Diwald
- Vergleich der relevanten Forschungsliteratur hinsichtlich der Fragestellung
- Quellenarbeit am Ersten Pilsner Revers von 1634
- Schlusswort und Ergebnisdarstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle Albrecht von Wallensteins im Dreißigjährigen Krieg und beleuchtet die Frage, ob er als "zweiter Mann im Staat" unter Kaiser Ferdinand II. betrachtet werden kann oder ob die Bezeichnung "Staat im Staat" für seine Machtposition zutreffender ist.
- Wallensteins Aufstieg zum Heerführer der kaiserlichen Streitkräfte
- Die Einführung der Kontributionszahlungen als revolutionäre Versorgungstaktik
- Wallensteins Machtposition im Vergleich zu Kaiser Ferdinand II.
- Die wissenschaftliche Debatte um Wallensteins Rolle im Dreißigjährigen Krieg
- Die Bedeutung des Ersten Pilsner Revers für die Beurteilung von Wallensteins Anklage des Hochverrats
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Dreißigjährigen Krieges und die Rolle von Albrecht von Wallenstein dar. Sie hebt die Bedeutung der Debatte um Wallensteins Machtposition und die verschiedenen Interpretationen seiner Rolle hervor.
- Kurzer biographischer Abriss und das zweite Generalat Wallensteins in der historischen Debatte: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über Wallensteins Leben und Karriere. Es beleuchtet seine ökonomische Unabhängigkeit, seinen Aufstieg zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Regimente und die Einführung des Kontributionssystems während seines ersten Generalats.
- Darstellung der relevanten Forschungsliteratur: Dieses Kapitel analysiert verschiedene wissenschaftliche Werke, die sich mit Wallensteins Herrschaft und Machtposition auseinandersetzen. Es untersucht insbesondere die Interpretationen von Golo Mann und Hellmut Diwald.
Schlüsselwörter
Albrecht von Wallenstein, Dreißigjähriger Krieg, Kaiser Ferdinand II., "zweiter Mann im Staat", "Staat im Staat", Kontributionssystem, historiographische Debatte, Erste Pilsner Revers, Hochverrat.
Häufig gestellte Fragen
War Wallenstein ein "Staat im Staat"?
Diese Bezeichnung bezieht sich auf Wallensteins enorme Machtfülle, seine ökonomische Unabhängigkeit und seine eigene Administration in Friedland, die oft losgelöst vom Kaiser agierte.
Was war das revolutionäre Kontributionssystem Wallensteins?
Wallenstein führte ein System ein, bei dem besetzte Gebiete für den Unterhalt der Armee zahlen mussten ("Der Krieg ernährt den Krieg"), was ihn militärisch unabhängig machte.
Welche Historiker werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Wallenstein-Biographien von Golo Mann und Hellmut Diwald sowie die Forschungsergebnisse von Christoph Kampmann.
Was ist der "Erste Pilsner Revers"?
Ein Dokument von 1634, in dem Wallensteins Offiziere ihm die Treue schworen. Es diente später als Hauptbeweis für die Anklage des Hochverrats gegen ihn.
Wie war das Verhältnis zwischen Wallenstein und Kaiser Ferdinand II.?
Es war geprägt von gegenseitiger Abhängigkeit, aber auch von wachsendem Misstrauen des Kaisers gegenüber Wallensteins eigenmächtiger Politik und militärischer Macht.
- Quote paper
- Björn Heigel (Author), 2010, Wallenstein – ›Zweiter Mann im Staat‹ oder ›Staat im Staat‹?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152695