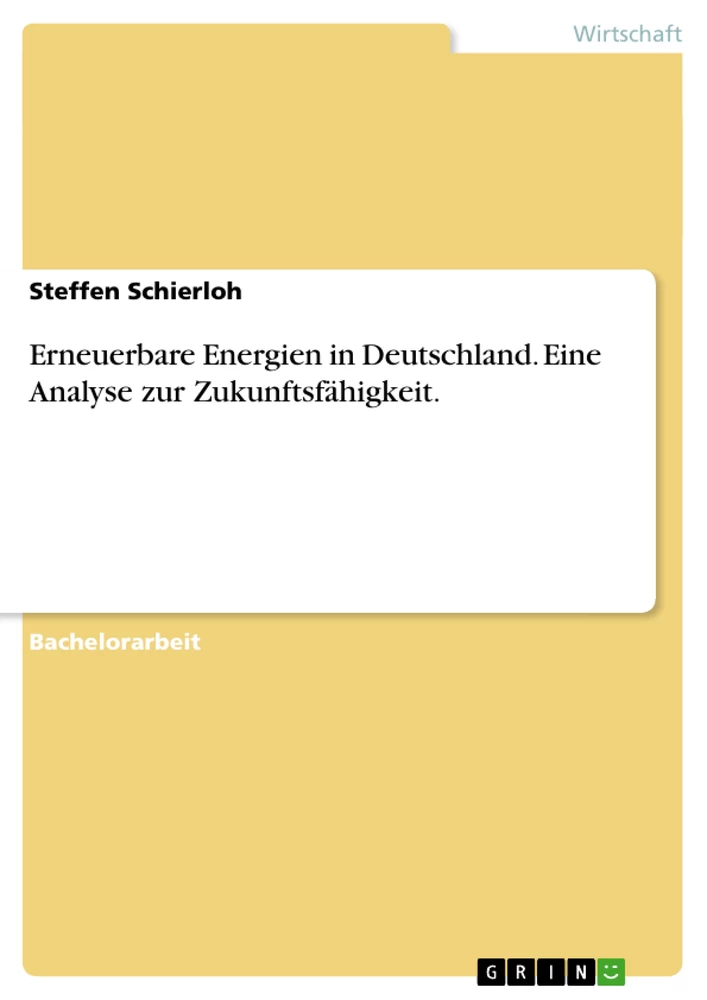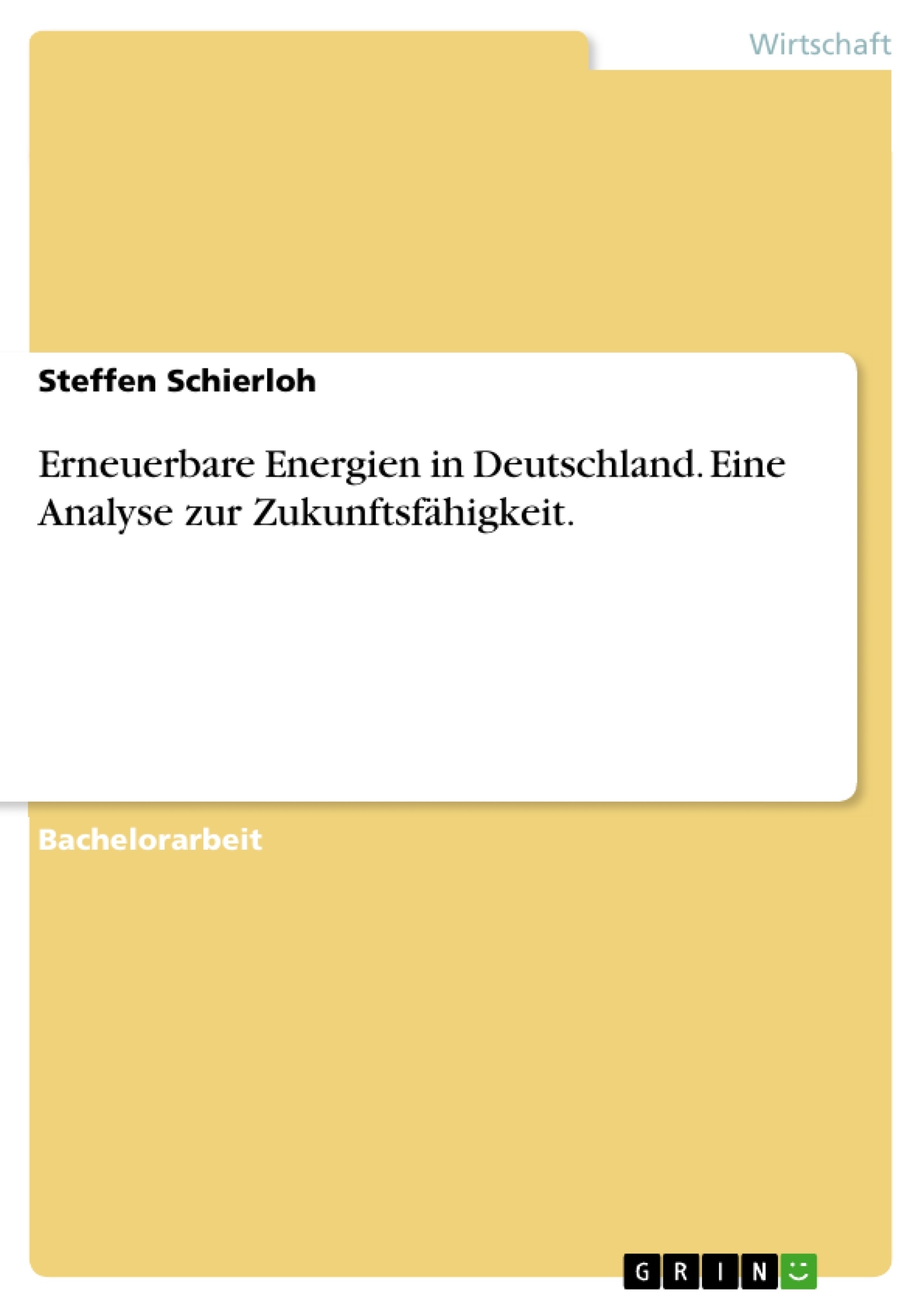Die erneuerbaren Energien werden als Heilsbringer für eine bessere und umweltfreundlichere Zukunft gesehen. Der Wandel im Energiemix hin zu „grünen Technologien“ kostet die Bundesregierung und den Verbraucher durch verschiedene Förderinstrumente jährlich Milliarden Euro. Sind die geltenden Förderinstrumente noch effektiv oder hat sich das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) überlebt? Ist der Wandel zur sauberen, „grünen“, nicht-atomaren Energiewirtschaft zurzeit überhaupt noch finanzierbar oder sollen die Subventionen gekürzt werden? Die Aufgabe dieser Bachelor Thesis ist die Analyse zur Zukunftsfähigkeit der erneuerbaren Energien und die Beantwortung dieser Fragen. Durch die unterschiedlichen Arten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat sich der Autor dazu entschlossen, einen erneuerbaren Energieträger herauszustellen und einer tiefergehenden Analyse zu unterziehen. Der Schwerpunkt dieser Thesis liegt hier im Bereich der Photovoltaik. Diese Branche wird zurzeit noch durch hohe EEG-Vergütungssätze gefördert und hat in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum erzielt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Struktur der Arbeit
- Photovoltaik: Eine deutsche Erfolgsstory
- Entwicklung der Photovoltaik
- Die Sonnenwende in Deutschland
- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- Historische Entwicklung der Förderung Erneuerbarer Energien in Deutschland
- Rahmenbedingungen
- Branchenprofil Photovoltaik
- Ein Überblick über den deutschen Solarmarkt
- Struktur der Photovoltaikbranche
- Strategische Positionierung
- Investitionen und Forschung
- Technik
- Volkswirtschaftliche Gesamtbelastung
- Kostenwirkungen
- Beschaffungsmehrkosten
- Regel- und Ausgleichsenergie
- Verwaltungskosten und Brennstoffmehrbedarf
- Ausbau des deutschen Stromnetzes
- Nutzenwirkungen
- Wertschöpfung in Deutschland
- Reduktion externer Kosten bei der Stromerzeugung
- Merit-Order-Effekt
- Einsparung bei Energieimporten
- Einfluss auf den Arbeitsmarkt
- Analyse der Diskussion um die Kürzung der Photovoltaik-Förderungen
- Kürzung der Photovoltaik-Förderungen
- Standpunkt der Politik
- Standpunkt der Photovoltaikbranche
- Quo vadis Solarenergie
- Modulpreise und Standortwahl
- Dezentrale Energieversorgung
- Fazit Photovoltaikförderung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Zukunftsfähigkeit von Erneuerbaren Energien in Deutschland, insbesondere die Photovoltaikbranche. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung, die Rahmenbedingungen und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Photovoltaik in Deutschland zu untersuchen.
- Die Entwicklung und der aktuelle Stand der Photovoltaik in Deutschland
- Die Förderung von Erneuerbaren Energien durch das EEG und deren Auswirkungen
- Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Photovoltaikbranche, inklusive Kosten und Nutzen
- Die Diskussion um die Kürzung der Photovoltaik-Förderungen und deren Folgen
- Der Ausblick auf die Zukunftsfähigkeit der Photovoltaik in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Struktur der Arbeit erläutert. Anschließend wird die Entwicklung der Photovoltaik in Deutschland dargestellt, wobei die Sonnenwende als Wendepunkt hervorgehoben wird. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird im Detail betrachtet, einschließlich seiner historischen Entwicklung und der aktuellen Rahmenbedingungen. Es folgt eine Analyse der Photovoltaikbranche, die einen Überblick über den deutschen Solarmarkt, die Struktur der Branche, die strategische Positionierung, Investitionen und Forschung sowie die Technik beinhaltet.
Die Arbeit untersucht dann die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Photovoltaik, indem sie Kosten und Nutzen analysiert. Hier werden die Kostenwirkungen, wie z. B. Beschaffungsmehrkosten, Regel- und Ausgleichsenergie, Verwaltungskosten und Brennstoffmehrbedarf sowie der Ausbau des deutschen Stromnetzes, betrachtet. Die Nutzenwirkungen werden im Hinblick auf die Wertschöpfung in Deutschland, die Reduktion externer Kosten bei der Stromerzeugung, den Merit-Order-Effekt und die Einsparung bei Energieimporten untersucht. Außerdem wird der Einfluss der Photovoltaik auf den Arbeitsmarkt beleuchtet. Die Arbeit schließt mit einer Analyse der Diskussion um die Kürzung der Photovoltaik-Förderungen und deren Folgen für die Branche, sowie einem Fazit und Ausblick auf die Zukunftsfähigkeit der Photovoltaik in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Erneuerbare Energien, Photovoltaik, EEG, Förderung, Branchenanalyse, Volkswirtschaftliche Auswirkungen, Kosten und Nutzen, Zukunftsfähigkeit, Deutschland.
- Citation du texte
- Steffen Schierloh (Auteur), 2010, Erneuerbare Energien in Deutschland. Eine Analyse zur Zukunftsfähigkeit., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152716