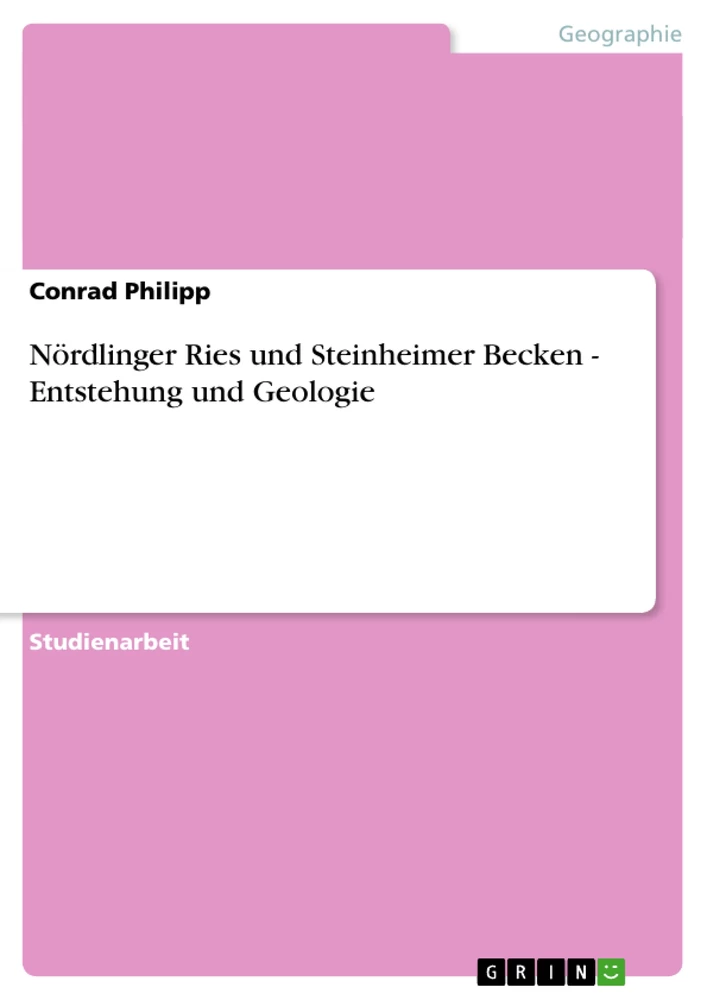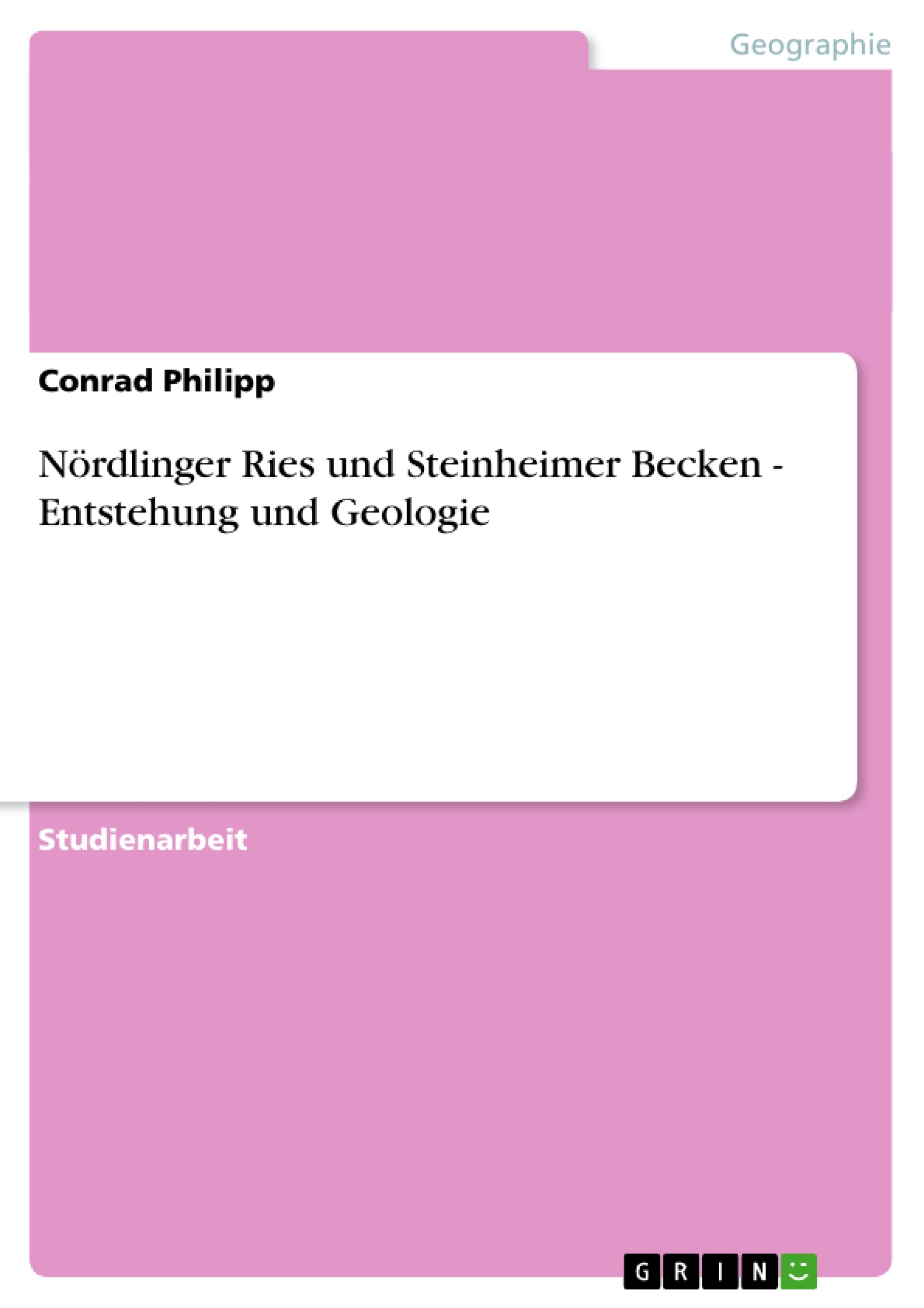In der Mitte des Städtedreiecks München-Nürnberg-Stuttgart liegt - eingesenkt in den
Mittelgebirgszug der Schwäbisch-Fränkischen Jura, auch Alb genannt - die nahezu
kreisrunde Ebene des Nördlinger Rieses und des Steinheimer Beckens. In Abb.1 ist
die Lage der Krater dargestellt. Besonders auffällig sind die zwei fast kreisrunden
Becken dieser Landschaft. Das flachwellige Ries-Becken besitzt eine Ausdehnung
von etwa 25 km Durchmesser und ist besonders im Südwesten, Süden und Osten
von einem morphologisch gut entwickelten Kraterrand begrenzt. Den flachwelligen
Boden umkränzen Höhenzüge von 100 bis 200 m im Osten, sowie 60 bis 100 m im
Westen. Die heute sichtbare Kraterebene (die im Mittel 100-150 m tiefer als der
Kraterrand liegt) wird als Ries oder Nördlinger Ries bezeichnet. Seit man weiß, dass
das Ries seine Existenz dem Einschlag eines Meteoriten verdankt, spricht man
allgemein vom Rieskrater. Das andere fast kreisrunde Becken von Steinheim hat heute einen mittleren
Durchmesser von 3,5 km und ist rund 120 m in die umgebende Albhochfläche
eingetieft. In der Mitte ragt ein Hügel auf, der Klosterberg. Die Krater des Nördlinger
Ries und des Steinheimer Beckens sind zur gleichen Zeit entstanden (HÜTTNER & SCHMIDT-KALER 1999:8-9), nachdem ein Meteorit durch Reibung in der
Erdatmosphäre zerbrach und zwei Gesteinskörper vor 15 Millionen in
Süddeutschland einschlugen (HÜTTNER & SCHMIDT-KALER 1999:7).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Nördlinger Ries
- Entstehung
- Typologie der Riesgesteine
- Gliederung der Impaktgesteine
- Bunte Trümmermasse
- Polymikten Kristallbreccien
- Suevit
- Das Steinheimer Becken
- Die Forschungsgeschichte
- Die Entstehung
- Geologischer Überblick
- Bedeckung im Tertiär
- Schichtenfolge
- Bedeckung im Quartär
- Seeentwicklung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Dokument befasst sich mit der Entstehung und Geologie des Nördlinger Rieses und des Steinheimer Beckens. Es geht insbesondere um die Erläuterung der Entstehung der beiden Krater durch den Einschlag von Meteoriten und die Analyse der geologischen Formationen und Veränderungen in den beiden Becken.
- Meteoriteneinschlag als Ursache für die Entstehung des Nördlinger Rieses und des Steinheimer Beckens
- Geologische Formationen und Gesteinsarten im Nördlinger Ries
- Forschungsgeschichte und Entstehung des Steinheimer Beckens
- Geologische Veränderungen im Steinheimer Becken im Tertiär und Quartär
- Entwicklung des Steinheimer Beckens als Seegebiet
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die geografische Lage des Nördlinger Rieses und des Steinheimer Beckens vor und beschreibt deren morphologische Eigenschaften. Im zweiten Kapitel wird die Entstehung des Nördlinger Rieses durch den Einschlag eines Meteoriten erläutert. Es werden die verschiedenen Gesteinsarten und die Gliederung der Impaktgesteine, wie die Bunte Trümmermasse, die Polymikten Kristallbreccien und der Suevit, detailliert beschrieben. Das dritte Kapitel widmet sich dem Steinheimer Becken, seiner Forschungsgeschichte und der Entstehung. Die geologischen Veränderungen im Tertiär und Quartär sowie die Entwicklung des Beckens als Seegebiet werden ausführlich beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Impaktkrater, Meteoriten, Geologie, Entstehung des Rieses, Entstehung des Steinheimer Beckens, Impaktgesteine, Bunte Trümmermasse, Suevit, Forschungsgeschichte, Schichtenfolge, Seeentwicklung.
- Citar trabajo
- Conrad Philipp (Autor), 2003, Nördlinger Ries und Steinheimer Becken - Entstehung und Geologie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15274