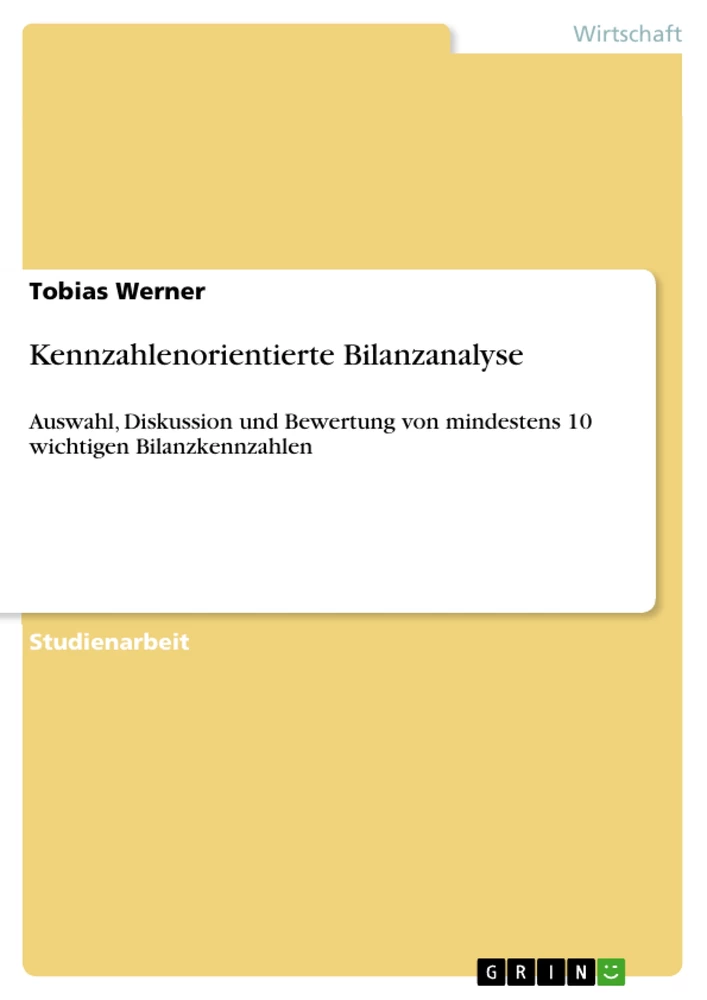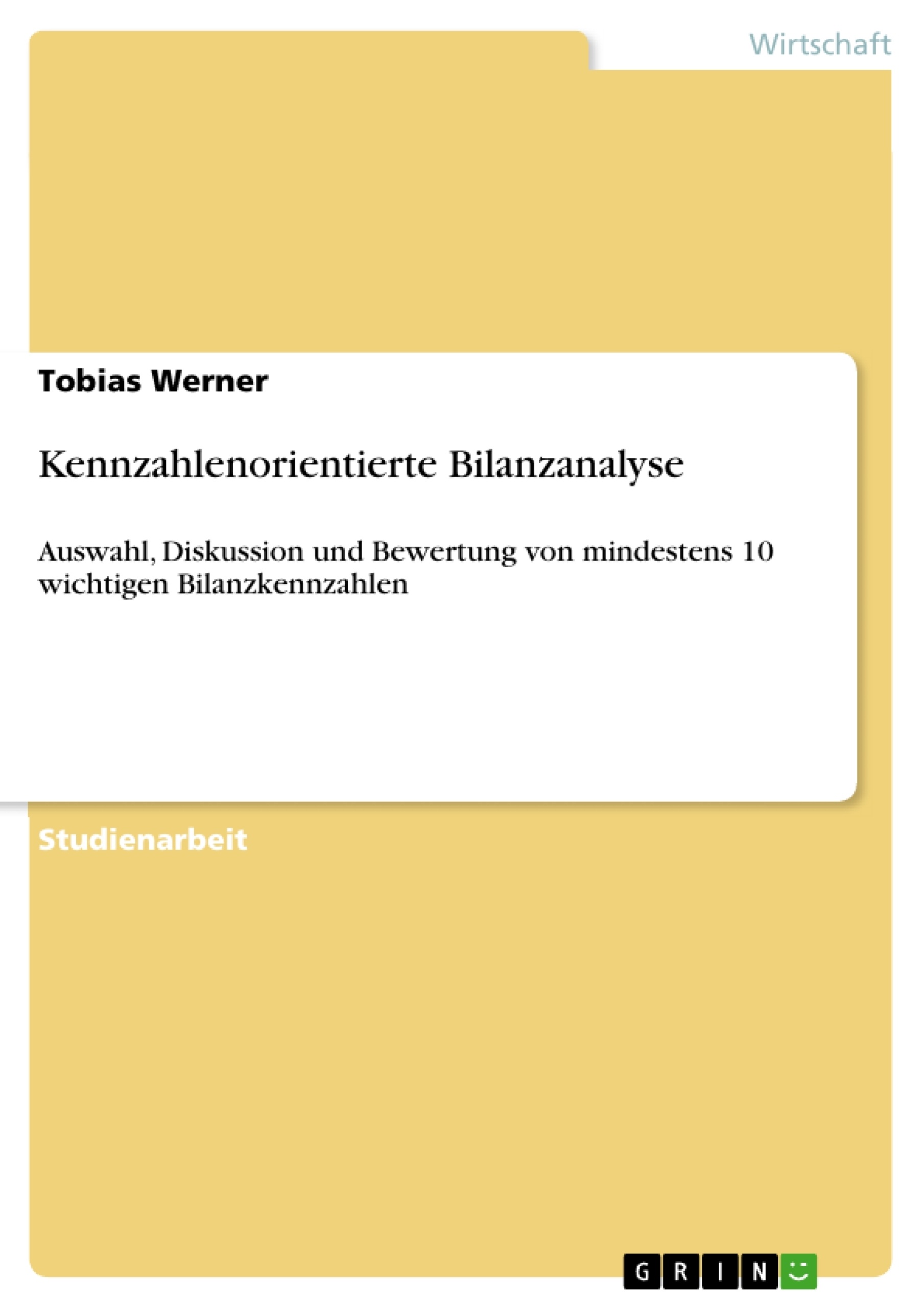Kennzahlen sind ein unverzichtbares Instrument zur Unternehmenssteuerung und zur Analyse von Unternehmensprozessen. Sie erläutern und veranschaulichen unternehmerische Tatbestände und zeigen mögliche Schwachstellen im Unternehmen auf. Die zunehmende Internationalisierung der Rechnungslegung und die sich stetig wandelnde deutsche Rechnungslegung führen dazu, dass die Analyse der Jahresabschlüsse komplexer wird. Die klassische Bilanzanalyse mit ihrer Kennzahlenorientierung bildet dabei den Kern der investor- und kapitalvergabeorientierten Unternehmensanalyse. Insbesondere Banken haben ein Interesse an der Vermögens- und Ertragslage sowie an den Liquiditätsverhältnissen. Es gibt daher für alle wesentlichen Bereiche der Bilanzanalyse Kennzahlen: zur Kapital- und Vermögensstruktur, zur Finanzierung bzw. Liquidität, zur Rentabilität und weitere Kennzahlen wie zum Cashflow, Shareholder-Value-Kennzahlen oder Investitionskennzahlen. Es existieren Hunderte verschiedener Kennzahlen und auch die unterschiedlichen Definitionen von Kennzahlen in der Literatur erschweren eine einheitliche Anwendung. Dieser Umstand macht ein systematisches Vorgehen bei der Kennzahlenbildung notwendig, welches auf eindeutigen Anforderungskriterien basiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziele und Vorgehensweise
- Grundlagen der kennzahlenorientierten Bilanzanalyse
- Begriffsdefinition
- Zielsetzung und Aufgaben der kennzahlenorientierten Bilanzanalyse
- Systematisierung von Bilanzkennzahlen
- Prozess der Kennzahlenbildung
- Vergleichsmaßstäbe und Grenzen von Kennzahlen
- Bewertungskriterien für die Auswahl von Kennzahlen
- Diskussion ausgewählter finanzwirtschaftlicher Kennzahlen
- Vermögenskennzahlen
- Anlageintensität
- Gesamtkapitalumschlag
- Kapitalstrukturkennzahlen
- Eigenkapitalquote
- Fremdkapitalquote
- Kennzahlen zur Liquiditäts- und Finanzkraft
- Deckungsgrad I (Goldene Bilanzregel)
- Liquiditätsgrad II – Quick Ratio
- Cashflow
- Vermögenskennzahlen
- Diskussion ausgewählter erfolgswirtschaftlicher Kennzahlen
- Wirtschaftlichkeit
- Rentabilitätskennzahlen
- Eigenkapitalrentabilität
- Gesamtkapitalrentabilität
- Zusammenfassung und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Auswahl, Diskussion und Bewertung von wichtigen Bilanzkennzahlen. Ziel ist es, ein systematisches Vorgehen bei der Kennzahlenbildung aufzuzeigen und die Bedeutung von Kennzahlen für die Unternehmensanalyse zu verdeutlichen.
- Grundlagen der kennzahlenorientierten Bilanzanalyse
- Systematisierung und Auswahl von Kennzahlen
- Bewertungskriterien für die Auswahl von Kennzahlen
- Diskussion ausgewählter finanzwirtschaftlicher Kennzahlen
- Diskussion ausgewählter erfolgswirtschaftlicher Kennzahlen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und die Ziele der Arbeit. Im Anschluss werden die Grundlagen der kennzahlenorientierten Bilanzanalyse erläutert, wobei die Zielsetzung und die Aufgaben dieser Analyseform im Fokus stehen. Des Weiteren werden die Systematisierung von Bilanzkennzahlen, der Prozess der Kennzahlenbildung und die Vergleichsmaßstäbe sowie die Grenzen von Kennzahlen diskutiert. Schließlich werden Kriterien für die Auswahl von Kennzahlen vorgestellt.
Im nächsten Kapitel werden ausgewählte finanzwirtschaftliche Kennzahlen näher betrachtet, wobei die Schwerpunkte auf Vermögenskennzahlen wie Anlageintensität und Gesamtkapitalumschlag, Kapitalstrukturkennzahlen wie Eigenkapitalquote und Fremdkapitalquote sowie Kennzahlen zur Liquiditäts- und Finanzkraft wie Deckungsgrad I, Liquiditätsgrad II und Cashflow liegen. Die Arbeit betrachtet ebenfalls ausgewählte erfolgswirtschaftliche Kennzahlen, wie Wirtschaftlichkeit, Eigenkapitalrentabilität und Gesamtkapitalrentabilität.
Schlüsselwörter
Bilanzanalyse, Kennzahlen, finanzwirtschaftliche Kennzahlen, erfolgswirtschaftliche Kennzahlen, Anlageintensität, Gesamtkapitalumschlag, Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquote, Deckungsgrad I, Liquiditätsgrad II, Cashflow, Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität.
- Quote paper
- Tobias Werner (Author), 2009, Kennzahlenorientierte Bilanzanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152786