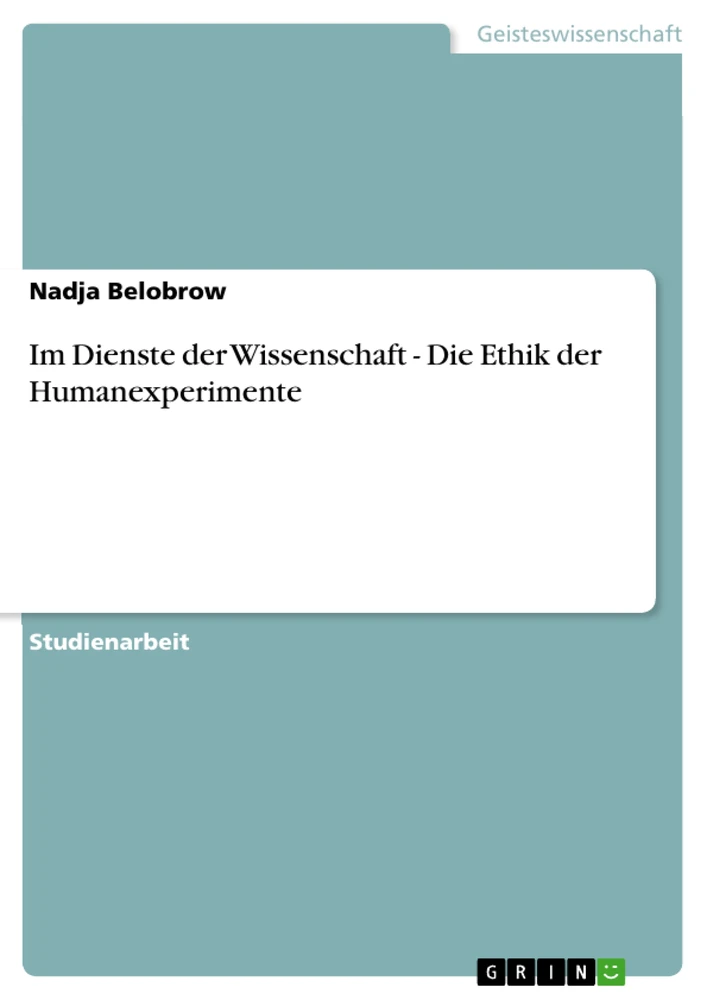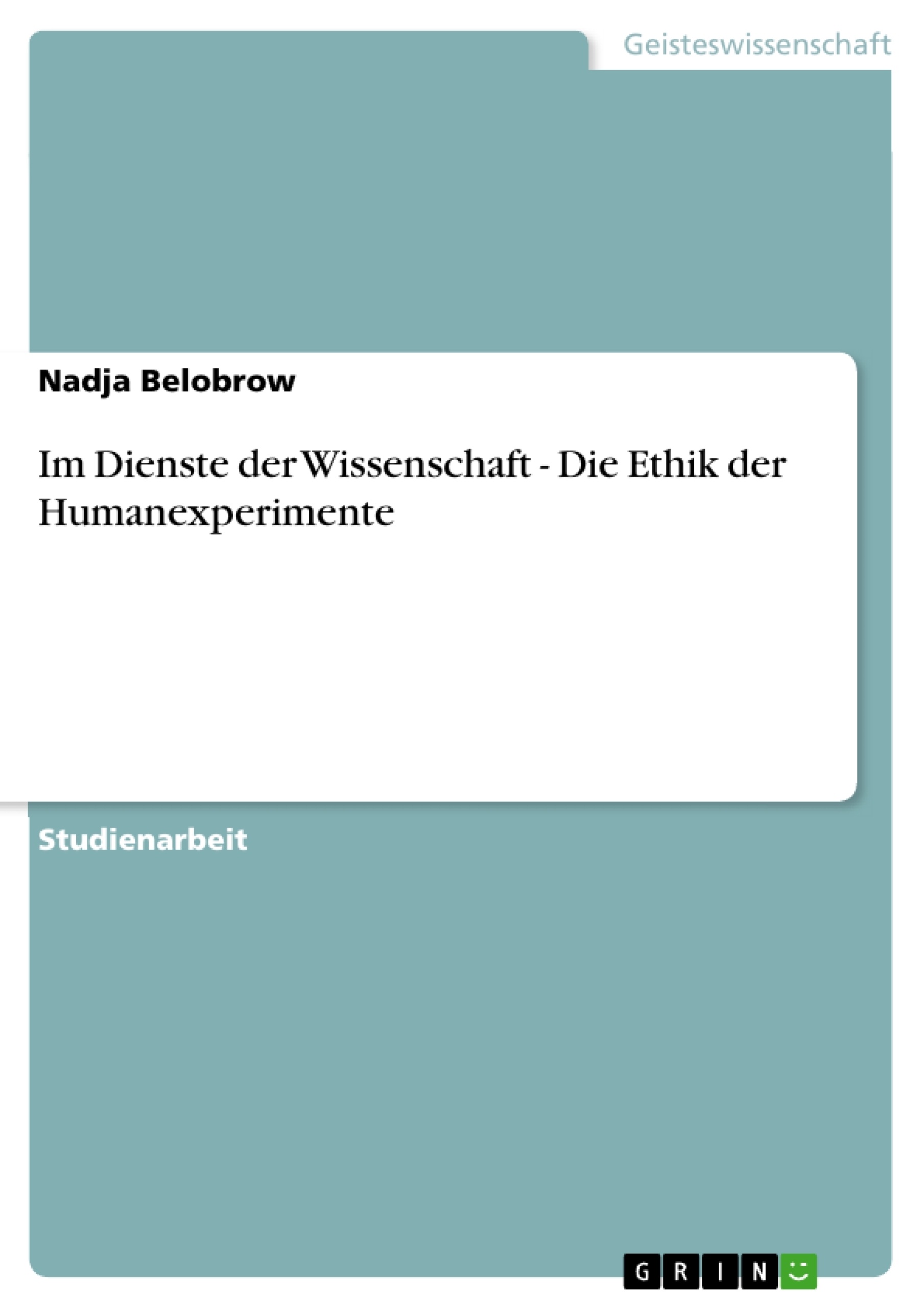„Forschung ist in der Medizin unverzichtbar. Ohne sie gibt es keinen Fortschritt; der Auftrag der Medizin erfordert stetigen Erkenntniszuwachs. Die Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft. […] Der Fortschritt der Medizin soll die Behandlungschancen berechenbarer machen, die immanenten Eingriffsrisiken reduzieren und neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Dieser Fortschritt vollzieht sich auf vielen Wegen. Wenn es aber darum geht, neue Erkenntnisse in die praktische Anwendung umzusetzen, führt kein Weg vorbei an der Erprobung am Menschen. Wer den Fortschritt der Medizin zum Wohle aller will, kann den Versuch am Menschen nicht mißbilligen“ (Kleinsorge/ Hirsch/ Weißauer (Hrsg.) 1985, Geleitwort). Doch wissenschaftliche Forschung unterliegt einem Legitimationszwang. „Längst gilt es nicht mehr als Fortschritt per se, wenn die Grenze des Machbaren wieder ein Stückchen weiter vorgeschoben wird“ (a.a.O., S. 1).
Der Versuch am Menschen unterliegt heute und unterlag auch in der Vergangenheit bestimmten Voraussetzungen und Regeln, ob technischer, gesellschaftlicher, rechtlicher oder moralischer Natur, auch wenn das Experiment einem übergeordneten Zweck dient und ein an sich erstrebenswertes Ziel verfolgt, wie etwa die Heilung oder Linderung bestimmter Krankheiten. Es gab aber auch Versuche, die nicht für, sondern gegen die Versuchspersonen unternommen wurden und die Verletzung oder Tötung zum Ziel hatten.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer Ethik der wissenschaftlichen Forschung, die den Menschen zum Objekt hat oder auch macht. Dazu wird zunächst eine Abgrenzung und Gegenstandsklärung vorgenommen sowie ein kurzer Überblick über die Geschichte des Menschenversuchs gegeben. Danach werden verschiedene Instrumente zur Beurteilung ethischer Fragen behandelt. Im nächsten Kapitel werden einige ethische Leitlinien der Forschung am Menschen aus der Geschichte dargestellt, um die Entwicklung solcher Leitlinien in einen historischen Kontext zu stellen. Ein Abschnitt der Arbeit befasst sich mit Beispielen wissenschaftlicher Experimente am Menschen aus unterschiedlichen Epochen. Es soll versucht werden, diese Beispiele und die ihnen zugrunde liegenden ethischen Leitlinien im jeweiligen historischen, sozialen oder gesellschaftlichen Kontext zu betrachten und darzustellen. Nach einer Zusammenfassung schließt die Arbeit mit einem Ausblick auf aktuelle ethische Kontroversen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung und Gegenstand - Die Geschichte des Menschenversuchs
- Instrumente ethischer Beurteilung
- Ethische Grundsätze
- Religionsethik
- Statistische Ethik
- Situationsethik
- Ethische Leitlinien der Forschung am Menschen
- Der Eid des Hippokrates
- Anweisung an die Vorsteher der Kliniken
- Richtlinien für neuartige Heilbehandlung und für die Vornahme wissenschaftlicher Versuche am Menschen
- Nürnberger Codex
- Deklaration von Helsinki
- Der Mensch als Forschungsobjekt - Beispiele
- Syphilis Impfexperimente und Tuskegee-Studie
- Vernichtung - Humanexperimente im Dritten Reich
- Rüstungsforschung – Humanexperimente im Kalten Krieg
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Ethik der wissenschaftlichen Forschung, die den Menschen zum Objekt macht. Dabei wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der Humanexperimente gegeben, verschiedene ethische Beurteilungsinstrumente erläutert und ethische Leitlinien der Forschung am Menschen dargestellt. Die Arbeit analysiert zudem Beispiele von Menschenversuchen aus unterschiedlichen Epochen und setzt diese in den jeweiligen historischen, sozialen und gesellschaftlichen Kontext.
- Geschichte und Entwicklung des Humanexperiments
- Ethische Beurteilungsinstrumente in der Forschung am Menschen
- Ethische Leitlinien und ihre historischen Entwicklung
- Beispiele für Menschenversuche aus verschiedenen Epochen
- Aktuelle ethische Kontroversen in der Forschung am Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung der medizinischen Forschung und die Notwendigkeit von Experimenten am Menschen. Sie betont jedoch auch den Legitimationszwang der Forschung, insbesondere im Hinblick auf die ethischen Aspekte von Humanexperimenten.
Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte des Menschenversuchs. Es wird die Entwicklung von der antiken Vivisektion über die methodische Regelung des Experiments im 16. Jahrhundert bis hin zu den ethischen Debatten im 20. Jahrhundert dargestellt.
In Kapitel 3 werden verschiedene Instrumente zur Beurteilung ethischer Fragen vorgestellt, wie beispielsweise ethische Grundsätze, Religionsethik, statistische Ethik und Situationsethik. Die Bedeutung des Kontextes für die ethische Bewertung von Situationen wird hervorgehoben.
Kapitel 4 stellt ethische Leitlinien der Forschung am Menschen aus der Geschichte vor, darunter der Eid des Hippokrates, die Anweisung an die Vorsteher der Kliniken, Richtlinien für neuartige Heilbehandlung, der Nürnberger Codex und die Deklaration von Helsinki.
Kapitel 5 beleuchtet Beispiele für wissenschaftliche Experimente am Menschen aus unterschiedlichen Epochen, wie die Syphilis Impfexperimente, die Tuskegee-Studie und die Humanexperimente im Dritten Reich und im Kalten Krieg. Die Arbeit untersucht die ethischen Aspekte dieser Experimente im jeweiligen historischen Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die ethischen Aspekte von Humanexperimenten. Die zentralen Begriffe sind daher Menschenversuch, Ethik, Forschung, Medizin, Geschichte, ethische Leitlinien, wissenschaftliche Experimente, Verantwortung, Patientenrechte, Informierte Einwilligung, Nürnberger Codex, Deklaration von Helsinki und aktuelle ethische Kontroversen.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Menschenversuche in der Medizin überhaupt notwendig?
Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft; um neue Heilmethoden sicher in die Praxis zu überführen, ist die Erprobung am Menschen für den Fortschritt oft unverzichtbar.
Was ist der Nürnberger Codex?
Eine zentrale ethische Richtlinie, die nach den Gräueltaten der NS-Medizin entstand und die freiwillige Einwilligung der Versuchsperson als oberstes Gebot festschreibt.
Welche historischen Negativbeispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Tuskegee-Syphilis-Studie, Menschenversuche im Dritten Reich und Rüstungsforschung während des Kalten Krieges.
Was unterscheidet die Deklaration von Helsinki vom Eid des Hippokrates?
Während der Eid des Hippokrates allgemeine ärztliche Pflichten festlegt, bietet die Deklaration von Helsinki spezifische ethische Standards für die klinische Forschung am Menschen.
Welche Instrumente dienen der ethischen Beurteilung?
Genannt werden unter anderem die Religionsethik, statistische Ethik (Abwägung von Nutzen und Risiko) und die Situationsethik.
- Arbeit zitieren
- Nadja Belobrow (Autor:in), 2010, Im Dienste der Wissenschaft - Die Ethik der Humanexperimente, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152815