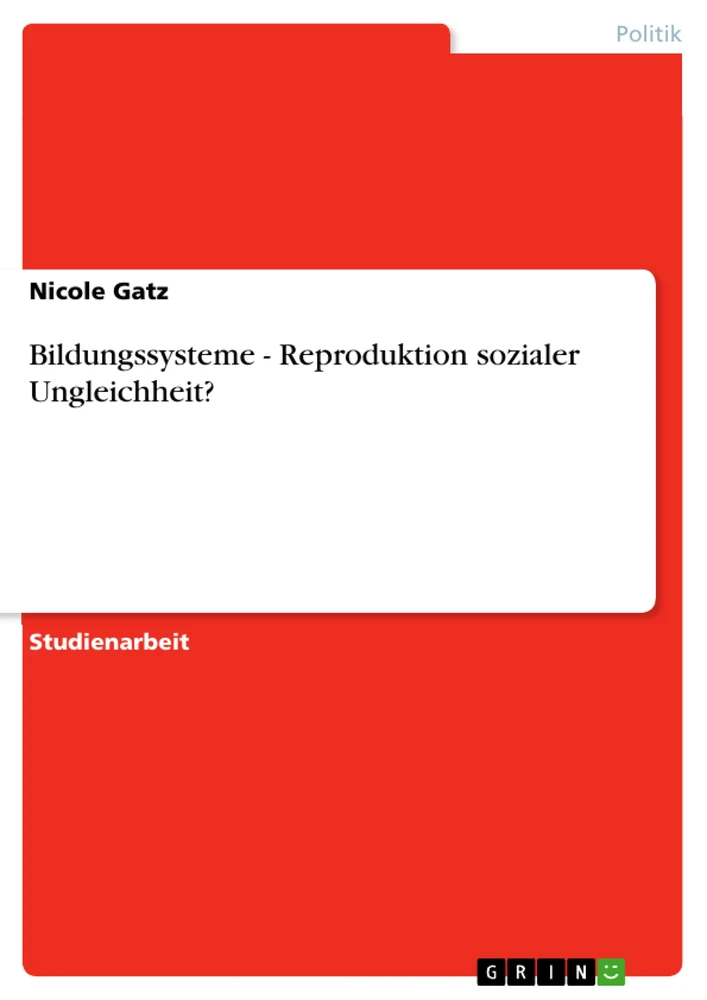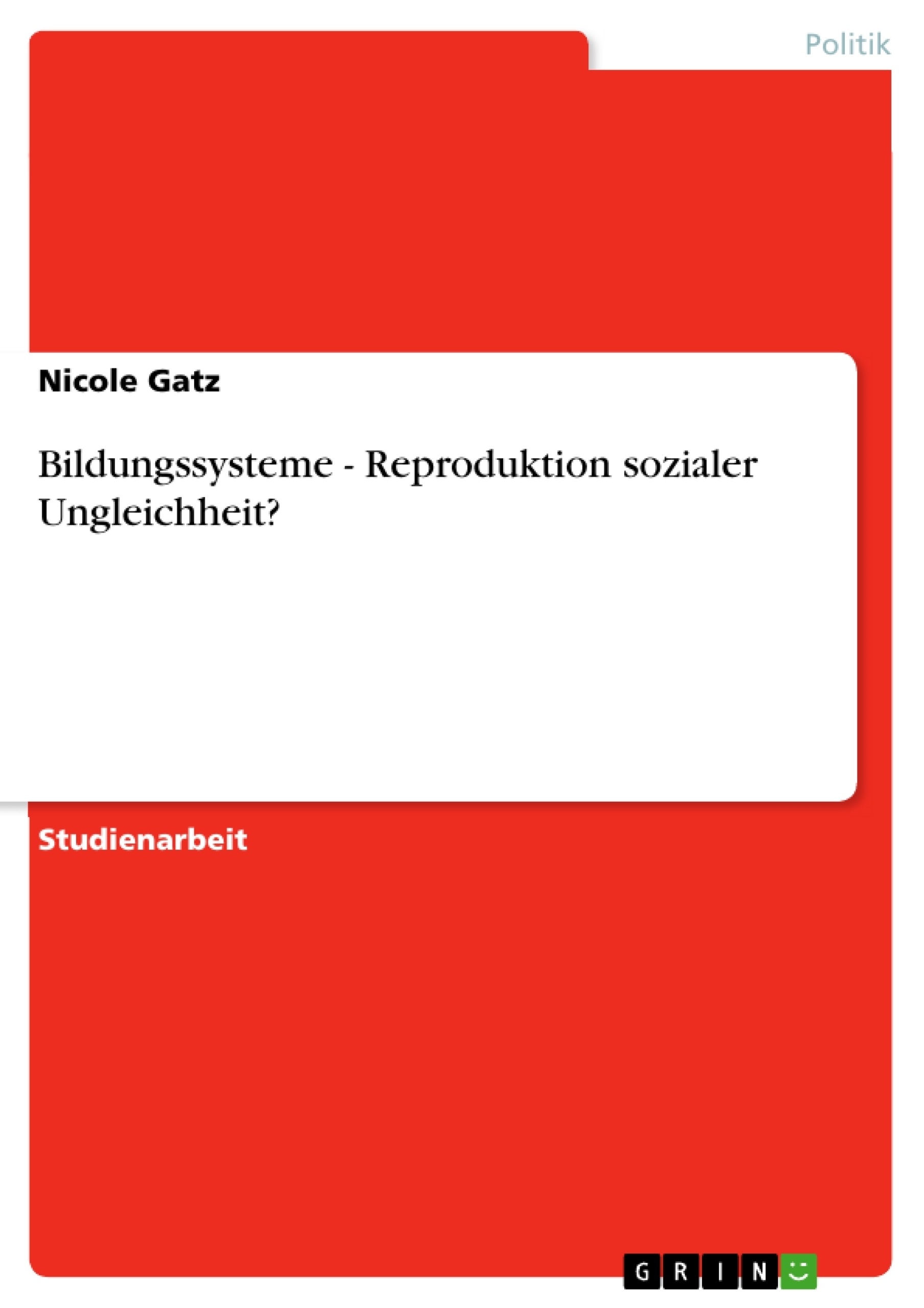Schwerwiegend erscheinen die Ergebnisse der PISA-Studien: Insbesondere in Deutschland zeigt sich ein sehr enger Zusammenhang zwischen der Herkunft aus einer spezifischen
sozialen Schicht und dem Bildungserfolg. So verfügen Schüler der unteren Gesellschaftsschicht über weniger Leistungskompetenz oder erreichen nur in geringer Anzahl höhere Schulabschlüsse oder gar überhaupt eine Mindestqualifikation. Ein weiteres Ergebnis
ist die eindeutige Verteilung von Schülern verschiedener sozialer Herkunft auf verschiedene Schulformen.
Bereits im Frankreich der 60er Jahre wurde dieser Zusammenhang thematisiert. Pierre Bourdieu beschäftigte sich in seiner Bildungsforschung vorrangig mit der sozial bedingten
Chancenungleichheit und Unterschieden in der Bildungsbeteiligung.
Doch was sind die Ursachen der ungleichen Bildungserfolge? Inwiefern determiniert die soziale Herkunft die schulische und berufliche Laufbahn? Welche Rolle spielen Bildungseinrichtungen und gelingt es ihnen die sozialen Determinanten zu berücksichtigen
und Chancengleichheit zu gewährleisten? Trifft Bourdieus Aussage, über die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch schulische Institutionen zu?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
- Das Modell des sozialen Raums
- Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital
- Soziale Herkunft als Faktor der Bildungsungleichheit
- Auswahl der Auserwählten - Pierre Bourdieu über ungleiche Bildungschancen
- Institutionelle Segregation im deutschen Bildungssystem
- Grundstruktur des deutschen Bildungssystems
- Ergebnisse der PISA-Forschung
- Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern das deutsche Bildungssystem zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beiträgt. Dabei werden die Theorien Pierre Bourdieus zur sozialen Ungleichheit und zur Entstehung von Bildungsungleichheit herangezogen und auf das deutsche Bildungssystem angewandt.
- Pierre Bourdieus Modell des sozialen Raums und die verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital)
- Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Die Rolle von Bildungseinrichtungen bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Die Ergebnisse der PISA-Studien im Hinblick auf die Bildungsungleichheit in Deutschland
- Die Frage, ob und wie das Bildungssystem die sozialen Determinanten des Bildungserfolgs berücksichtigen kann und Chancengleichheit gewährleisten kann
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik der Bildungsungleichheit dar und bezieht sich auf die Ergebnisse der PISA-Studien. Sie führt die zentralen Fragen ein, die in der Arbeit behandelt werden, und stellt Pierre Bourdieu als zentralen Bezugspunkt für die Analyse vor.
- Soziale Ungleichheit nach Pierre Bourdieu: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Modell des sozialen Raums von Pierre Bourdieu. Es wird erläutert, wie Bourdieu die Gesellschaft in verschiedene Klassen einteilt und die Bedeutung von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital für die soziale Positionierung herausarbeitet.
- Soziale Herkunft als Faktor der Bildungsungleichheit: Dieses Kapitel widmet sich der Frage, wie die soziale Herkunft die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Es wird die Argumentation Bourdieus dargestellt, der die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem beschreibt.
- Institutionelle Segregation im deutschen Bildungssystem: Hier werden die Grundstruktur des deutschen Bildungssystems und die Ergebnisse der PISA-Studien näher beleuchtet. Es wird untersucht, wie die institutionelle Segregation im Bildungssystem die Bildungsungleichheit verstärkt und wie sie sich auf die Ergebnisse der PISA-Studien niederschlägt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie soziale Ungleichheit, Bildung, Reproduktion sozialer Ungleichheit, Pierre Bourdieu, sozialer Raum, Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital), Bildungschancen, Bildungssystem, PISA-Studien, Institutionelle Segregation.
- Arbeit zitieren
- Nicole Gatz (Autor:in), 2009, Bildungssysteme - Reproduktion sozialer Ungleichheit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152939