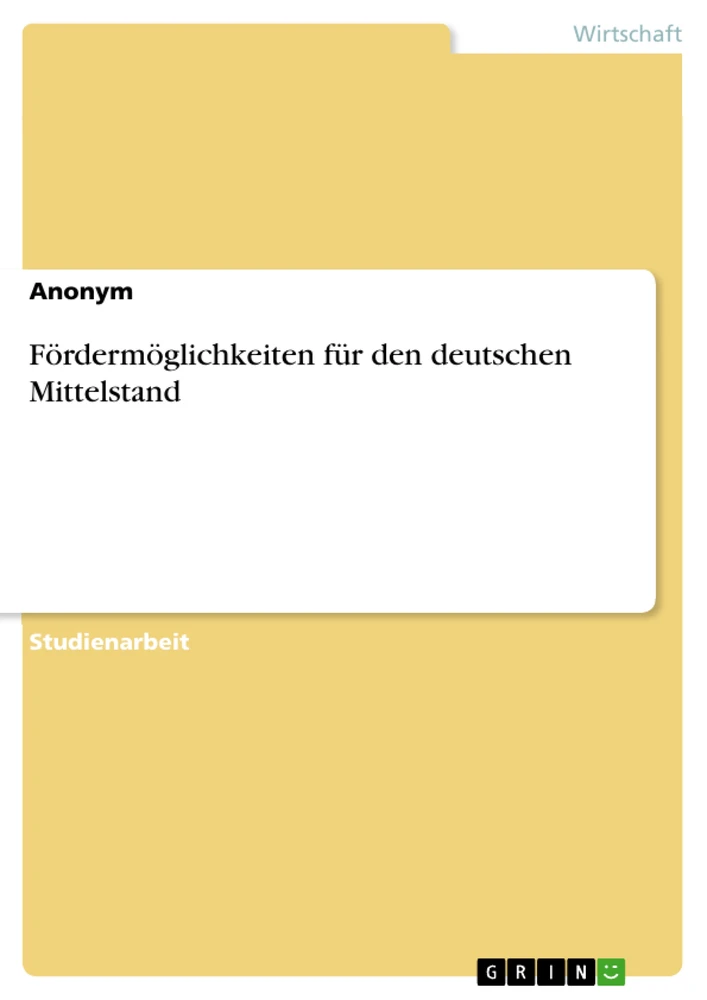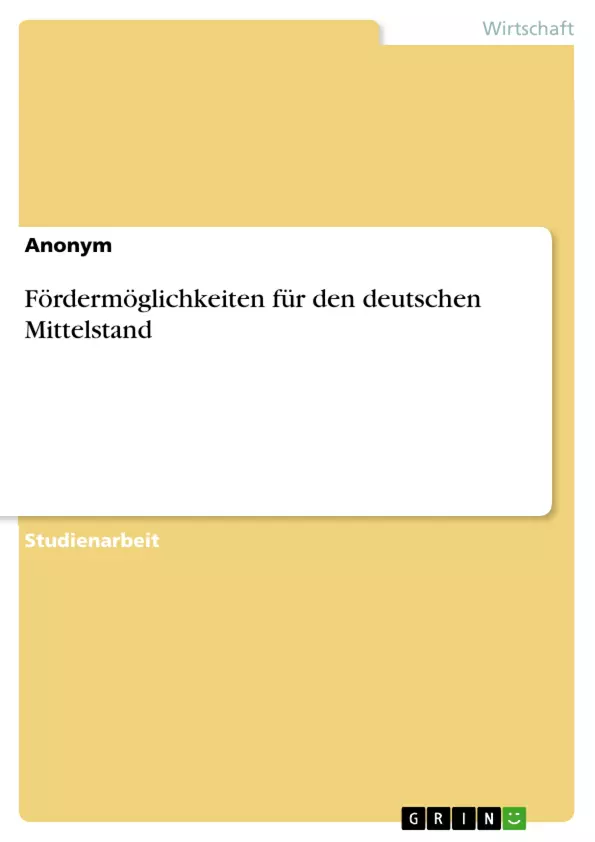In unserer Volkswirtschaft bildet der Mittelstand das stabile Fundament. Er ist ein Garant für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Aus Statistiken geht hervor, dass fast alle Betriebe in Deutschland zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen gehören. Lediglich 0,3 Prozent von insgesamt etwa 3,6 Millionen Betrieben beträgt der Anteil der Großunternehmen. Hierzulande sind über 70 Prozent aller Beschäftigten in kleinen und mittleren Betrieben tätig1. Besonders diese Unternehmen stehen für Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit. Die Stärken liegen darin, dass sie ihre Ideen schnell in marktfähige Produkte umsetzen, dass sie über einen hohen Grad an Spezialisierung verfügen sowie über die Fähigkeit, auch kleinste Nischen auf dem Markt zu besetzen. Der Mittelstand sorgt für das wirtschaftliche Wachstum, Fortschritt, Wohlstand und die damit verbundene Sicherheit. Die mittelständischen Unternehmen sind zumeist inhabergeführt. Deren persönlichem Engagement ist es zu verdanken, dass immer wieder neue Unternehmen gegründet werden und oft über viele Generationen bestehen bleiben. Oft beteiligen sie sich mit ihrem privaten Vermögen an der eigenen Unternehmung und tragen dadurch im persönlichen Bereich das unternehmerische Risiko für Fehlentscheidungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gründungsförderung
- BMWi-Existenzgründungsportal
- EXIST-Gründerstipendium
- „nexxt“ Initiative Unternehmensnachfolge
- KfW-Mittelstandsbank
- KfW-StartGeld
- KfW-Unternehmerkredit
- KfW-Sonderprogramm 2009
- ERP-Kapital für Gründung
- Der Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit
- BMWi-Existenzgründungsportal
- Innovationsförderung
- BMWi - Innovationsförderung
- EXIST-Gründerstipendium
- EXIST-Forschungstransfer
- Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
- Fördermodul Kooperationsprojekte (ZIM-KOOP)
- Fördermodul Einzelprojekte (ZIM-SOLO)
- Fördermodul Netzwerkprojekte (ZIM-NEMO)
- High-Tech Gründerfonds
- BMBF/KMU-innovativ
- KfW-Mittelstandsbank
- ERP-Startfonds
- ERP-Innovationsprogramm
- BMWi - Innovationsförderung
- Die Absatzförderung
- BMWi-Vermarktungshilfeprogramm
- BMWi-Auslandsmesseprogramm
- KfW-Mittelstandsbank
- ERP-Regionalförderprogramm
- ERP-Exportfinanzierungsprogramm
- Der ERP-Startfonds
- Der KfW-Unternehmerkredit
- SIGNO Unternehmen - InnovationMarket/Verwertungsaktion
- AKA-Exportfinanzierungskredite
- Beschäftigungsförderung
- KfW-Kapital für Arbeit und Investitionen
- Job Perspektive
- Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit
- Einstellungszuschüsse bei Neugründungen und Vertretung
- Das Bundesprogramm „Perspektive 50plus“
- Das Arbeitsmarktprogramm „„Job4000“
- Die Ausbildungsförderung
- Die Einstiegsqualifizierung Jugendlicher
- Der Ausbildungsbonus
- Das Arbeitsmarktprogramm „Job4000“
- Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten
- JOBSTARTER
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf verschiedenen Förderprogrammen, die von Bundesministerien, Kreditinstituten und anderen Organisationen angeboten werden. Ziel des Textes ist es, einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Förderung für KMU in den Bereichen Gründung, Innovation, Absatzförderung, Beschäftigung und Ausbildung zu geben.
- Gründungsförderung für Unternehmerinnen und Unternehmer
- Förderprogramme für Innovation und Technologie
- Absatzförderung und Unterstützung bei der internationalen Expansion
- Beschäftigungsförderung und Unterstützung bei der Rekrutierung von Arbeitskräften
- Förderung der Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung des Mittelstands für die deutsche Wirtschaft hervorhebt. Anschließend werden verschiedene Förderprogramme im Detail vorgestellt, beginnend mit der Gründungsförderung, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) angeboten wird. Im Anschluss werden Förderprogramme für Innovationen und die Absatzförderung erläutert. Der Text schließt mit einer Darstellung der Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in diesem Text sind: Gründungsförderung, Innovationsförderung, Absatzförderung, Beschäftigungsförderung, Ausbildungsförderung, KMU, Mittelstand, BMWi, KfW, Bundesagentur für Arbeit, ERP-Programm.
Häufig gestellte Fragen
Welche Institutionen fördern Existenzgründer in Deutschland?
Wichtige Förderer sind das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) über Programme wie EXIST, die KfW-Mittelstandsbank und die Bundesagentur für Arbeit mit dem Gründungszuschuss.
Was ist das ZIM-Programm?
Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ist ein Förderprogramm des BMWi, das marktorientierte technologische Forschungs- und Entwicklungsprojekte in KMU unterstützt.
Gibt es spezielle Kredite für mittelständische Unternehmen?
Ja, die KfW bietet beispielsweise den Unternehmerkredit oder das StartGeld an, die oft günstigere Zinsen und Haftungsfreistellungen beinhalten.
Wie wird die Ausbildung im Mittelstand gefördert?
Durch Programme wie JOBSTARTER oder den Ausbildungsbonus sowie die Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten werden Betriebe bei der Ausbildung unterstützt.
Was ist der ERP-Startfonds?
Der ERP-Startfonds stellt Beteiligungskapital für junge, technologieorientierte Unternehmen bereit, um deren Eigenkapitalbasis für Forschung und Entwicklung zu stärken.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2009, Fördermöglichkeiten für den deutschen Mittelstand, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152991