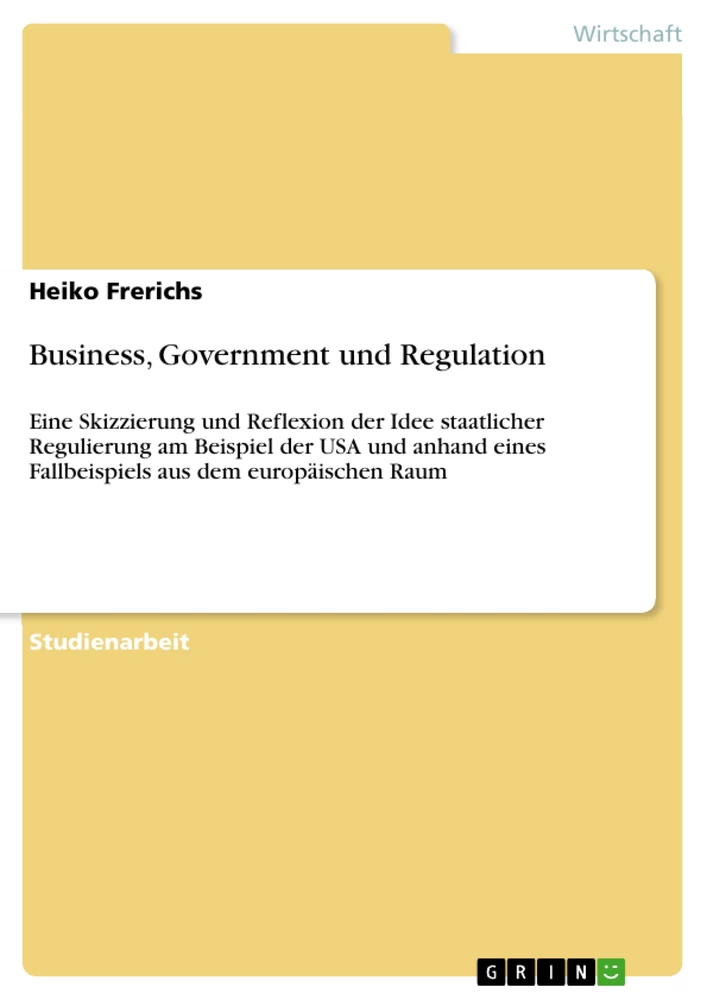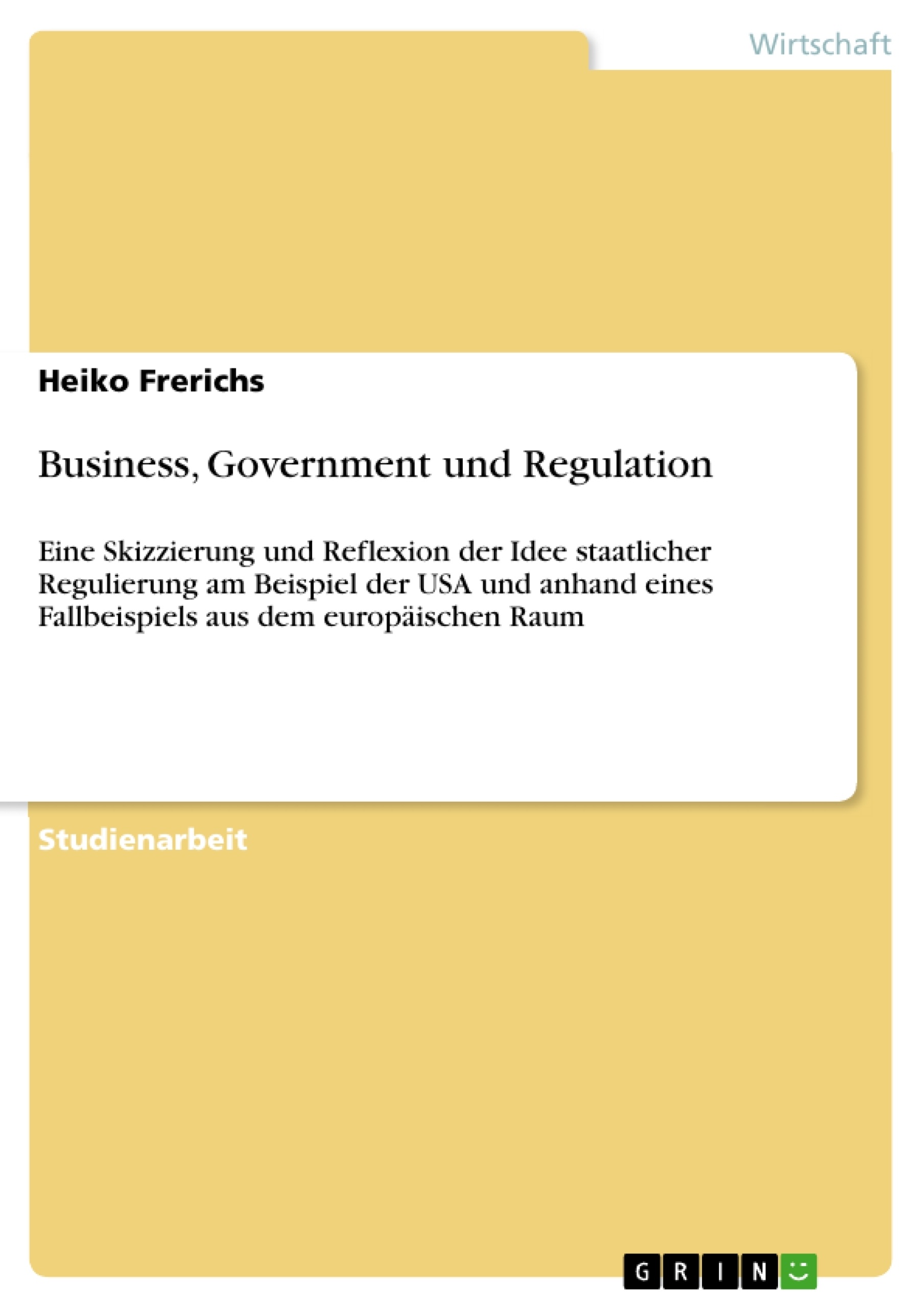Die vorliegende Arbeit intendiert, die wesentlichen Inhalte des Kapitels 10: „Business, Government and Regulation“ aus dem Werk “Business & Society: Ethics and Stakeholder Management“ von CARROLL & BUCHHOLTZ (2006) darzulegen und darüber hinaus gehende Überlegungen und Bewertungen vorzunehmen, die im Zusammenhang mit dieser Thematik auftreten. Dies umfasst die Rollenverständnisse von Staat und Wirtschaft ebenso wie die vielschichtigen Beziehungen zwischen Ihnen und mit der Gesellschaft als Ganzes. Da sich wie bereits erwähnt, die Basisliteratur primär auf den amerikanischen Kontext bezieht, werden die Darstellungen an manchen Stellen durch zusätzliche Literatur und Perspektiven ergänzt, um ein umfassenderes Bild zu erhalten.
Am Ende steht dann ein Praxisfall, welcher sich explizit auf den europäischen Raum, insbesondere Deutschland bezieht. In der Darstellung und Erörterung des Falls wird es um das kontrovers diskutierte „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) gehen, - besser bekannt unter dem alten Namen „Antidiskriminierungsgesetz“ (ADG), welches zum 01. August 2006 in Kraft treten soll. Der Fokus wird in diesem Zusammenhang auf der Frage nach dem Sinn und Unsinn und den Implikationen dieses neuen Gesetzes liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zieldefinition dieser Arbeit
- Die Rolle des Staates und der Wirtschaft
- Definition von "regulation"
- Skizzierung der historischen Entwicklung staatlicher Regulierung in den USA
- Back to the roots - die Anfänge staatlicher Intervention
- Die wesentlichen Entwicklungen im 20. Jahrhundert
- Die Stakeholder und Ihr Verhältnis zueinander
- Die Beziehung von Staat und Wirtschaft
- Die Beziehung von Staat und Gesellschaft
- Privatisierung – die ewige Kontroverse
- Die Gründe für staatliche Regulierung und Intervention
- Der Praxisfall: Das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ und seine möglichen Implikationen für Wirtschaft und Gesellschaft
- Hintergrund
- Ziel des ,,Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“ (AGG)
- Die Argumente der Befürworter
- Befürchtungen der Wirtschaft
- Integration der Meinungen - Versuch einer holistischen Sicht
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der staatlichen Regulierung im Kontext des Verhältnisses von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie analysiert die Rolle des Staates und der Wirtschaft in modernen Gesellschaften, wobei der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten liegt, und beleuchtet die historischen Entwicklungen sowie aktuelle Herausforderungen der Regulierung. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Perspektiven von Stakeholdern, insbesondere die Interaktion zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, und erörtert die Gründe für staatliche Interventionen. Als Praxisbeispiel dient das "Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz" (AGG) in Deutschland, welches in der Arbeit hinsichtlich seiner möglichen Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert wird.
- Die Rolle des Staates und der Wirtschaft in modernen Gesellschaften
- Die historische Entwicklung staatlicher Regulierung in den USA
- Die Beziehung zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
- Die Gründe für staatliche Regulierung und Intervention
- Die Auswirkungen des "Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes" (AGG) auf die Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung der Arbeit legt die Ziele und den Rahmen der Untersuchung fest. Sie definiert den Begriff "Regulierung" und analysiert die Rollen des Staates und der Wirtschaft in der Gesellschaft. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung staatlicher Regulierung in den USA, angefangen von den Anfängen bis hin zu den wesentlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Kapitel 3 befasst sich mit den verschiedenen Stakeholdern und ihren Beziehungen zueinander, insbesondere der Beziehung zwischen Staat und Wirtschaft sowie der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Das Kapitel behandelt auch die Kontroverse um Privatisierung. Kapitel 4 analysiert die Gründe für staatliche Regulierung und Intervention. Das Praxisbeispiel in Kapitel 5 erörtert das "Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz" (AGG) in Deutschland und untersucht seine möglichen Implikationen für die Wirtschaft und Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen staatliche Regulierung, Wirtschaft und Gesellschaft, Stakeholder, historische Entwicklung, Privatisierung, das "Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz" (AGG), sowie die Rolle des Staates und der Wirtschaft in modernen Gesellschaften. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Perspektiven und Argumente im Zusammenhang mit staatlicher Regulierung und Intervention, sowohl in den USA als auch in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Kapitel „Business, Government and Regulation“?
Es befasst sich mit den Rollenverständnissen und den vielschichtigen Beziehungen zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, basierend auf dem Werk von Carroll & Buchholtz.
Was ist das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG)?
Das AGG (früher Antidiskriminierungsgesetz) trat 2006 in Kraft und zielt darauf ab, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung zu verhindern.
Warum ist staatliche Regulierung in der Wirtschaft notwendig?
Die Arbeit erörtert verschiedene Gründe für staatliche Interventionen, um ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und gesellschaftlichem Wohl zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Privatisierung in diesem Kontext?
Die Arbeit beleuchtet die „ewige Kontroverse“ um Privatisierung und wie sich dadurch die Verantwortlichkeiten zwischen Staat und Wirtschaft verschieben.
Wie unterscheidet sich die Regulierung in den USA von der in Europa?
Obwohl die Basisliteratur US-zentriert ist, ergänzt die Arbeit Perspektiven auf den europäischen Raum, insbesondere durch den Praxisfall zum deutschen AGG.
- Quote paper
- Heiko Frerichs (Author), 2006, Business, Government und Regulation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153002