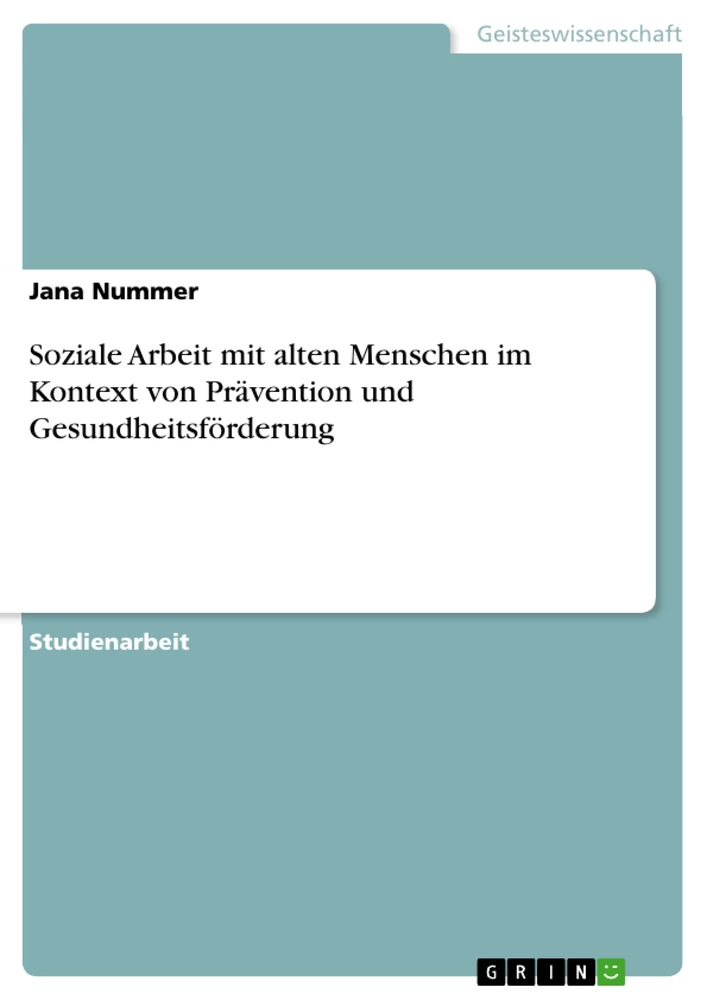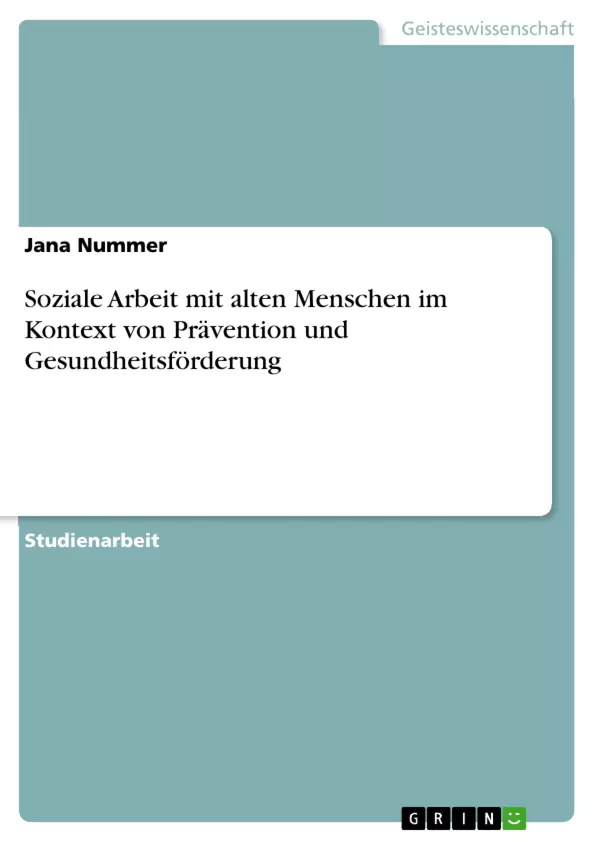Gesund und krank, subjektive Wahrnehmung und objektive Einschätzung, chronisch krank oder periodisch gesund sind nicht immer eindeutig voneinander zu trennen, weil Zeichen von Gesundheit (G) und Krankheit (K) in einem Menschen koexistieren kön-nen. Daher ist G ein dynamisches Gleichgewicht, mit fließenden Übergängen zur K. Es gibt viele dargestellte Überlegungen zu Vorsorge und Altersmedizin, aber ihre Grund-lage bildet ein wieder entdecktes, ganzheitliches Bild von G und K. Die Weltgesund-heitsorganisation (WHO) definiert G 1946 als einen „Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit“. Heute sieht die WHO Gesundheit als einen „positiven funktionellen Gesamtzustand im Sinne eines dynamischen biopsychologischen Gleichgewichtszustandes, der erhalten bzw. immer wieder hergestellt werden muss“. [...] Zunächst wird die Lebenssituation älterer Menschen beleuchtet, um einen umfassenden Überblick zu gewährleisten. Welche Herausforderungen und Aufgaben sich daraus für die SA ergeben, wird im folgenden Kapitel erläutert. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den sozialen Handlungsfeldern im Schnittfeld von SA und G, die es sinnvoll erscheinen lassen, im nächsten Kapitel die Begriffe P und GF zu erläutern. Weiterhin verdeutlicht das Präventionsprojekt „Aktive Gesundheitsförderung im Alter“ für Senio-ren das Zusammenspiel der Begriffe G, K, GF und P. Zuletzt erfolgt ein Resümee aus dieser Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Alte Menschen und ihre Lebenssituation
- 3 Herausforderungen für die Soziale Arbeit
- 4 Handlungsfelder im Schnittfeld Sozialer Arbeit und Gesundheit
- 5 Die Begriffe der Prävention und Gesundheitsförderung
- 6 Das Projekt „Aktive Gesundheitsförderung im Alter“
- 7 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Soziale Arbeit mit alten Menschen im Kontext von Prävention und Gesundheitsförderung. Sie beleuchtet die Lebenssituation älterer Menschen, die daraus resultierenden Herausforderungen für die Soziale Arbeit und relevante Handlungsfelder im Schnittfeld von Sozialer Arbeit und Gesundheit. Die Arbeit analysiert zudem die Konzepte von Prävention und Gesundheitsförderung und illustriert diese anhand eines konkreten Projekts.
- Die Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland
- Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Umgang mit alternden Gesellschaft
- Schnittmengen und Handlungsfelder von Sozialer Arbeit und Gesundheitswesen
- Konzepte der Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext der Altenpflege
- Beispiele für erfolgreiche Projekte zur aktiven Gesundheitsförderung im Alter
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Soziale Arbeit mit alten Menschen im Kontext von Prävention und Gesundheitsförderung ein. Sie thematisiert die Ambivalenz von Gesundheit und Krankheit und die Definition von Gesundheit nach WHO, betonen die Notwendigkeit ganzheitlicher Betrachtungsweisen. Die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext der alternden Bevölkerung wird hervorgehoben, wobei die Arbeit die verschiedenen Dimensionen menschlicher Existenz im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit beleuchtet. Der dynamische Charakter von Gesundheit und die Notwendigkeit umfassender Rahmenorientierungen für die Soziale Arbeit werden betont.
2 Alte Menschen und ihre Lebenssituation: Dieses Kapitel analysiert die demografische Entwicklung Deutschlands, insbesondere den zunehmenden Anteil älterer Menschen und den damit verbundenen Herausforderungen. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Alter und Krankheitshäufigkeit, wobei der Rückgang der Krankheitsprävalenz bei über 75-Jährigen zwischen 1978 und 1999 erwähnt wird, ohne die genauen Gründe hierfür zu benennen. Die Analyse der demografischen Daten verdeutlicht die Notwendigkeit angepasster Strategien im Gesundheits- und Sozialwesen.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, ältere Menschen, Prävention, Gesundheitsförderung, demografischer Wandel, Alterungsprozess, Gesundheit, Krankheit, Handlungsfeld, Intervention, Aktive Gesundheitsförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziale Arbeit mit alten Menschen im Kontext von Prävention und Gesundheitsförderung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Soziale Arbeit mit alten Menschen unter dem Aspekt von Prävention und Gesundheitsförderung. Sie beleuchtet die Lebenssituation älterer Menschen, die Herausforderungen für die Soziale Arbeit und relevante Handlungsfelder im Schnittpunkt von Sozialer Arbeit und Gesundheit. Die Arbeit analysiert Konzepte der Prävention und Gesundheitsförderung und illustriert diese anhand eines konkreten Projekts. Sie umfasst eine Einleitung, eine Beschreibung der Lebenssituation älterer Menschen, die Herausforderungen für die Soziale Arbeit, Handlungsfelder im Schnittfeld Soziale Arbeit und Gesundheit, die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung, ein konkretes Projektbeispiel und ein Resümee.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland, die Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Umgang mit einer alternden Gesellschaft, Schnittmengen und Handlungsfelder von Sozialer Arbeit und Gesundheitswesen, Konzepte der Prävention und Gesundheitsförderung in der Altenpflege und Beispiele für erfolgreiche Projekte zur aktiven Gesundheitsförderung im Alter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Alte Menschen und ihre Lebenssituation, Herausforderungen für die Soziale Arbeit, Handlungsfelder im Schnittfeld Soziale Arbeit und Gesundheit, Die Begriffe der Prävention und Gesundheitsförderung, Das Projekt „Aktive Gesundheitsförderung im Alter“ und Resümee.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, thematisiert die Ambivalenz von Gesundheit und Krankheit, die Definition von Gesundheit nach WHO und betont die Notwendigkeit ganzheitlicher Betrachtungsweisen. Die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext der alternden Bevölkerung wird hervorgehoben, wobei verschiedene Dimensionen menschlicher Existenz im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit beleuchtet werden. Der dynamische Charakter von Gesundheit und die Notwendigkeit umfassender Rahmenorientierungen für die Soziale Arbeit werden betont.
Was wird im Kapitel „Alte Menschen und ihre Lebenssituation“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die demografische Entwicklung Deutschlands, den zunehmenden Anteil älterer Menschen und die damit verbundenen Herausforderungen. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen Alter und Krankheitshäufigkeit und erwähnt den Rückgang der Krankheitsprävalenz bei über 75-Jährigen zwischen 1978 und 1999, ohne die genauen Gründe zu benennen. Die Analyse der demografischen Daten verdeutlicht die Notwendigkeit angepasster Strategien im Gesundheits- und Sozialwesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Soziale Arbeit, ältere Menschen, Prävention, Gesundheitsförderung, demografischer Wandel, Alterungsprozess, Gesundheit, Krankheit, Handlungsfeld, Intervention, Aktive Gesundheitsförderung.
Gibt es ein konkretes Projektbeispiel?
Ja, die Arbeit beschreibt und analysiert ein konkretes Projekt namens „Aktive Gesundheitsförderung im Alter“, um die Konzepte der Prävention und Gesundheitsförderung zu illustrieren.
- Citar trabajo
- Jana Nummer (Autor), 2007, Soziale Arbeit mit alten Menschen im Kontext von Prävention und Gesundheitsförderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153156