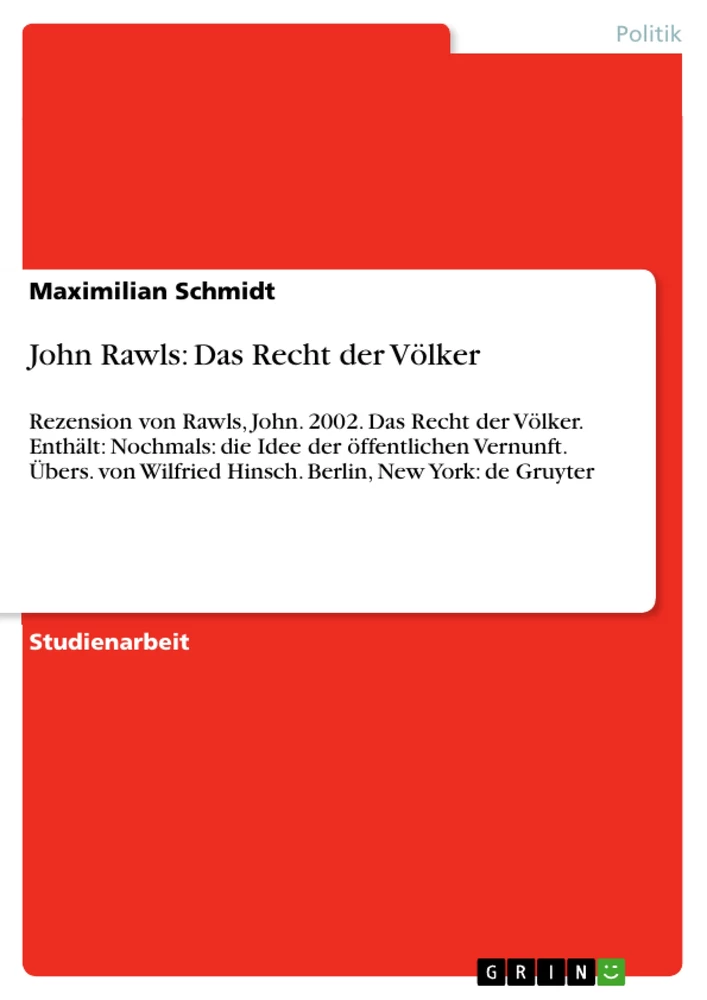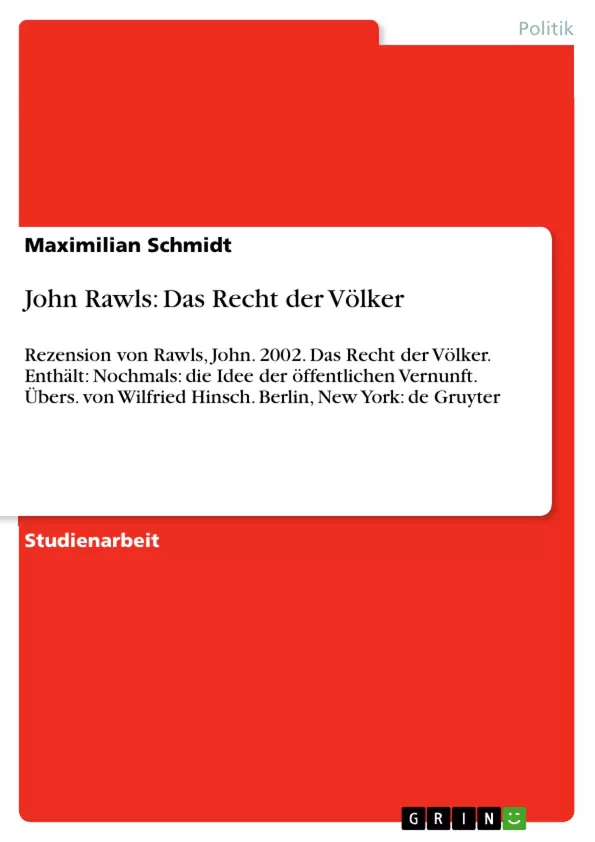„We can acknowledge that oppression will always be with us, and still strive for justice. We can admit the intractability of depravation, and still strive for dignity. Clear-eyed, we can understand that there will be war, and still strive for peace.“
Mit diesem Bekenntnis zu Gerechtigkeit und Frieden beendete Barack Obama seine Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises im Dezember 2009 in Oslo. Die Eckpunkte der Osloer Rede von Obama finden sich vor allem in einem Werk wieder, dessen Autor keine Gelegenheit mehr hatte, den neuen US-Präsidenten zu erleben und zu kommentieren: Der Philosoph John Rawls ist 2002 verstorben – aber die zentralen Botschaften des dritten Teils seiner Gerechtigkeitstrilogie, „The Law of Peoples“, schimmerten in Obamas Rede deutlich durch. „Die politische Philosophie ist realistisch-utopisch, wenn sie die Grenzen dessen, was wir gewöhnlich für praktisch-politisch möglich halten, ausdehnt“ – es scheint gerade so, als ob Obama mit seiner Rede die von Rawls philosophisch „ausgedehnte Grenze“ politisch ausgefüllt hat. Diese Verknüpfung wurde bereits Mitte 2009 vom amerikanischen Historiker Jeremy Young hergestellt: „That has never been more true than today, when our President has, consciously or unconsciously, exalted Rawlsian ideas to the position of the greatest possible good.“ Die vorliegende Arbeit hat eben den dritten Teil von Rawls’ Hauptwerk zum Gegenstand: „Das Recht der Völker“ ist angesichts der heutigen Weltlage hochaktuell. Zum einen sollen Inhalt und Argumentationsgang des Rechts der Völker dargestellt werden – deswegen folgt dieser Einleitung (I) eine Analyse der Argumentation (II) im rezensierten Werk. Der Anspruch jeder Theorie ist die Validität – daher schließt sich eine Kontextualisierung des Werkes hinsichtlich der aktuellen wissenschaftlichen Debatte in den internationalen Beziehungen (III) an. In diesem Zusammenhang endet die Arbeit mit dem Versuch einer Diskussion zur Frage, ob Rawls’ Idee eines Rechts der Völker eine umfassende, aktuelle und vor allem anwendbare Konzeption bietet und welche theoretischen Leerstellen sich angesichts der aktuellen Weltpolitik ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Argumentationsverlauf in Rawls' „Das Recht der Völker“
- Grundannahmen
- Der erste Teil der Idealtheorie
- Der zweite Teil der Idealtheorie
- Nichtideale Theorie
- Ausblick und Grenzen der Konzeption
- „Globalizing Rawls“: Das Recht der Völker als Beitrag in der Debatte in den internationalen Beziehungen
- Realismus versus Idealismus und das Recht der Völker
- Anwendungsprobleme, Leerstellen und offene Fragen beim Recht der Völker
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit John Rawls' „Das Recht der Völker“, dem dritten Teil seiner Gerechtigkeitstrilogie. Ziel ist es, den Inhalt und Argumentationsgang des Werkes darzustellen, sowie seine Bedeutung im Kontext der wissenschaftlichen Debatte in den internationalen Beziehungen zu beleuchten.
- Rawls' Idealtheorie des Rechts der Völker
- Die Anwendung von Rawls' Konzeption auf aktuelle Probleme der Weltpolitik
- Die Diskussion um Realismus und Idealismus in den internationalen Beziehungen
- Die Relevanz von Normen und Institutionen in einer globalisierten Welt
- Die Frage der Gerechtfertiung von Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Rawls' Werk „Das Recht der Völker“ in den Kontext der aktuellen Weltlage und erläutert den utopisch-realistischen Ansatz von Rawls, der eine gerechte und friedliche Weltordnung zum Ziel hat.
- Argumentationsverlauf in Rawls' „Das Recht der Völker“: Dieser Abschnitt analysiert die wichtigsten Punkte des Werkes, darunter die Grundannahmen, die Idealtheorie sowie die nichtideale Theorie.
- „Globalizing Rawls“: Das Recht der Völker als Beitrag in der Debatte in den internationalen Beziehungen: Dieser Teil behandelt die Relevanz von Rawls' Werk für die aktuelle Debatte in den internationalen Beziehungen. Hier werden die Positionen von Realismus und Idealismus im Kontext von Rawls' Konzeption des Rechts der Völker beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die zentralen Themen und Konzepte von John Rawls' „Das Recht der Völker“, insbesondere auf Gerechtigkeit, Frieden, Recht, Völkerrecht, Idealtheorie, Nichtideale Theorie, Realismus, Idealismus, internationale Beziehungen, Normen, Institutionen und Krieg.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht John Rawls unter dem "Recht der Völker"?
Es ist eine Erweiterung seiner Gerechtigkeitstheorie auf die internationale Ebene, die eine gerechte und friedliche Weltordnung zwischen liberalen und achtbaren Völkern anstrebt.
Was bedeutet "realistisch-utopisch" in Rawls' Philosophie?
Es bedeutet, die Grenzen dessen, was politisch möglich ist, auszudehnen, während man gleichzeitig die realen Bedingungen der menschlichen Gesellschaft berücksichtigt.
Was ist der Unterschied zwischen Idealtheorie und nichtidealer Theorie?
Die Idealtheorie beschreibt eine Welt wohlgeordneter Völker, während die nichtideale Theorie den Umgang mit "unrechtmäßigen Staaten" und "belasteten Gesellschaften" thematisiert.
Wie grenzt sich Rawls vom Realismus in den internationalen Beziehungen ab?
Im Gegensatz zum Realismus, der Machtinteressen betont, setzt Rawls auf moralische Normen, Gerechtigkeit und die Kooperation durch gemeinsame Institutionen.
Wird die Rechtfertigung von Krieg in Rawls' Werk behandelt?
Ja, Rawls diskutiert die Bedingungen für einen gerechten Krieg, insbesondere im Rahmen der Verteidigung gegen aggressive, unrechtmäßige Staaten.
- Citar trabajo
- Maximilian Schmidt (Autor), 2009, John Rawls: Das Recht der Völker, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153172