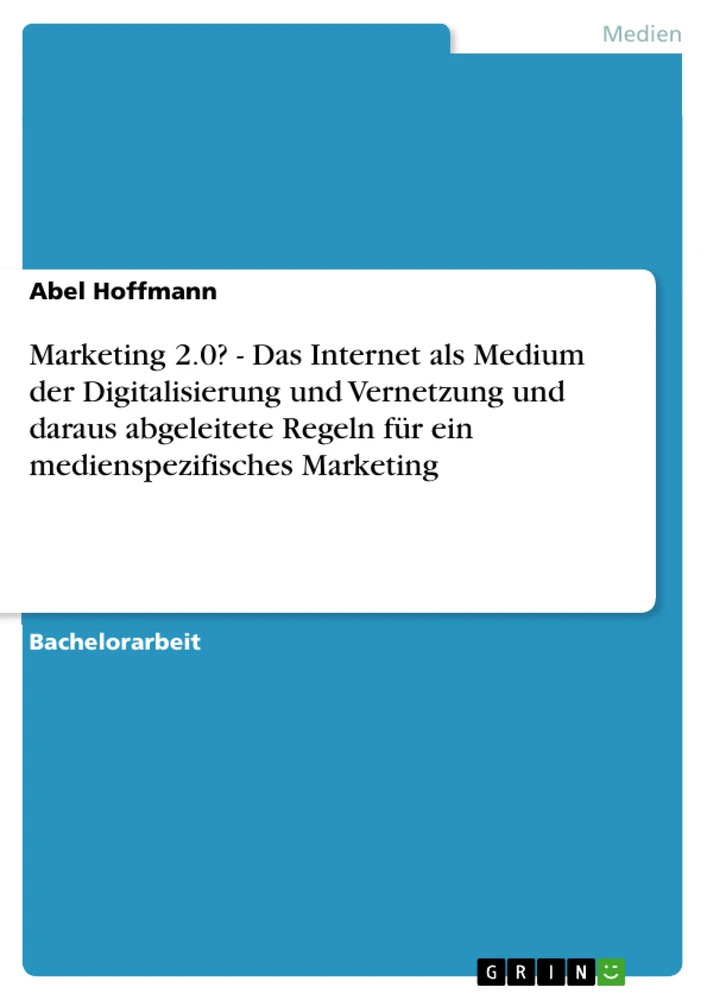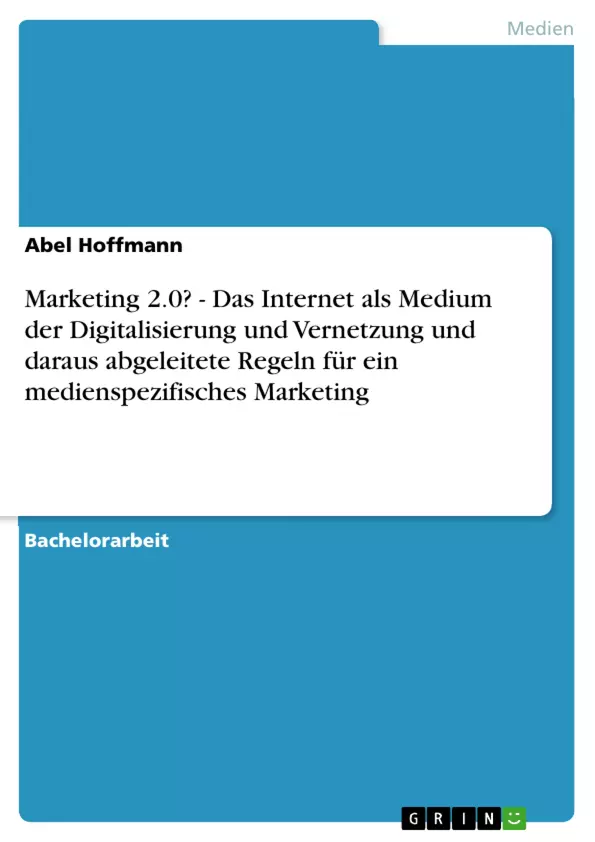Jedes neue Medium durchläuft zunächst eine Findungsphase, bevor es sich von seinen Vorgänger-Medien emanzipieren und eigene Problemlösungen anbieten kann. Sowohl Versuch und Irrtum als auch Reflexion und Diskurs spielen eine große Rolle bei der Entdeckung von Möglichkeiten und Grenzen von Medien. Unvermeidbar scheint in diesem Zusammenhang auch die Kombination aus Utopie und Dystopie sowie deren Bestätigung und Enttäuschung.
Im Rückblick auf die mittlerweile über 20-jährige Geschichte des WWW lässt sich die Findungsphase sehr gut nachverfolgen. Faszination und Überforderung, neue Geschäftsideen und Fehlinterpretationen, Zusammenbruch und Auferstehung, Verdammung und Vergötterung wechseln sich ab und existieren immer noch dicht nebeneinander. Blumige Namen wie Cyberspace und Information Superhighway kamen und gingen; im Moment ist der Begriff Web 2.0 in Mode. Zwar bezeichnet er technisch gesehen kein Internet der zweiten Generation , ist aber ein Ausdruck dafür, dass das Internet als Alltagsmedium tatsächlich aus seinen Kinderschuhen wächst und seinen berechtigten Platz zwischen Medienplattformen wie Zeitung, Fernsehen, Stammtisch, Marktplatz und Bühne einnimmt.
Aber auch wenn es sich mittlerweile herum gesprochen hat, dass das Internet anders funktioniert als klassische Massenmedien, trifft man immer noch auf Marketingkonzepte, die online genauso funktionieren wollen wie vorher in der Offline-Welt: Werbebanner, die den Anzeigen in Zeitschriften entlehnt sind, Top-Down-Kampagnen, die zu Zeiten massenmedialer Einwegkommunikation gut funktionierten, störende Unterbrecher-Werbung wie man sie aus dem Fernsehen kennt oder unpersönliche Massenmails, die nur der Spam-Ordner willkommen heißt. Anscheinend versuchen einige Unternehmen immer noch, ‚Operetten übers Radio zu senden‘.
Natürlich können beim Online-Marketing nicht alle Regeln des bisherigen strategi-schen Marketings über Bord geworfen werden, wie uns das einige (vor allem amerikanische) Autoren mit reißerischen Buchtiteln weis machen wollen, aber einige Marketing-Grundsätze haben sich tatsächlich gewandelt und es bedarf einer gründlichen Medien-Reflexion, um auf das Internet zugeschnittene Marketing-Strategien zu entwickeln und in das bestehende Marketing zu integrieren.
Inhaltsverzeichnis
- Thema und Zweck der Arbeit
- Das Thema und seine Relevanz
- Vorgehensweise
- Medienanalyse des Internets
- Digitalisierung und Vernetzung
- Digitalisierung
- Vernetzung
- Merkmale, die sich aus der Digitalisierung und Vernetzung ergeben
- Digitalisierung und Vernetzung
- Regeln für ein medienspezifisches Marketing
- Übersicht Online-Marketing Konzeption
- Analyse & Online-Marktforschung
- Unternehmens- & Marketingziele
- Online-Marketingstrategien
- Online-Marketinginstrumentarium
- Ergebniskontrolle
- Fazit und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von Marketingstrategien für das Internet als spezifisches Medium. Sie analysiert die Eigenschaften des Internets, die sich aus Digitalisierung und Vernetzung ergeben, und leitet daraus Regeln für ein medienspezifisches Marketing ab.
- Analyse der medienspezifischen Eigenschaften des Internets
- Entwicklung von Marketing-Strategien für das Internet
- Untersuchung der Unterschiede zwischen Online- und Offline-Marketing
- Bedeutung von Interaktivität und Personalisierung im Online-Marketing
- Entwicklung von Marketing-Konzepten, die die Besonderheiten des Internets berücksichtigen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Thema und Zweck der Arbeit beleuchtet die Relevanz der Thematik und skizziert die Vorgehensweise der Arbeit. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Internets als Medium und zeigt auf, dass die Anwendung herkömmlicher Marketingstrategien im digitalen Raum nicht immer erfolgreich ist.
Kapitel 2: Medienanalyse des Internets beschäftigt sich mit den Eigenschaften des Internets, die aus Digitalisierung und Vernetzung resultieren. Die Kapitel analysiert die Merkmale wie Speicherbarkeit, Dezentralität, digitale Kluft, Medienkonvergenz, Always-On-Mentalität, Durchsuchbarkeit, Netzeffekte, Manipulierbarkeit, Interaktivität und Personalisierung.
Kapitel 3: Regeln für ein medienspezifisches Marketing entwickelt aus den im vorherigen Kapitel beschriebenen Eigenschaften des Internets Marketingregeln für das Online-Marketing. Das Kapitel behandelt die Bereiche Analyse und Online-Marktforschung, Unternehmens- und Marketingziele, Online-Marketingstrategien, Online-Marketinginstrumentarium und Ergebniskontrolle.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Online-Marketing und beleuchtet die spezifischen Eigenschaften des Internets als Medium. Die Analyse konzentriert sich auf die Themen Digitalisierung, Vernetzung, Interaktivität, Personalisierung, Data Mining, Online-Marktforschung, Content Marketing und Suchmaschinenmarketing.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Online-Marketing von klassischem Marketing?
Online-Marketing nutzt die spezifischen Eigenschaften des Internets wie Interaktivität, Dezentralität und Personalisierung, anstatt nur Einwegkommunikation (wie Werbebanner analog zu Zeitschriftenanzeigen) zu betreiben.
Welche Merkmale ergeben sich aus der Vernetzung des Internets?
Wichtige Merkmale sind die Always-On-Mentalität, Medienkonvergenz, Durchsuchbarkeit, Netzeffekte sowie die Möglichkeiten zum Data Mining und zur direkten Interaktion mit dem Kunden.
Warum ist "Web 2.0" mehr als nur ein technischer Begriff?
Es steht dafür, dass das Internet als Alltagsmedium erwachsen geworden ist und soziale Interaktion sowie nutzergenerierte Inhalte ins Zentrum rücken, was neue Marketingregeln erfordert.
Welche Rolle spielt die Personalisierung im Online-Marketing?
Durch die Digitalisierung können Angebote individuell auf den Nutzer zugeschnitten werden, was die Effektivität von Kampagnen im Vergleich zu unpersönlichen Massenmails deutlich erhöht.
Was sind die "Todsünden" des Online-Marketings?
Dazu gehört der Versuch, klassische Offline-Strategien (wie störende Unterbrecher-Werbung) eins zu eins auf den digitalen Raum zu übertragen, ohne die medienspezifischen Besonderheiten zu reflektieren.
- Quote paper
- Abel Hoffmann (Author), 2010, Marketing 2.0? - Das Internet als Medium der Digitalisierung und Vernetzung und daraus abgeleitete Regeln für ein medienspezifisches Marketing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153187