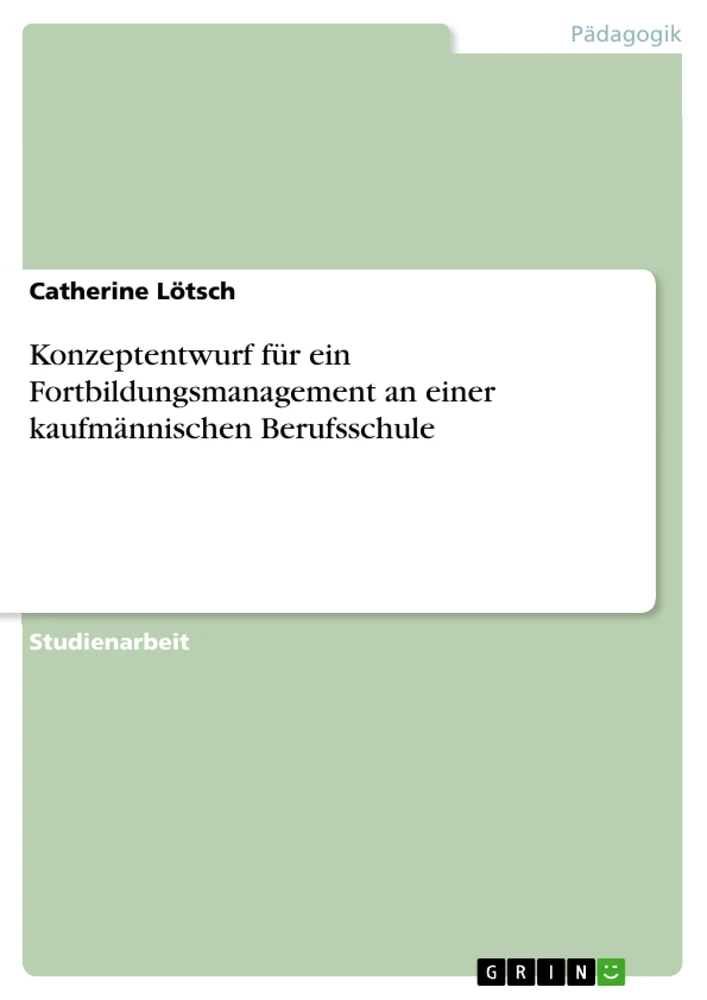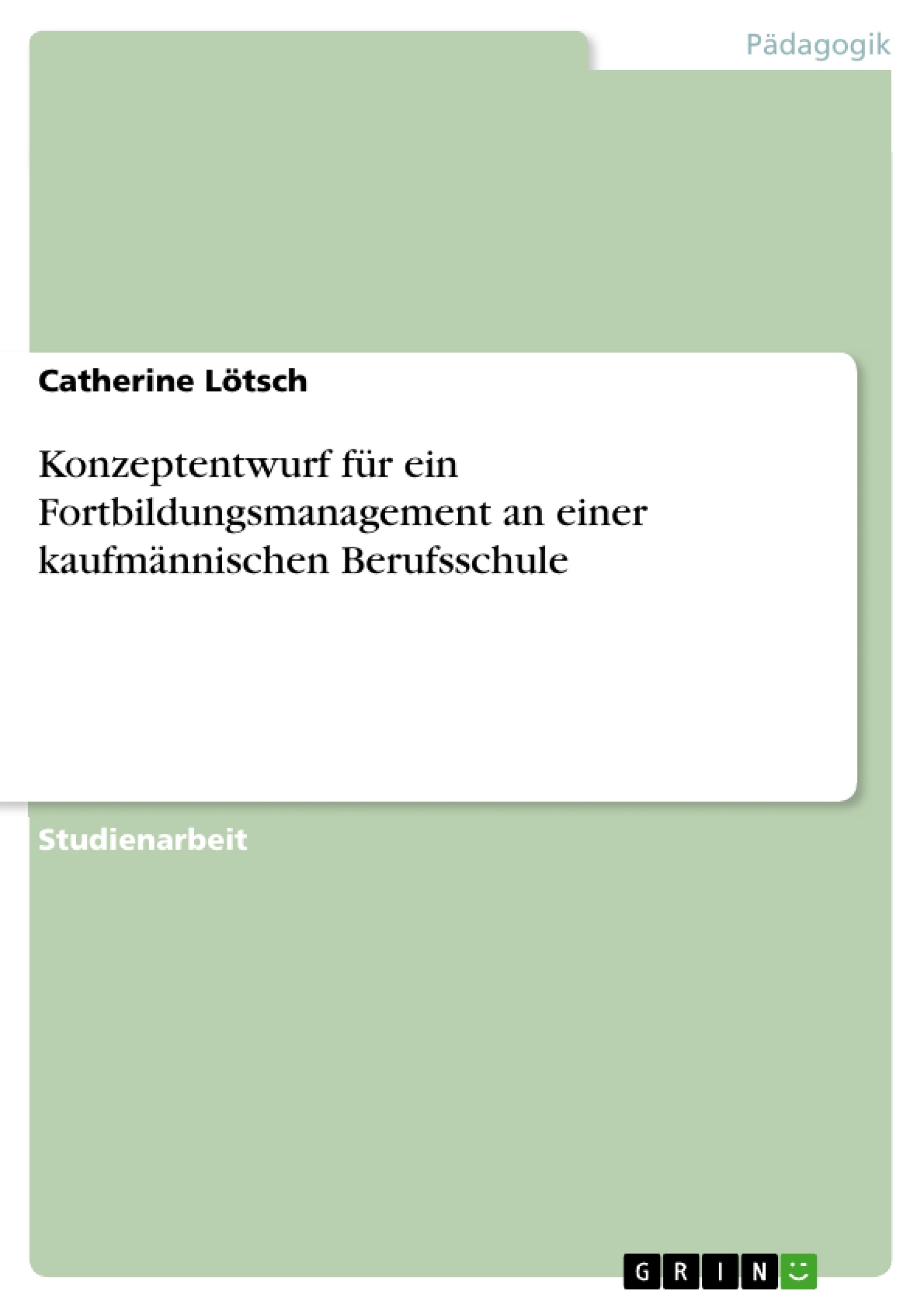Nach §127b des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) ist ein Fortbildungsplan integraler Bestandteil eines Schulprogramms, in welchem das pädagogische Selbstverständnis einer Schulgemeinde und die konkreten Ziele, Schwerpunkte und Entwicklungsvorhaben darlegt werden.
Die bisherige Fortbildungssituation an den meisten Schulen ist, dass sich die Lehrkräfte zwar rege fortbilden, aber diesbezüglich ihre Veranstaltungen relativ spontan nach eigenen Neigungen und Interessen auswählen. Es ist den einzelnen Lehrkräften weitgehend überlassen, an welchen Fortbildungen sie teilnehmen. Weiterbildung wird von allen als Privatsache angesehen.
Hieraus leiten sich für die Autorin folgende Fragen ab:
1) Wie ist ein Fortbildungsmanagement an einer kaufmännischen Berufsschule zu gestalten, eingebunden in einen ganzheitlichen systemischen Zusammenhang einer qualitätsfördernden Selbststeuerung?
2) Welches sind die Gelingensbedingungen für eine Einbindung und Verankerung von Fortbildungsplanung in den schulischen Alltag?
3) Welche Zuständigkeiten bestehen im Rahmen einer Fortbildungsplanung?
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein theoretisch fundiertes und insbesondere praktisch umsetzbares Konzept für ein systematisches Fortbildungsmanagement einer Einzelschule zu entwickeln. Damit sieht sich die Arbeit auch als Orientierungsrahmen für Fortbildungsbeauftragte aber auch für alle an einer systematischen Fortbildungsplanung Beteiligten.
In der vorliegenden Hausarbeit sollen wesentliche theoretische Grundlagen für eine systematische Fortbildungsplanung vorgestellt werden. Aufbauend auf diesen Kenntnissen werden die einzelnen Schritte eines zyklischen Prozesses der Fortbildungsplanung theoretisch fundiert erläutert und durch praktische Hinweise in Form von Leitfragen ergänzt. Schulbezogene Arbeitshilfen und Gesetzesauszüge ergänzen im Anhang die beschriebenen Schritte der Fortbildungskonzeption. Weiterhin wird eine mögliche Verteilung der Zuständigkeiten im Rahmen von Fortbildungsplanung vorgestellt. Abschließend werden die Kernaussagen und -erkenntnisse der Autorin thesenförmig zusammengefasst und weiterführende Unterstützungsmöglichkeiten für die Bewältigung der komplexen Thematik angeregt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intention und Ausgangslage
- Aufbau der Arbeit
- Rahmenbedingungen für ein Fortbildungsmanagement an der Kaufmännischen Schule
- Situationsbeschreibung der Kaufmännischen Berufsschule (KBS)
- Administrative Vorgaben für die Fortbildungsplanung an Hessischen Schulen
- Theoretische Grundlagen
- Lehrerfortbildung im Kontext von Schul- und Qualitätsentwicklung
- Weg von der Angebotsorientierung - hin zur Bedarfsorientierung
- Schritte einer Fortbildungsplanung
- Klärrung der anstehenden Aufgaben
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfs
- Setzung von Prioritäten
- Klärrung der Möglichkeiten
- Vereinbarung konkreter Fortbildungen
- Durchführung bzw. Besuch der Fortbildungen
- Auswertung der Fortbildungen
- Rückführung der Ergebnisse und Erfahrungen in die schulische Arbeit
- Zuständigkeiten im Rahmen des Fortbildungsmanagements
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, einen Konzeptentwurf für ein Fortbildungsmanagement an einer Kaufmännischen Berufsschule zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Etablierung einer systematischen Fortbildungsplanung, die an die spezifischen Bedürfnisse der Schule und ihrer Lehrkräfte angepasst ist. Dabei wird der Kontext der Schul- und Qualitätsentwicklung sowie die Relevanz lebenslangen Lernens für Lehrkräfte im Kontext des digitalen Wandels berücksichtigt.
- Entwicklung eines systematischen Fortbildungsmanagements
- Integration der Fortbildungsplanung in die Schul- und Qualitätsentwicklung
- Bedarfsgerechte Planung von Fortbildungsmaßnahmen
- Sicherung des Transfers von Fortbildungsinhalten in den Schulalltag
- Professionalisierung der Lehrkräfte im Kontext des digitalen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lehrerfortbildung im Kontext des digitalen Wandels ein und beleuchtet die Bedeutung lebenslangen Lernens für Lehrkräfte. Sie erläutert die Intention und Ausgangslage der Arbeit sowie den Aufbau. Kapitel 2 beleuchtet die Rahmenbedingungen für ein Fortbildungsmanagement an der Kaufmännischen Berufsschule, indem die Situation der Schule und die administrativen Vorgaben für die Fortbildungsplanung in Hessen vorgestellt werden. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Lehrerfortbildung im Kontext von Schul- und Qualitätsentwicklung und beleuchtet den Wandel von der Angebotsorientierung hin zur Bedarfsorientierung in der Fortbildungsplanung.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Schritte einer Fortbildungsplanung im Detail erläutert, wobei die Schwerpunkte auf der Klärung der anstehenden Aufgaben, der Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, der Setzung von Prioritäten, der Klärrung der Möglichkeiten, der Vereinbarung konkreter Fortbildungen, der Durchführung, der Auswertung und der Rückführung der Ergebnisse und Erfahrungen in die schulische Arbeit liegen. Abschließend werden die Zuständigkeiten im Rahmen des Fortbildungsmanagements dargestellt und ein Fazit sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Fortbildungsmanagement an einer Kaufmännischen Berufsschule. Im Fokus stehen Themen wie Schul- und Qualitätsentwicklung, Lehrerfortbildung, lebenslanges Lernen, Bedarfsorientierung, Fortbildungsplanung, Transfer von Fortbildungsinhalten, digitale Kompetenzen, Unterrichtsentwicklung und Professionalisierung.
- Citation du texte
- Dipl. Hdl. Catherine Lötsch (Auteur), 2009, Konzeptentwurf für ein Fortbildungsmanagement an einer kaufmännischen Berufsschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153199