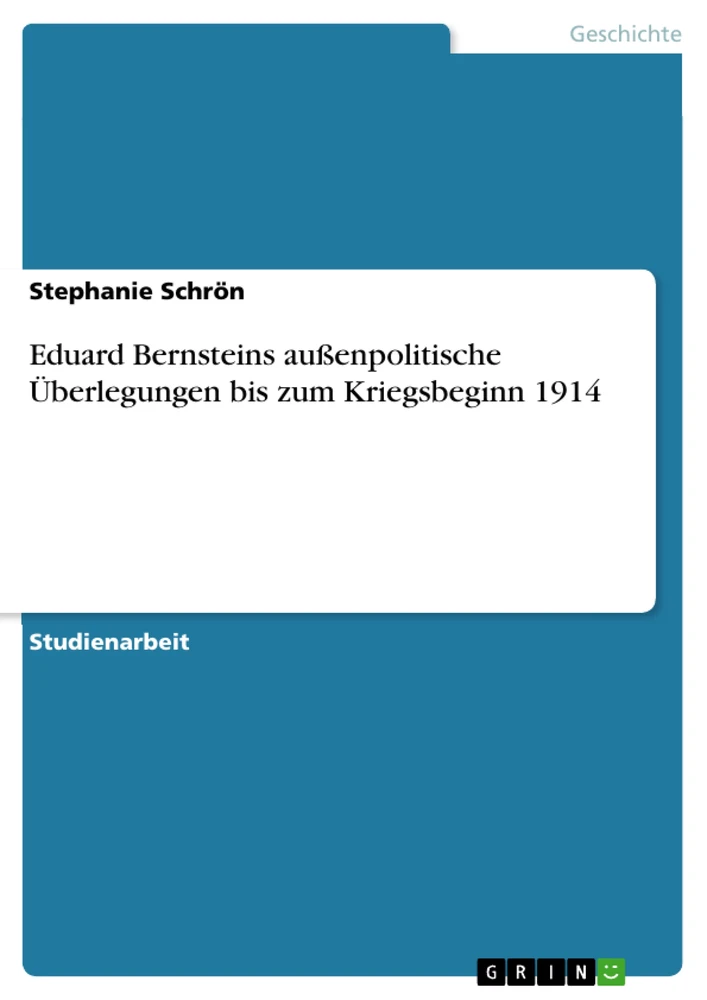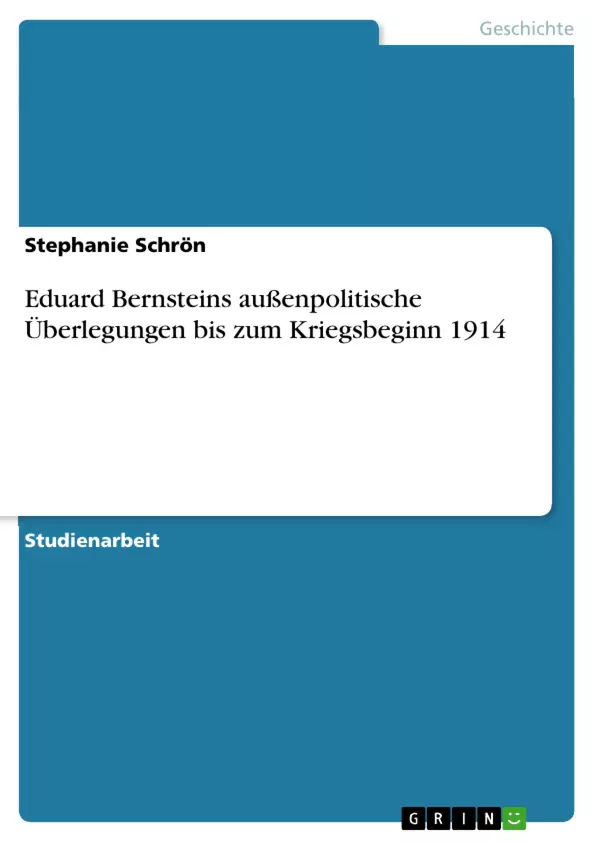Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem sozialdemokratischen Politiker Eduard Bernstein. Er wird auch als der „Vater des Revisionismus“ bezeichnet. Sein Wirken erstreckte sich von 1872, seinem Eintritt in die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), bis 1921, als Gastredner an der Berliner Universität. Ich werde Bernsteins außenpolitische Überlegungen bis zum Kriegsbeginn 1914 thematisieren. Die Arbeit beginnt mit seiner Biographie. In dieser Biographie seien nur die wichtigsten Daten und Ereignisse genannt, die für dieses Thema relevant sind. Der Hauptteil der Arbeit konzentriert sich auf Bernsteins außenpolitisches Denken bis zum Kriegsbeginn 1914. Die Themen umfassen unter anderem die Kolonialpolitik, Bernsteins Stellungsnahme zu Polen und das Wettrüsten mit England. In der Schlussbetrachtung gehe ich auf den Einfluss Bernsteins in der Politik ein und ob er die gesellschaftliche Entwicklung erkannte.
Nach der Aufschwungphase der Wirtschaft 1895 wurde nach einer neuen revolutionsstrategischen Interpretation verlangt. Bernstein hatte den Versuch unternommen, die Theorie der Realität anzupassen, während die sich formierende Linke nach einem geschichtsphilosophischen Ansatz suchte.
Biographie
Eduard Bernstein wurde am 6. Januar 1850 in Berlin geboren. Er war ein sozialdemokratischer Theoretiker und Politiker. Aus finanziellen Gründen musste er das Gymnasium verlassen, um von 1866 bis 1878 als Bankkaufmann zu arbeiten. 1872 trat er der SDAP bei. Ausschlaggebend dafür war eine Festrede die August Bebel vor dem Demokratischen Arbeiterverein in Berlin hielt und Bernstein sehr beeindruckte. 1875 kam es zur Vereinigung mit dem 1863 von Ferdinand Lassalle, einem Radikaldemokraten, der sich für die Einführung einer demokratischen Verfassung einsetzte, gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) und der SDAP.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Biographie
- III. Revisionismus
- IV. Eduard Bernsteins Außenpolitische Überlegungen bis zum Kriegsbeginn 1914
- A) Kolonialpolitik
- B) Bernsteins Stellungnahme zu Polen
- C) Wettrüsten mit England
- V. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das politische Wirken des sozialdemokratischen Politikers Eduard Bernstein, der auch als „Vater des Revisionismus“ bekannt ist. Der Fokus liegt auf Bernsteins außenpolitischen Überlegungen bis zum Kriegsbeginn 1914. Dabei werden seine Ansichten zu Themen wie Kolonialpolitik, die Stellungnahme zu Polen und das Wettrüsten mit England beleuchtet.
- Die Biografie von Eduard Bernstein
- Die Entwicklung und Inhalte des Bernsteinschen Revisionismus
- Bernsteins Positionen zu wichtigen außenpolitischen Fragen bis zum Kriegsbeginn 1914
- Der Einfluss von Bernsteins Ideen auf die deutsche Sozialdemokratie
- Die Einschätzung von Bernsteins Fähigkeit, die gesellschaftliche Entwicklung zu erkennen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt Eduard Bernstein und seine Rolle als „Vater des Revisionismus“ vor und skizziert den Fokus der Arbeit auf seine außenpolitischen Überlegungen bis zum Kriegsbeginn 1914.
II. Biographie
Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über Bernsteins Leben und Wirken. Es umfasst seine frühen Jahre, seinen Beitritt zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP), seine Rolle bei der Ausarbeitung des „Gothaer Programms“ sowie seine Erfahrungen im Exil und seine spätere politische Karriere in Deutschland.
III. Revisionismus
Dieser Abschnitt beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Bernsteinschen Revisionismus. Er beschreibt Bernsteins Kritik am Marxismus und seinen Versuch, die Theorie an die veränderte gesellschaftliche Realität anzupassen. Dabei wird auch auf Bernsteins Argumentation gegen die Prognosen von Marx zur Verelendung des Proletariats und dem Untergang des Kapitalismus eingegangen.
IV. Eduard Bernsteins Außenpolitische Überlegungen bis zum Kriegsbeginn 1914
Dieser Abschnitt widmet sich Bernsteins Positionen zu zentralen außenpolitischen Themen der Zeit, insbesondere die Kolonialpolitik, die Frage Polens und das Wettrüsten mit England. Die Analyse beleuchtet, wie Bernstein diese Themen aus revisionistischer Perspektive betrachtet und welche politischen Konsequenzen daraus resultieren.
Schlüsselwörter
Eduard Bernstein, Revisionismus, Sozialdemokratie, Marxismus, Außenpolitik, Kolonialpolitik, Polen, Wettrüsten, Kriegsbeginn 1914, Gesellschaftliche Entwicklung, Reformismus.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Eduard Bernstein und warum nennt man ihn "Vater des Revisionismus"?
Eduard Bernstein (1850–1932) war ein sozialdemokratischer Theoretiker, der den Marxismus kritisch hinterfragte und forderte, die Theorie der SPD an die reale gesellschaftliche Entwicklung anzupassen (Revision).
Wie stand Eduard Bernstein zur Kolonialpolitik?
Bernsteins Ansichten zur Kolonialpolitik waren Teil seiner außenpolitischen Überlegungen, wobei er versuchte, eine realpolitische Position innerhalb der SPD zu finden, die über rein ideologische Ablehnung hinausging.
Was war Bernsteins Position zum Wettrüsten mit England?
Bernstein thematisierte das gefährliche Wettrüsten vor 1914 und suchte nach Wegen der Verständigung, um einen drohenden Krieg in Europa abzuwenden.
Was ist der Kern des Bernsteinschen Revisionismus?
Der Kern ist die Abkehr von der Revolutionstheorie hin zu schrittweisen Reformen innerhalb des demokratischen Systems, da sich die Prognosen von Marx zur Verelendung des Proletariats nicht bewahrheiteten.
Welchen Einfluss hatte Bernstein auf die deutsche Sozialdemokratie?
Obwohl seine Thesen anfangs heftig umstritten waren, prägte sein reformorientierter Ansatz langfristig den Charakter der modernen SPD als Volkspartei.
Warum musste Bernstein das Gymnasium vorzeitig verlassen?
Aus finanziellen Gründen verließ er die Schule und absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann, bevor er sich ganz der Politik und Theorie widmete.
- Quote paper
- Stephanie Schrön (Author), 2006, Eduard Bernsteins außenpolitische Überlegungen bis zum Kriegsbeginn 1914, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153243