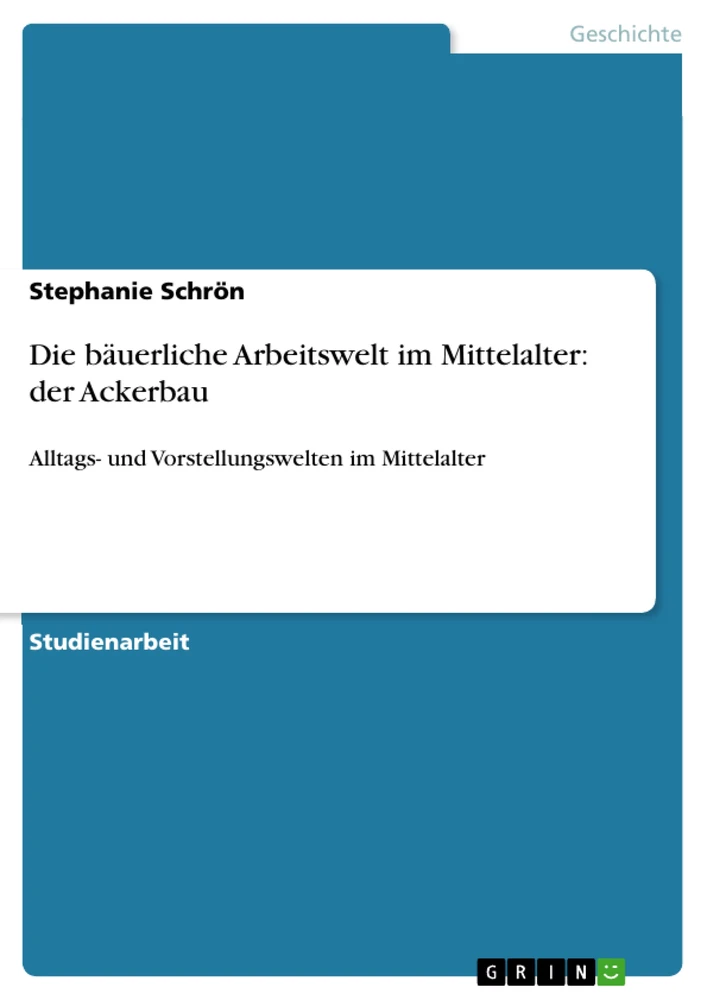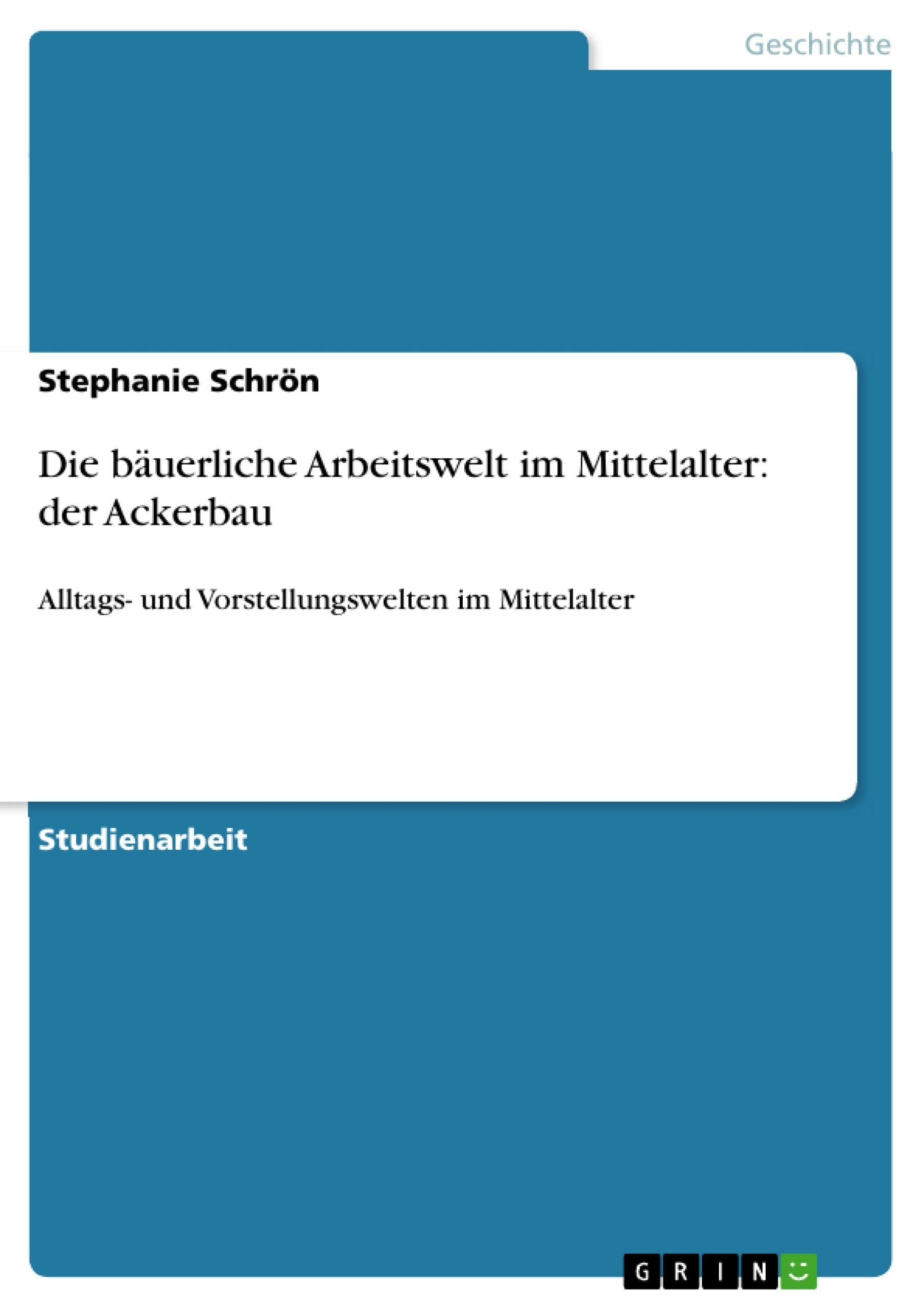Der Alltag im Mittelalter, speziell das Bauerntum, spielte eine wichtige Rolle und beschäftigt bis heute die Historiker. Dem Bauerntum viel „zweifellos der wichtigste Wirtschaftsbereich“ zu. Denn ihm gehörten „mehr als vier Fünftel der Bevölkerung“ an. Allerdings ist das Verfassen einer Alltagsgeschichte im frühen Mittelalter laut Hans-Werner Goetz noch nicht vollständig möglich. Es bedarf einiger Forschungsarbeit und vieler Quellenbefunde, um eine fundierte Alltagsgeschichte zu erarbeiten. Goetz versucht in seinem Werk „Leben im Mittelalter vom 7. bis zum 13. Jahrhundert“ einen Zugang und erste Einblicke in die verschiedenen Formen und Möglichkeiten des Alltagslebens zu vermitteln. Werner Rösener widmet sich dem Thema des Bauern im Mittelalter in seinem Werk „Bauern im Mittelalter“. Hier werden die Grundlagen, der Strukturwandel und die Hauptaspekte des bäuerlichen Lebens im Hoch- und Spätmittelalter erörtert. Ein sehr wichtiges und hilfreiches Buch für meine Hausarbeit ist die Sammlung von Schriftquellen und Bildzeugnissen von Siegfried Epperlein. Neben den zahlreichen Bildquellen (vgl. auch Sabine Lorenz-Schmidt, „Vom Wert und Wandel weiblicher Arbeit“) haben mich bei der Arbeit zwei Bücher mit Schriftquellen besonders begleitet. Zum einen „Quellen zur Geschichte des deutschen Bauernstandes im Mittelalter“ von Günther Franz und zum anderen „Quellen zur Alltagsgeschichte im Früh- und Hochmittelalter“ herausgegeben von Ulrich Nonn. Neben den großen historischen Ereignissen dürfen die alltäglichen Arbeiten des Mittelalters nicht in Vergessenheit geraten. Die Feldarbeit und damit auch der Ackerbau waren vermutlich schon im 9. Jahrhundert die wichtigsten Zweige der landwirtschaftlichen Produktion. Zudem bildete die „Landwirtschaft die Grundlage für die meisten menschlichen Lebensbedürfnisse“. [...] Als größte technische Neuerung gilt die Einführung des Beetpflugs. Die Quellenlage zum Bauern im Mittelalter fällt im Vergleich zu andern Disziplinen eher geringer aus. Der Bauer an sich ist selten Gegenstand des Schrifttums gewesen. In theologischen Schriften, in Ständepredigten und in bestimmten normativen Rechtsquellen finden sich Quellen zur Ständelehre. In den Schriftstücken des alltäglichen Lebens und in Urkunden hingegen finden sich nur wenige Quellen hinsichtlich der Ständelehre. Erst als sich die Bauern in rechtlicher Hinsicht von den Berufskriegern lösten und als eigener Stand auftraten, wurde der Begriff des Bauern in den ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundlagen des Bauerntums
- Die Arbeit der Bauern
- Arbeitsschritt: das Pflügen
- Arbeitsschritt: das Säen und Eggen
- Arbeitsschritt: das Ernten
- Arten der Feldwirtschaft
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bäuerliche Arbeitswelt im Mittelalter, insbesondere den Ackerbau. Ziel ist es, anhand von historischen Quellen ein Bild des bäuerlichen Alltags und der damit verbundenen Arbeitsabläufe zu zeichnen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Bauerntums als wichtigsten Wirtschaftszweig des Mittelalters und die Rolle der Bauern innerhalb des mittelalterlichen Ständesystems.
- Die Bedeutung des Bauerntums als Grundlage der mittelalterlichen Wirtschaft
- Die Arbeitsabläufe im Ackerbau (Pflügen, Säen, Ernten)
- Die Stellung der Bauern im mittelalterlichen Ständesystem
- Die materiellen und sozialen Bedingungen des bäuerlichen Lebens
- Die Nutzung von Quellen zur Rekonstruktion des bäuerlichen Alltags
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung des Bauerntums im Mittelalter als den wichtigsten Wirtschaftszweig und die Herausforderungen der Erforschung des bäuerlichen Alltags aufgrund der begrenzten Quellenlage. Sie führt zentrale historische Werke zur mittelalterlichen Alltagsgeschichte und zum Bauerntum an und verdeutlicht den Fokus der Arbeit auf den Ackerbau als zentralen Aspekt bäuerlicher Arbeit. Die Einleitung weist auf die Schwierigkeit hin, ein umfassendes Bild des bäuerlichen Alltags zu zeichnen, und hebt die Bedeutung verschiedener Quellen wie Schriftquellen und Bildzeugnisse hervor.
Die Grundlagen des Bauerntums: Dieses Kapitel beleuchtet die Stellung der Bauern innerhalb des mittelalterlichen Ständesystems. Es diskutiert die Dreiständelehre (Oratores, Bellatores, Laboratores) und deren Auswirkungen auf die soziale und rechtliche Position der Bauern. Das Kapitel analysiert die Entwicklung des Begriffs "Bauer" im Laufe des Mittelalters und zeigt, wie sich die Bauern als eigenständiger Stand herausbildeten. Es werden rechtliche und soziale Unterschiede zu anderen Bevölkerungsgruppen herausgestellt und die Entwicklung von spezifischer Kleidung und dem Verbot des Waffentragens für Bauern thematisiert. Die Kapitel veranschaulicht die Herausforderungen der Quellenforschung und interpretiert rechtliche Texte wie den Bayrischen Landfrieden von 1244, um die alltäglichen Realitäten der Bauern zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Bauerntum, Mittelalter, Ackerbau, Ständesystem, Dreiständelehre, Landwirtschaft, Quellenforschung, Alltagsgeschichte, Arbeitsabläufe, Bodenbearbeitung, Hufe, Grundherrschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Bauerngesellschaft
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die mittelalterliche Bauerngesellschaft, mit Fokus auf den Ackerbau. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, eine Beschreibung der Zielsetzung und der behandelten Themenschwerpunkte sowie eine Liste der Schlüsselbegriffe.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundlagen des Bauerntums, die Arbeitsabläufe im Ackerbau (Pflügen, Säen, Ernten), die Stellung der Bauern im mittelalterlichen Ständesystem, die materiellen und sozialen Bedingungen des bäuerlichen Lebens und die Herausforderungen der Quellenforschung zur Rekonstruktion des bäuerlichen Alltags. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung des Bauerntums als wichtigsten Wirtschaftszweig des Mittelalters.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Grundlagen des Bauerntums, Die Arbeit der Bauern (mit Unterkapiteln zu den einzelnen Arbeitsschritten), Arten der Feldwirtschaft und Schlussbetrachtung. Die Einleitung betont die Bedeutung des Themas und die Herausforderungen der Quellenlage. Das Kapitel "Die Grundlagen des Bauerntums" beleuchtet die Stellung der Bauern im Ständesystem und die Herausforderungen der Quellenforschung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf historische Quellen, die im Text jedoch nicht explizit benannt werden. Die Einleitung erwähnt die Schwierigkeit, ein umfassendes Bild aufgrund der begrenzten Quellenlage zu erhalten und hebt die Bedeutung verschiedener Quellen wie Schriftquellen und Bildzeugnisse hervor. Ein Beispiel für die genutzte Quellenart ist der Bayrische Landfrieden von 1244.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, anhand historischer Quellen ein Bild des bäuerlichen Alltags und der damit verbundenen Arbeitsabläufe zu zeichnen. Sie beleuchtet die Bedeutung des Bauerntums als wichtigsten Wirtschaftszweig des Mittelalters und die Rolle der Bauern innerhalb des mittelalterlichen Ständesystems.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bauerntum, Mittelalter, Ackerbau, Ständesystem, Dreiständelehre, Landwirtschaft, Quellenforschung, Alltagsgeschichte, Arbeitsabläufe, Bodenbearbeitung, Hufe und Grundherrschaft.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, das die Kapitel und Unterkapitel übersichtlich darstellt. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, gefolgt von Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und einer Liste der Schlüsselbegriffe. Der Aufbau ist klar und prägnant, um die wesentlichen Informationen übersichtlich zu präsentieren.
- Quote paper
- Stephanie Schrön (Author), 2008, Die bäuerliche Arbeitswelt im Mittelalter: der Ackerbau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153245