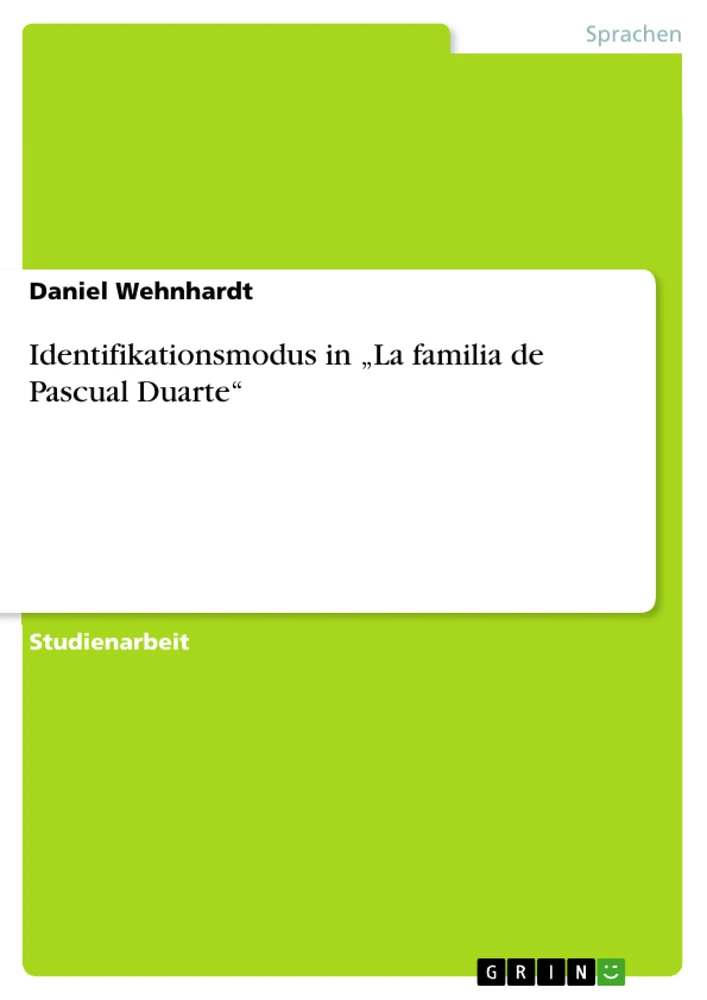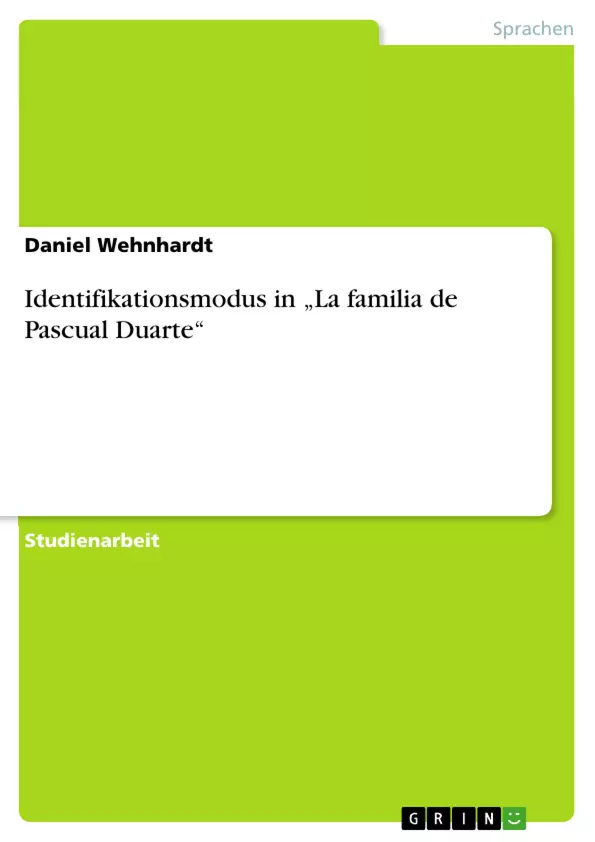Der Roman „La familia de Pascual Duarte“ wurde von dem Schriftsteller Camilo José Cela verfasst und erschien im Jahre 1942 (vgl. Neuschäfer, 2006, S. 378). Es handelt sich hierbei um das weltweit am zweithäufigsten übersetzte spanische Werk (vgl. Bauer-Funke, 2009, S. 82). Als Textgrundlage für die vorliegende Arbeit und die zur Thesenbelegung herangezogenen Zitate soll die erste im Verlag Seix Barral erschienene Ausgabe vom April 1984 dienen (siehe Literaturverzeichnis).
Im literaturgeschichtlichen Kontext ist der Roman in der Anfangszeit der Franco-Ära und somit nur wenige Jahre nach dem Ende des spanischen Bürgerkriegs anzusiedeln.
Nachdem „La familia de Pascual Duarte“ 1942 in Burgos gedruckt wurde, unterlag er später der franquistischen Zensur (vgl. Bauer-Funke, 2009, S. 82). Jene zwang Autoren und Regisseure zu einer wenigstens oberflächlichen Anpassung an die ideologischen
Kriterien der Diktatur, obwohl es einigen mit viel literarischer Finesse gelang, die Lücken der Zensur zu nutzen und sie zu unterlaufen (vgl. Stenzel, 2005, S. 222).
Das Erscheinen des Romans bedeutete nicht nur „[…] den Beginn einer kritischen Literatur, die das Bürgertum […]“ erschütterte, sondern stellte gleichzeitig auch mehrere Tabubrüche dar (Bauer-Funke, 2009, S. 82). Auf der einen Seite schuf Cela mit seinen
schonungslosen, exzessiven und detaillierten Darstellungen von Gewalt, Brutalität und Mord eine fortan als „Tremendismo“ bekannte literarische Erzählform (vgl. Bauer-Funke, 2009, S. 82). Auf der anderen Seite brach er „[…] den franquistischen Mythos eines in Frieden lebenden und glücklichen Volkes, indem er die sozialen Missstände in der Provinz […]“ und das Landleben der Bauern realitätsnah und fern der diktatorischen Idealisierung beschrieb (Bauer-Funke, 2009, S. 82).
Die vorliegende Arbeit möchte nun insbesondere der Fragestellung nachgehen, inwiefern sich Cela in „La familia de Pascual Duarte“ eines speziellen Identifikationsmodus bedient und welche Wirkungen dieser auf die Leser hat. Es gilt, die Behauptungen, dass sowohl Distanz als auch Nähe zum Protagonisten hergestellt werden sollen (vgl. Bauer-Funke, 2009, S. 83), zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Der Identifikationsmodus
- Begriffliche Bestimmung
- Identifikation in der Literatur
- Distanz versus Empathie in „La familia de Pascual Duarte“
- Die Schaffung von Distanz
- Die Schaffung von Empathie
- Die Schicksalsebene
- Die Nachvollziehbarkeit der Handlungen
- Die Ebene des Menschlichkeitsbilds
- Die Überschneidung der Ebenen
- Zusammenfassung / Interpretatorischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Identifikationsmodus, den Camilo José Cela in seinem Roman „La familia de Pascual Duarte“ einsetzt. Sie analysiert, wie Cela durch die Darstellung des Protagonisten Pascual Duarte gleichzeitig Distanz und Nähe beim Leser erzeugt und welche Auswirkungen dies auf die Rezeption des Textes hat.
- Der Begriff der Identifikation und seine Bedeutung für die Literatur
- Die literarische Gestaltung der Distanz zum Protagonisten
- Die Schaffung von Empathie durch die Darstellung von Pascual Duartes Schicksal, seinen Handlungen und seiner Persönlichkeit
- Der Einfluss des Identifikationsmodus auf die Rezeption des Romans
- Die Rolle der sprachlichen Mittel in der Konstruktion des Identifikationsmodus
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort stellt den Roman „La familia de Pascual Duarte“ von Camilo José Cela vor und ordnet ihn in den literaturgeschichtlichen Kontext der frühen Franco-Ära ein. Es hebt die Bedeutung des Romans als kritisches Werk gegen das Bürgertum und als Tabubruch hervor. Die Arbeit untersucht, wie Cela in seinem Roman einen speziellen Identifikationsmodus einsetzt, der sowohl Distanz als auch Nähe zum Protagonisten erzeugt.
Das Kapitel „Der Identifikationsmodus“ beleuchtet zunächst den Begriff der Identifikation und untersucht seine psychologische Bedeutung. Anschließend wird die Identifikation in der Literatur behandelt und die verschiedenen Mittel und Methoden, die eingesetzt werden, um Empathie beim Leser zu erzeugen, erläutert.
Das Kapitel „Distanz versus Empathie in „La familia de Pascual Duarte“ analysiert, wie Cela in seinem Roman sowohl Distanz als auch Nähe zum Protagonisten schafft. Die Schaffung von Distanz erfolgt unter anderem durch die einleitende Beschreibung eines fiktiven Transskriptors. Die Schaffung von Empathie hingegen wird durch sprachliche Details und die Darstellung von Pascual Duartes Schicksal, seinen Handlungen und seiner Persönlichkeit erreicht. Das Kapitel beleuchtet dabei die verschiedenen Ebenen, auf denen Empathie beim Leser erzeugt wird: die Schicksalsebene, die Nachvollziehbarkeit der Handlungen, die Ebene des Menschlichkeitsbilds und die Überschneidung dieser Ebenen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Identifikation, Distanz und Empathie im Kontext von Camilo José Cela's Roman „La familia de Pascual Duarte“. Zu den zentralen Begriffen zählen: literarische Gestaltung, Empathie, Distanz, Identifikationsmodus, Protagonist, Schicksal, Handlungen, Persönlichkeit, Rezeption, Sprache, Tremendismo, Franco-Ära, spanische Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Roman "La familia de Pascual Duarte"?
Der 1942 erschienene Roman von Camilo José Cela erzählt die Lebensgeschichte des Bauern Pascual Duarte, der durch eine Kette von Gewaltverbrechen zum Tode verurteilt wird.
Was bedeutet der literarische Begriff "Tremendismo"?
Tremendismo bezeichnet eine Erzählweise, die durch eine exzessive, schonungslose und brutale Darstellung von Gewalt und sozialen Missständen gekennzeichnet ist.
Wie erzeugt Cela beim Leser Empathie für einen Mörder?
Durch die Ich-Perspektive und die detaillierte Schilderung seines harten Schicksals und seiner sozialen Isolation wird Pascual Duarte nicht nur als Täter, sondern auch als Opfer seiner Umstände dargestellt.
Warum unterlag das Werk der franquistischen Zensur?
Der Roman brach mit dem Mythos des glücklichen spanischen Volkes unter Franco, indem er die Armut und Brutalität auf dem Land realitätsnah darstellte.
Welche Rolle spielt die Distanz zum Protagonisten?
Cela schafft Distanz durch einen fiktiven Transskriptor und die Einordnung der Taten als abscheulich, was den Leser zwingt, zwischen Mitleid und moralischer Ablehnung zu schwanken.
- Quote paper
- Daniel Wehnhardt (Author), 2009, Identifikationsmodus in „La familia de Pascual Duarte“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153247