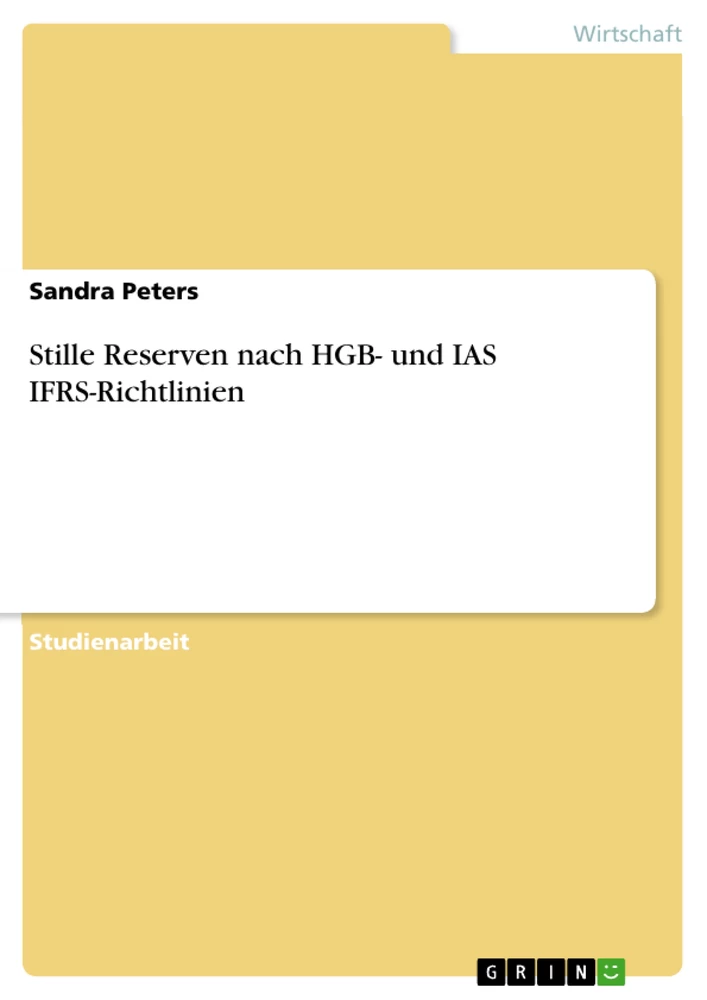1. Einleitung
International agierende Unternehmen sehen sich häufig in der Pflicht, ihren Jahresab-schluss sowohl nach den deutschen Richtlinien des Handelsgesetzbuches (HGB) als auch nach den internationalen Richtlinien der International Accounting Standards (IAS) zu erstellen. Mitunter können dabei gravierende Unterschiede zu Tage gefördert wer-den. So wies beispielsweise das Versicherungsunternehmen Allianz im Jahr 2001 fast doppelt so viel Eigenkapital nach IAS wie nach HGB aus. Über 60% dieser Differenz lassen sich durch die Bilanzierung von sogenannten stillen Reserven erklären. Stille Reserven entstehen entweder als Folge einer Unterbewertung der Aktiva, oder durch eine Überbewertung der Passiva – im Falle der Allianz entspricht dies immerhin knapp 8,3 Mrd. €. Das Beispiel verdeutlicht, dass stille Reserven nach HGB und IAS gänzlich unterschiedlich behandelt werden. Während sie durch das HGB in einigen Fällen erlaubt sind, lehnt das IAS sie grundsätzlich ab. Die abweichenden Bilanzierungsvorgaben von stillen Reserven nach IAS und HGB können dabei zu stark unterschiedlichen Aussagen über die Finanzlage eines Unternehmens führen. Unter anderem deshalb werden ausländische Jahresabschlüsse von der US-amerikanischen Börsenzulassungsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) nicht zugelassen, wohingegen US-amerikanische Jahresabschlüsse in Deutschland anerkannt werden. Inzwischen hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Anstrengungen un-ternommen, die Richtlinien des HGB stärker an die internationalen Vorgaben anzuleh-nen. So wurden einige Möglichkeiten zur Bildung von stillen Reserven im HGB eindeu-tig eliminiert.
Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Bilanzierungsarten der stillen Reserven nach HGB- und IAS/IFRS-Richtlinien und die daraus resultierende Problematik aufzu-zeigen. Dabei soll keine detaillierte Beschreibung des Aufbaus und der Regulierungen des HGB und der IAS/IFRS gegeben werden. Vielmehr sollen die Richtlinien in ihren wesentlichen Grundzügen erläutert werden und auf die für die Bilanzierung von stillen Reserven bedeutenden Unterschiede eingegangen werden. Hierzu sollen in Kapitel 2 die begrifflichen Grundlagen erläutert werden, bevor in Kapitel 3 auf die Unterschiede ein-gegangen wird. In Kapitel 4 sollen die Ergebnisse diskutiert und analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Definitionen
- 2.1 Stille Reserven
- 2.2 Handelsgesetzbuch
- 2.3 International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards
- 3. Stille Reserven im Vergleich nach HGB- und IAS/IFRS-Richtlinien
- 3.1 Zwangsreserven
- 3.2 Dispositionsreserven
- 3.3 Ermessensreserven
- 3.4 Willkürreserven
- 4. Zusammenfassung
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Eidesstattliche Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Bilanzierungsarten von stillen Reserven nach HGB- und IAS/IFRS-Richtlinien und der daraus resultierenden Problematik. Dabei liegt der Fokus auf den wesentlichen Grundzügen der Richtlinien und den für die Bilanzierung von stillen Reserven bedeutenden Unterschieden. Ziel ist es, die verschiedenen Arten von stillen Reserven zu erklären und die unterschiedlichen Bilanzierungsansätze nach HGB und IAS/IFRS aufzuzeigen.
- Unterschiede in der Bilanzierung stiller Reserven nach HGB und IAS/IFRS
- Arten von stillen Reserven (Zwangs-, Dispositions-, Ermessens- und Willkürreserven)
- Einfluss von stillen Reserven auf die Darstellung der Finanzlage eines Unternehmens
- Regulierungsanstrengungen des deutschen Gesetzgebers zur Angleichung des HGB an internationale Vorgaben
- Bedeutung von stillen Reserven für die internationale Rechnungslegung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 behandelt die grundlegenden Begriffe der Arbeit. Es werden die Eigenschaften und Arten von stillen Reserven erläutert, sowie die Bilanzierungsprinzipien HGB und IAS/IFRS vorgestellt. Kapitel 3 vergleicht die unterschiedlichen Bilanzierungsarten von stillen Reserven nach HGB- und IAS/IFRS-Richtlinien und stellt die daraus resultierende Problematik dar. Die verschiedenen Arten von stillen Reserven (Zwangs-, Dispositions-, Ermessens- und Willkürreserven) werden im Detail beleuchtet und anhand von Beispielen verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Stille Reserven, Handelsgesetzbuch (HGB), International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), Bilanzierung, Rechnungslegung, Unternehmensbewertung, Finanzlage, Bilanzpolitik, Vergleichende Analyse, Internationalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind stille Reserven in der Bilanzierung?
Stille Reserven sind Eigenkapitalbestandteile, die aus der Bilanz nicht unmittelbar ersichtlich sind. Sie entstehen durch Unterbewertung von Aktiva oder Überbewertung von Passiva.
Wie unterscheiden sich HGB und IAS/IFRS bei stillen Reserven?
Während das deutsche HGB stille Reserven aus Vorsichtsgründen in gewissen Maßen erlaubt oder sogar fordert, lehnen die internationalen Standards (IAS/IFRS) diese grundsätzlich ab, um ein realistisches Bild der Finanzlage zu vermitteln (Fair Value).
Welche Arten von stillen Reserven gibt es?
Man unterscheidet zwischen Zwangsreserven (durch Bewertungsvorschriften), Dispositionsreserven (Wahlrechte), Ermessensreserven (Schätzungsspielräume) und Willkürreserven (bewusste Fehlbewertung).
Welche Auswirkungen haben stille Reserven auf die Unternehmensanalyse?
Stille Reserven können die tatsächliche Finanzlage verschleiern. Ein Unternehmen kann nach außen hin ärmer erscheinen, als es ist, was die Vergleichbarkeit internationaler Abschlüsse erschwert.
Was änderte das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)?
Das BilMoG zielte darauf ab, das HGB stärker an internationale Standards anzunähern und eliminierte einige Möglichkeiten zur Bildung von stillen Reserven, um die Transparenz zu erhöhen.
- Citar trabajo
- Sandra Peters (Autor), 2010, Stille Reserven nach HGB- und IAS IFRS-Richtlinien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153264