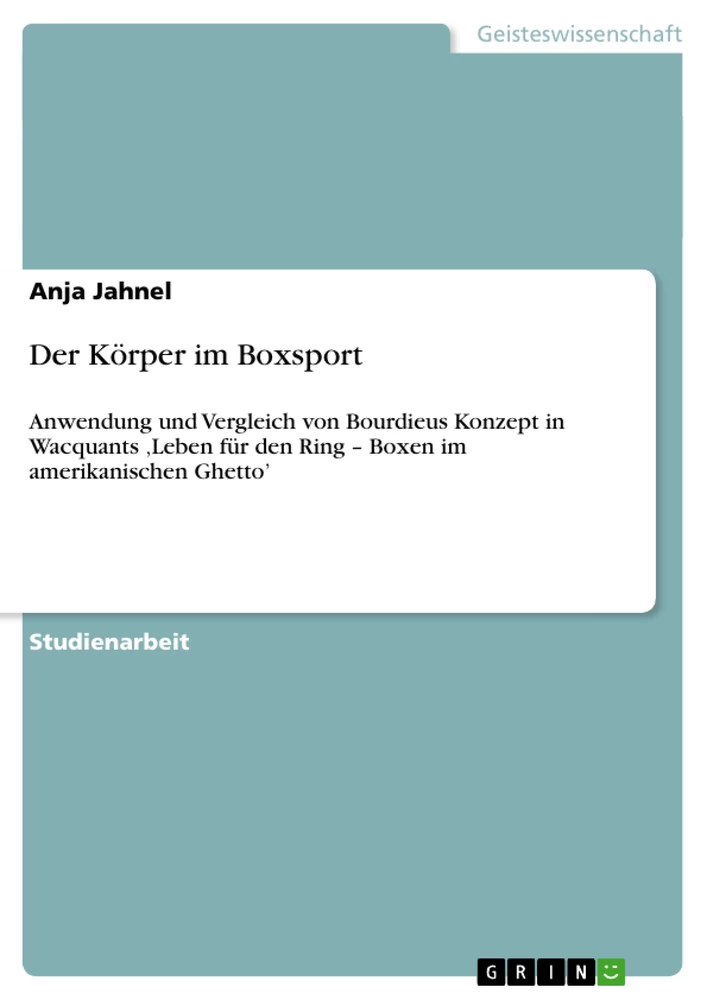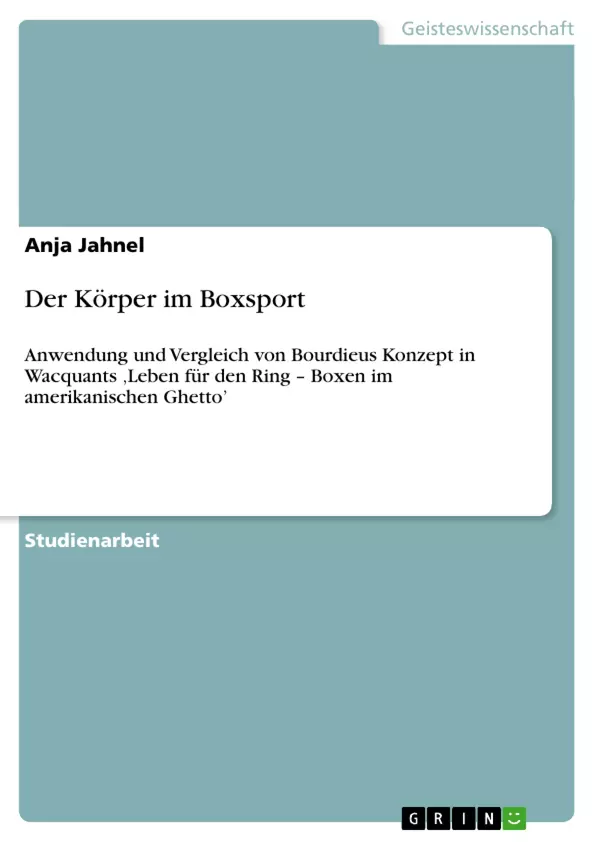1 Einleitung
In seiner ethnografischen Untersuchung in der Chicagoer Unterschicht Leben für den Ring - Boxen im amerikanischen Ghetto eröffnet Loic Wacquant seinen Lesern einen Blick in den Kosmos des Boxens, erklärt seine impliziten wie expliziten Gesetze, sozialen Mechanismen und verdeutlicht die immense Bedeutung des Sports [und des Raums] für das Viertel. Nicht zuletzt ist auch seine ungewöhnliche Herangehensweise, da selten praktiziert, an die Thematik von Interesse: Über eine teilnehmende Beobachtung als Boxer in einem Zeitraum von drei Jahren war es ihm auch möglich die „Sinnlichkeit der boxerischen Initiation" (Wacquant 2003:73) zu erfassen. Diese Erfahrung spiegelt sich in der Form seines Textes wider. Zum einen sei es ein wissenschaftliches ,Experiment' und zum anderen ein ,Bildungsroman', „der auf theoretischer, methodischer und rhetorischer Ebene die Tatsache gebührend berücksichtigt, dass der soziale Akteur in erster Linie ein Wesen aus Fleisch, Blut und Nerven ist" (ebd.:269). Der Zugang erfolgt über, sowohl auch ein tragendes Thema ist der Körper in seiner Arbeit. Als Schüler und enger Vertrauter Pierre Bourdieus, ist Wacquants Denk- und Herangehensweise an die Thematik von vorne herein stark von dem poststrukturalistischen Zugang seines ehemaligen Mentors (1930-2002) bestimmt. Die zentrale Fragestellung dieser Studienarbeit ist nun aber an welchen Punkten genau eine Unterscheidung zwischen dem Konzept des Körpers im Sport [Boxen], wenn es denn eine gibt, zu treffen ist und an welchen Stellen Wacquant Bourdieus Thesen einfach nur schlicht und ergreifend übernimmt und anwendet. Um diese Frage zu untersuchen, habe ich meine Vorgehensweise folgendermaßen strukturiert: Beide Autoren werden inhaltlich an Eckpunkten behandelt, die sich am Bourdieu'schen Konzept von Habitus, Kapital und Feld orientieren, wobei ich die thematische (teilweise ,laxe') Ordnung von Wacquant ignoriert und sie einer strengeren Form angepasst habe. Dadurch sollen Unterschiede noch klarer hervortreten und der Vergleich vereinfacht werden. Als Basis habe ich weit reichende Texte aus Bourdieus gesamtem Schaffenswerk gewählt[1], beziehe mich bei Wacquant aber ausschließlich auf das im Seminar behandelte Buch.