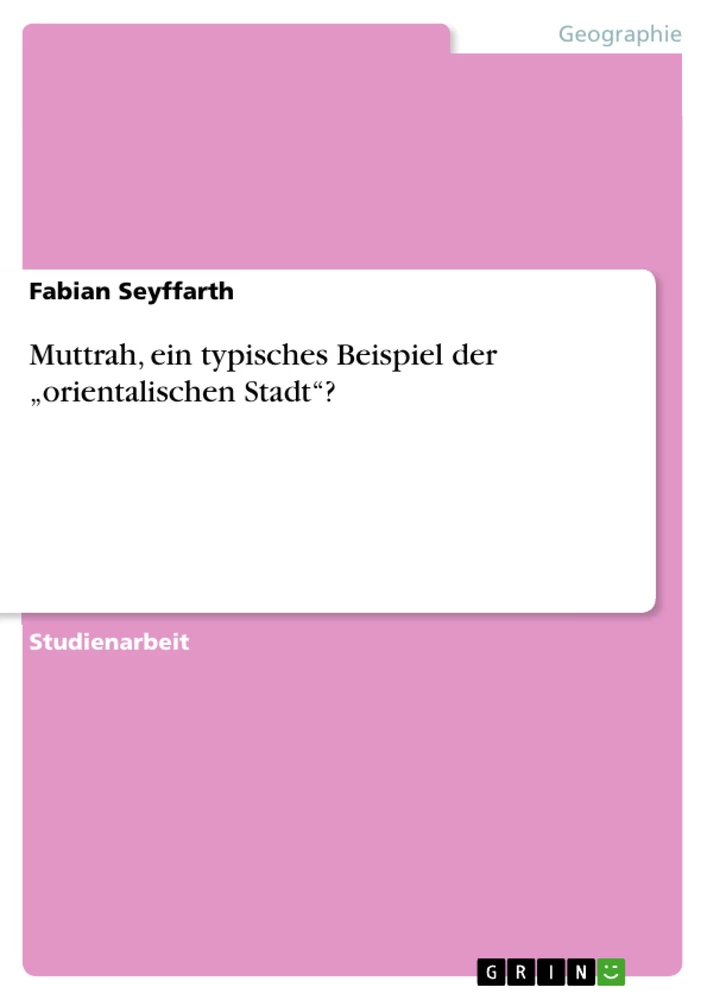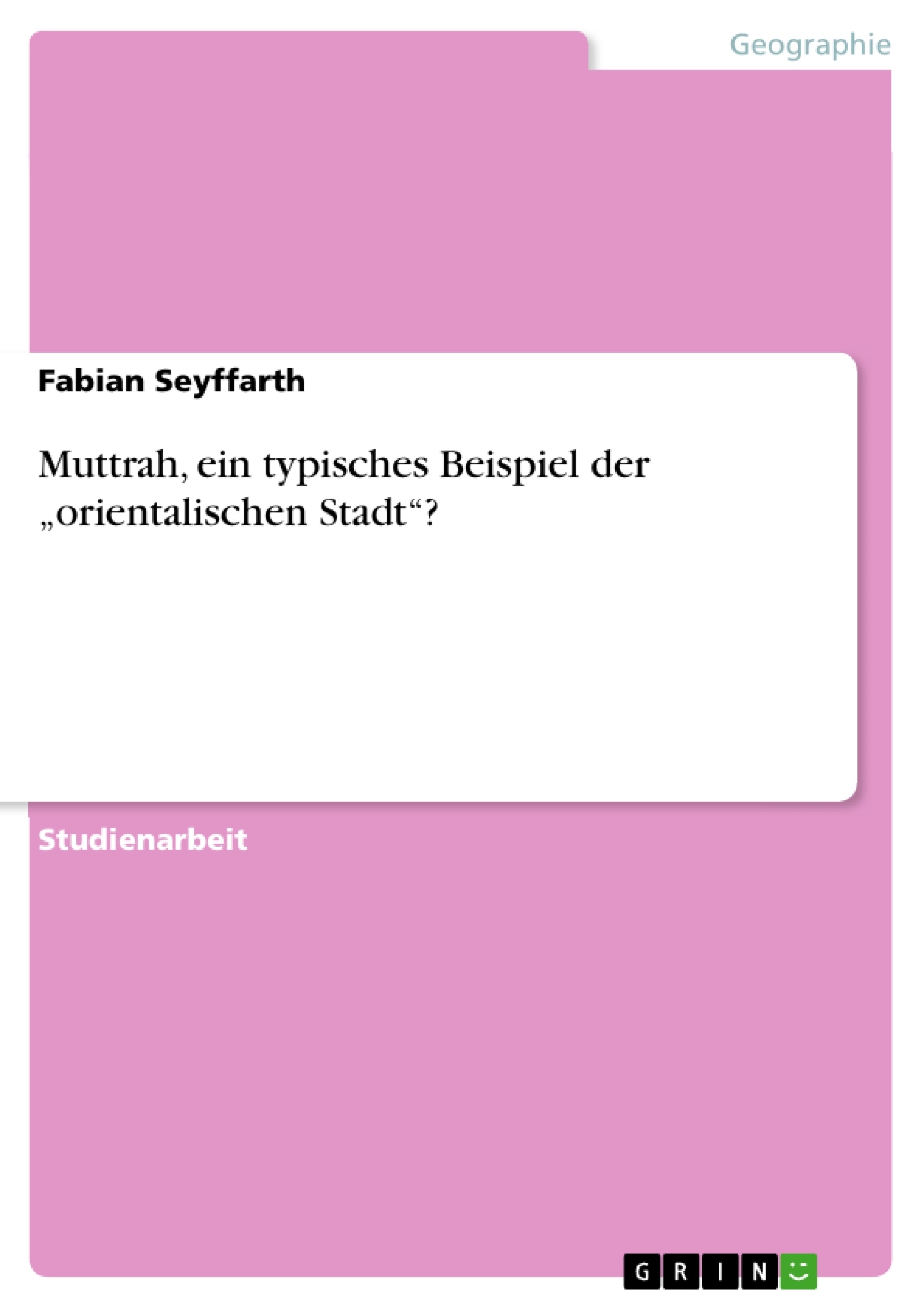Der Idealtypus der orientalischen oder auch islamischen oder orientalisch-
islamischen Stadt beschreibt eine Stadtstruktur, wie sie in Städten orientalischer
Länder oft zu beobachten ist bzw. war. Demnach gibt es zwei Typen der
orientalischen Stadt, die historische orientalische Stadt und die moderne
orientalische Stadt.
Ziel dieser Arbeit ist es, diese idealtypischen Stadtmodelle vorzustellen um
anschließend überprüfen zu können, welche Kriterien der Stadtmodelle die Stadt
Muttrah, heute ein Stadtteil der Großstadtregion Muscat, in ihrer Geschichte erfüllte
bzw. heute erfüllt.
Zu Beginn der Arbeit werden die theoretischen Modelle vorgestellt. Um
anschließend die Entwicklung vom Muttrah besser nachvollziehen zu können wird,
im praktisch orientierten Teil dieser Arbeit zunächst die Geschichte des Omans und
speziell der Region Muscat kurz skizziert. Anschließend wird die Entwicklung von
Muttrah ausführlich behandelt um letztlich die Frage beantworten zu können, welche
der Kriterien der theoretischen Stadttypen in Muttrah erfüllt wurden bzw. werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Idealtypen der orientalischen Stadt
- Der Idealtypus der kulturhistorischen und kulturraumspezifischen orientalischen Stadt
- Die orientalische Stadt unter westlich-modernem Einfluss
- Skizze der omanischen Geschichte mit besonderem Augenmerk auf die Region um die Stadt Muscat
- Entwicklung der Stadt Muttrah im historischen Kontext
- Stadtentwicklung und Stadtstruktur von Muttrah im Detail
- Synopse - Überprüfung der Realität auf die Theorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Stadt Muttrah im Oman, um herauszufinden, inwiefern sie als typisches Beispiel der „orientalischen Stadt“ betrachtet werden kann. Dabei werden theoretische Modelle der orientalischen Stadt vorgestellt und mit der historischen Entwicklung von Muttrah sowie ihrer heutigen Struktur verglichen.
- Analyse der Idealtypen der orientalischen Stadt, sowohl im historischen als auch im modernen Kontext
- Rekonstruktion der historischen Entwicklung von Muttrah im Kontext der omanischen Geschichte
- Untersuchung der Stadtstruktur von Muttrah in Bezug auf ihre morphologischen und funktionalen Eigenschaften
- Vergleich der beobachteten Merkmale von Muttrah mit den theoretischen Stadtmodellen
- Bewertung der Eignung von Muttrah als repräsentatives Beispiel für die „orientalische Stadt“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel werden die Idealtypen der orientalischen Stadt vorgestellt, sowohl der historische Typ, geprägt von kulturhistorischen und kulturraumspezifischen Einflüssen, als auch der moderne Typ, der die Folgen westlicher Einflüsse auf die traditionelle Stadtstruktur reflektiert. Kapitel 3 bietet einen Überblick über die omanische Geschichte und die Region um die Stadt Muscat, um einen historischen Kontext für die spätere Analyse von Muttrah zu schaffen. Kapitel 4 befasst sich mit der Entwicklung der Stadt Muttrah im historischen Kontext. Kapitel 5 analysiert die Stadtentwicklung und -struktur von Muttrah im Detail und untersucht die funktionalen und morphologischen Aspekte. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und die theoretischen Stadtmodelle mit der Realität von Muttrah verglichen.
Schlüsselwörter
Orientalische Stadt, Muttrah, Oman, Stadtstruktur, Idealtypus, Geschichte, Entwicklung, Stadtentwicklung, Kulturraum, islamischer Kulturkreis, Suq, Wohnquartiere, Stadtmauer, Moschee.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Idealtypus der „orientalischen Stadt“?
Es beschreibt eine Stadtstruktur mit spezifischen Merkmalen wie einer zentralen Moschee, einem Suq (Marktviertel), verwinkelten Gassen und geschlossenen Wohnquartieren.
Ist Muttrah ein typisches Beispiel für diesen Stadttyp?
Die Arbeit untersucht, welche Kriterien Muttrah in seiner historischen Entwicklung erfüllte und wie sich die Struktur unter westlich-modernem Einfluss verändert hat.
Welche Rolle spielt Muscat für die Region?
Muttrah ist heute ein Stadtteil der Großstadtregion Muscat, der Hauptstadt des Omans, und war historisch ein bedeutendes Handelszentrum.
Was sind Merkmale der modernen orientalischen Stadt?
Dazu gehören die Ausweitung der Stadtflächen, der Bau breiter Straßen für den Autoverkehr und die Integration westlicher Architekturstile.
Welche morphologischen Eigenschaften werden in Muttrah analysiert?
Untersucht werden unter anderem die Stadtmauer, die Verteilung der Wohnviertel und die Funktion des traditionellen Marktes (Suq).
- Quote paper
- B.Sc. Fabian Seyffarth (Author), 2010, Muttrah, ein typisches Beispiel der „orientalischen Stadt“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153368