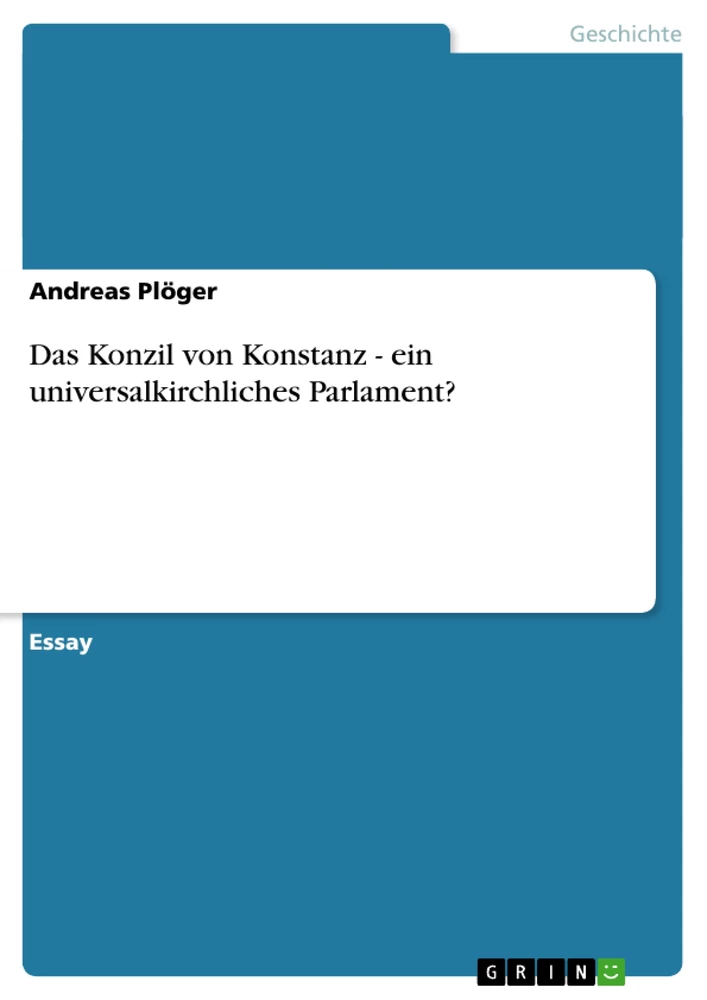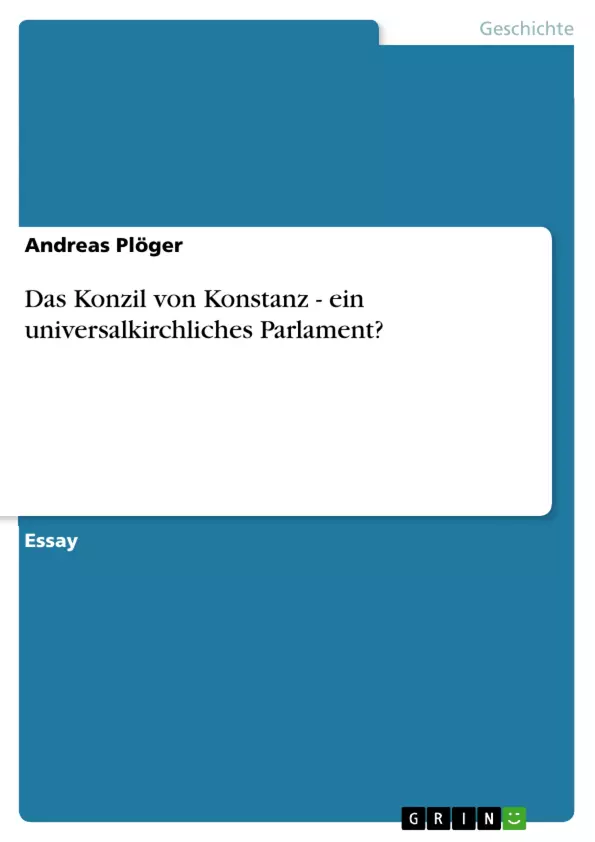"The Church was given a written constitution", so resümiert Dennis Hay das Ergebnis des Konstanzer Konzils. Die mittelalterliche Kirche begreift er als Staatswesen und versucht ihre Struktur unter Rückgriff auf modernen Kategorien und Begrifflichkeiten zu erklären. Wenn es nach den Beschlüssen von Konstanz geht, nimmt auch das Generalkonzil eine neue Position im strukturellen Gefüge der Kirche ein. Nur welche? Kann man Konstanz gar als universalkirchlichen Versuch eines Parlaments verstehen?
Inhaltsverzeichnis
- Das Konzil von Konstanz - ein universalkirchliches Parlament?
- Kontrolle und Legitimation
- Repräsentanz
- Kontrolle des Papsttums
- Arbeits- und Verfahrensweise
- Verstetigung konziliarer Tätigkeit
- Das Selbstverständnis des Konzils
- War Konstanz ein Parlament?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert das Konzil von Konstanz im Hinblick auf seine mögliche Qualifikation als universalkirchliches Parlament. Er untersucht, inwieweit die Struktur und Funktionsweise des Konzils mit den Merkmalen eines modernen Parlaments vergleichbar sind.
- Die Kontrollfunktion und die Legitimation des Konzils
- Die Repräsentativität des Konzils im Kontext der Universalkirche
- Die Mechanismen zur Kontrolle des Papsttums durch das Konzil
- Die Arbeits- und Verfahrensweise des Konzils im Vergleich zu parlamentarischen Strukturen
- Die Frage nach der Verstetigung und Institutionalisierung des Konzils
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Konzil von Konstanz - ein universalkirchliches Parlament?: Der Text stellt die Frage nach der Qualifikation des Konzils von Konstanz als Parlament in den Mittelpunkt und setzt die notwendigen Grundbegriffe der parlamentarischen Strukturen dar.
- Kontrolle und Legitimation: Dieses Kapitel analysiert die Rolle und Bedeutung der Kontrollfunktion und der Legitimation des Konzils im Hinblick auf die Einheit der Kirche und die Beseitigung des großen Schismas.
- Repräsentanz: Das Kapitel befasst sich mit der Frage der Repräsentanz des Konzils und wie diese im Kontext der Universalkirche verstanden werden kann.
- Kontrolle des Papsttums: Dieses Kapitel analysiert die Kontrollmechanismen des Konzils gegenüber dem Papsttum und untersucht die Auswirkungen auf die Machtverhältnisse innerhalb der Kirche.
- Arbeits- und Verfahrensweise: Das Kapitel befasst sich mit der Arbeits- und Verfahrensweise des Konzils, insbesondere mit den Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen und deren Vergleichbarkeit zu parlamentarischen Strukturen.
- Verstetigung konziliarer Tätigkeit: Das Kapitel beleuchtet die Frage nach der Verstetigung des Konzils durch das Dekret Frequens und die damit verbundenen Folgen für die Machtbalance zwischen Konzil und Papsttum.
- Das Selbstverständnis des Konzils: Dieses Kapitel analysiert das Selbstverständnis des Konzils, insbesondere im Hinblick auf seine Aufgabe, die Einheit der Kirche wiederherzustellen.
Schlüsselwörter
Das Konzil von Konstanz, Parlament, Legitimation, Repräsentanz, Kontrolle, Papsttum, Einheit der Kirche, Schisma, Arbeitsweise, Frequens, Konziliarismus, protoparlamentarisch.
- Quote paper
- Andreas Plöger (Author), 2009, Das Konzil von Konstanz - ein universalkirchliches Parlament?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153392