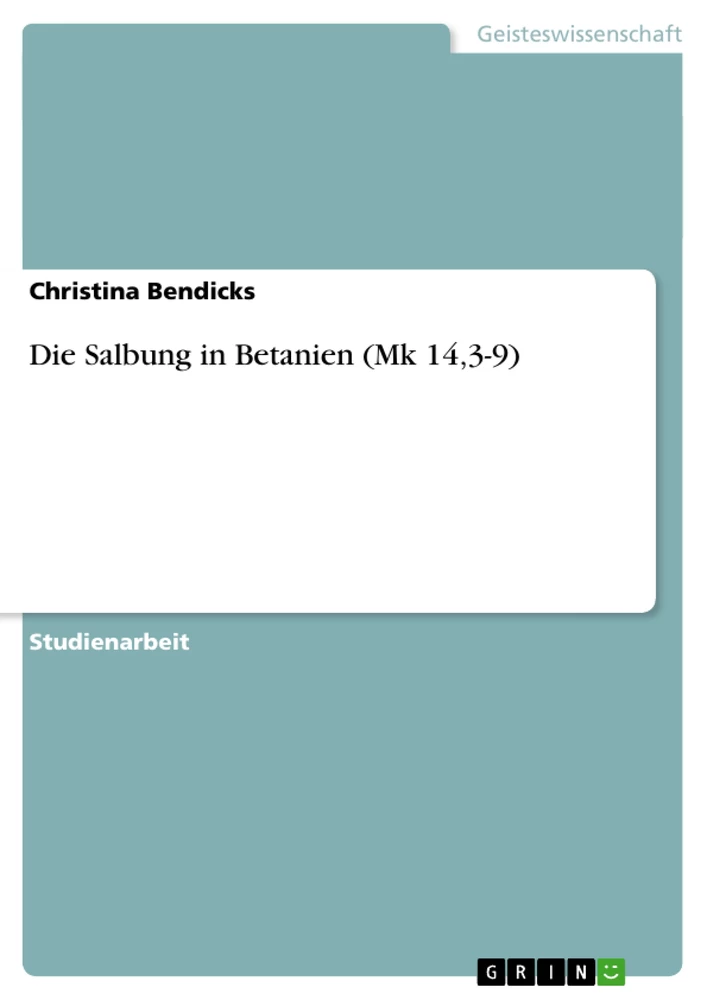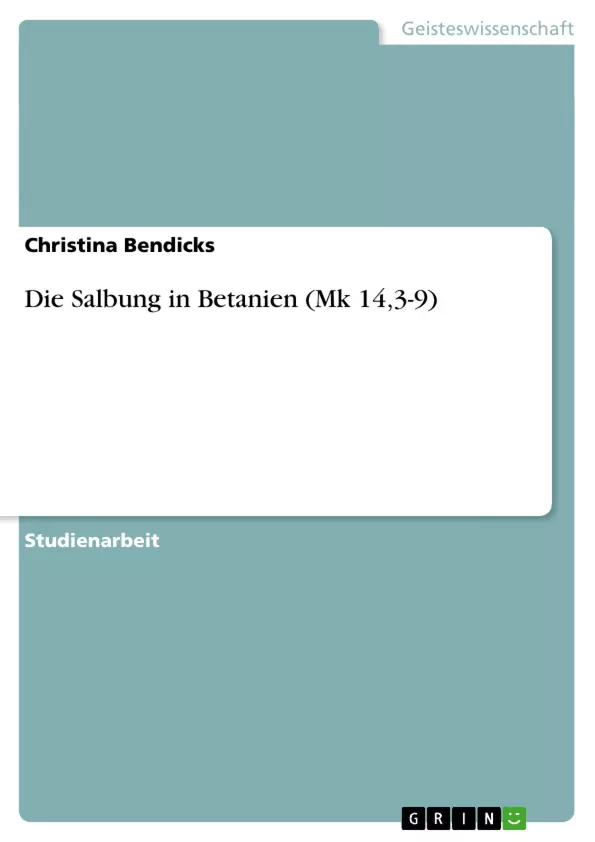3Und als er in Betanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, und er zu Tisch lag, kam eine
Frau, die ein Alabastergefäß mit echtem, kostbarem Nardensalböl hatte, und sie zerbrach das
Alabastergefäß und goss es hinab über seinen Kopf. 4Einige aber sprachen ihren Unwillen
einander gegenüber aus: Wozu diese Verschwendung des Salböls? 5Man hätte diese Öl
nämlich für über dreihundert Denare verkaufen und [das Geld] den Armen geben können.
Und sie fuhren sie zornig an. 6Jesus aber sagte: Lasst sie! Was verursacht ihr ihr Mühe? Sie
hat ein gutes Werk an mir getan. 7Denn ihr habt jederzeit die Armen mit euch, mich aber habt
ihr nicht jederzeit. 8Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im voraus für die
Bestattung gesalbt. 9Amen, ich sage euch aber: Wo auch immer das Evangelium verkündet
wird auf der ganzen Welt, wird auch das gesagt werden, was diese getan hat, zu ihrem
Gedächtnis.
2. Textkritik
Definition: Textkritik ist die Feststellung von Wortlaut und Schreibweise eines Textes, wie
diese für den ursprünglichen Autor anzunehmen sind. Die Textkritik hat somit die Aufgabe,
auf der Grundlage der Textzeugen den ältesten erreichbaren Text des Neuen Testaments zu
rekonstruieren.1
Als Grundlage für die Textkritik dient hier das Novum Testamentum Graece von Nestle-
Aland in der 27. Auflage. Zur Bearbeitung habe ich zwei Varianten aus Mk 14,3.7
herausgesucht, die exemplarisch untersucht werden.2
1 Strecker/Schnelle, S. 27
2 Bei der Form der Textkritik stütze ich mich auf Strecker/Schnelle, S. 41-44.
Inhaltsverzeichnis
- Übersetzung
- Textkritik
- Einzelvergleich
- Kontextstellung
- Quellenkritik
- Formgeschichte
- Gattungskritik
- Überlieferungsgeschichte
- Traditionsgeschichte
- Redaktionsgeschichte
- Redaktionskritische Analyse von Mk 14,3-9
- Empfänger
- Theologische Grundgedanken
- Die Darstellung der Frau im Markusevangelium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Perikope der Salbung Jesu in Betanien (Mk 14,3-9) mit dem Ziel, die textkritische, literarkritische, formgeschichtliche und redaktionsgeschichtliche Bedeutung des Textes zu beleuchten.
- Textkritische Analyse der Perikope
- Interpretation des Textes im Kontext der literarischen Gestalt des Markusevangeliums
- Formgeschichtliche Analyse des Perikopen-Typs
- Redaktionsgeschichtliche Analyse des Textes im Rahmen der markinischen Theologie
- Die Rolle und Darstellung von Frauen im Markusevangelium
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Übersetzung des Textes aus dem Griechischen ins Deutsche. Anschließend wird die Textkritik anhand von zwei Beispielen untersucht, um die ursprünglichen Wortlaut und Schreibweise des Textes zu rekonstruieren. Die literarkritische Analyse untersucht den Text im Kontext des Markusevangeliums und vergleicht ihn mit anderen Versionen des Textes.
Die Formgeschichte analysiert den Perikopen-Typ der Salbung und untersucht seine Überlieferungs- und Traditionsgeschichte. Abschließend wird die Redaktionsgeschichte der Perikope im Rahmen der markinischen Theologie beleuchtet, wobei die Empfänger des Textes und die theologischen Grundgedanken des Markusevangeliums betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Markusevangelium, Perikope, Salbung, Betanien, Frauendarstellung und Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Textkritik im Neuen Testament?
Die Textkritik hat die Aufgabe, auf Grundlage von Textzeugen den ältesten erreichbaren Text zu rekonstruieren und den ursprünglichen Wortlaut festzustellen.
Wo findet die Salbung Jesu in Mk 14,3-9 statt?
Die Szene ereignet sich in Betanien, im Haus von Simon dem Aussätzigen.
Warum kritisieren die Anwesenden die Frau in der Erzählung?
Sie betrachten die Verwendung des kostbaren Nardensalböls als Verschwendung und argumentieren, man hätte es für über 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können.
Wie deutet Jesus die Tat der Frau?
Jesus verteidigt sie als "gutes Werk" und erklärt, dass sie seinen Körper im Voraus für die Bestattung gesalbt hat.
Welche Rolle spielen Frauen im Markusevangelium laut dieser Analyse?
Die Arbeit untersucht die spezifische Darstellung und theologische Bedeutung von Frauenfiguren im Rahmen der markinischen Redaktionsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Christina Bendicks (Autor:in), 1996, Die Salbung in Betanien (Mk 14,3-9), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15341