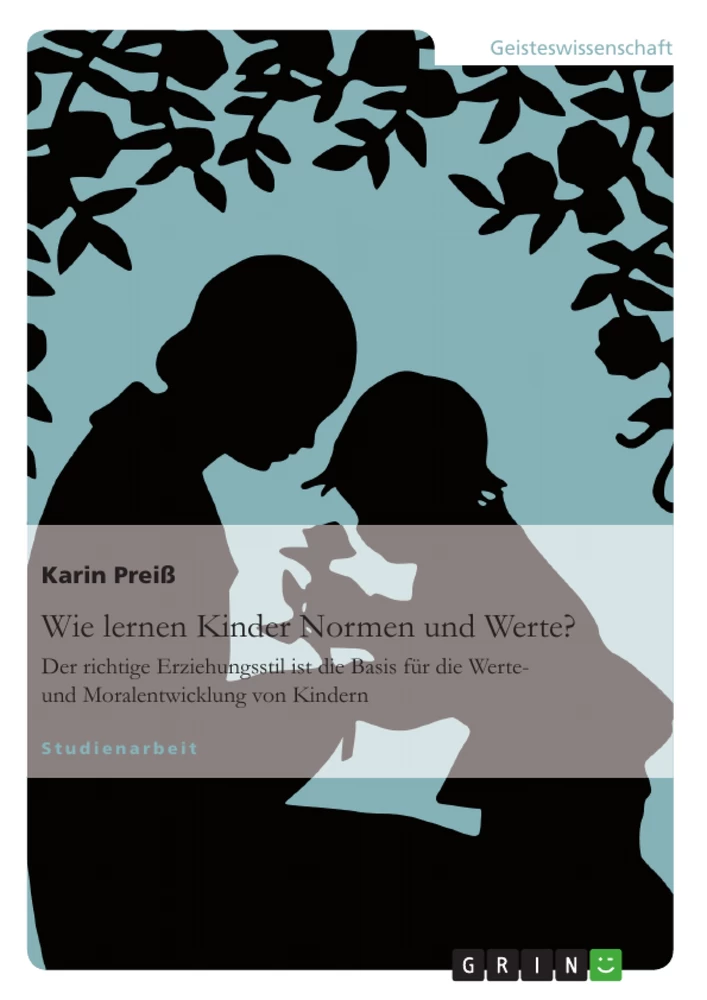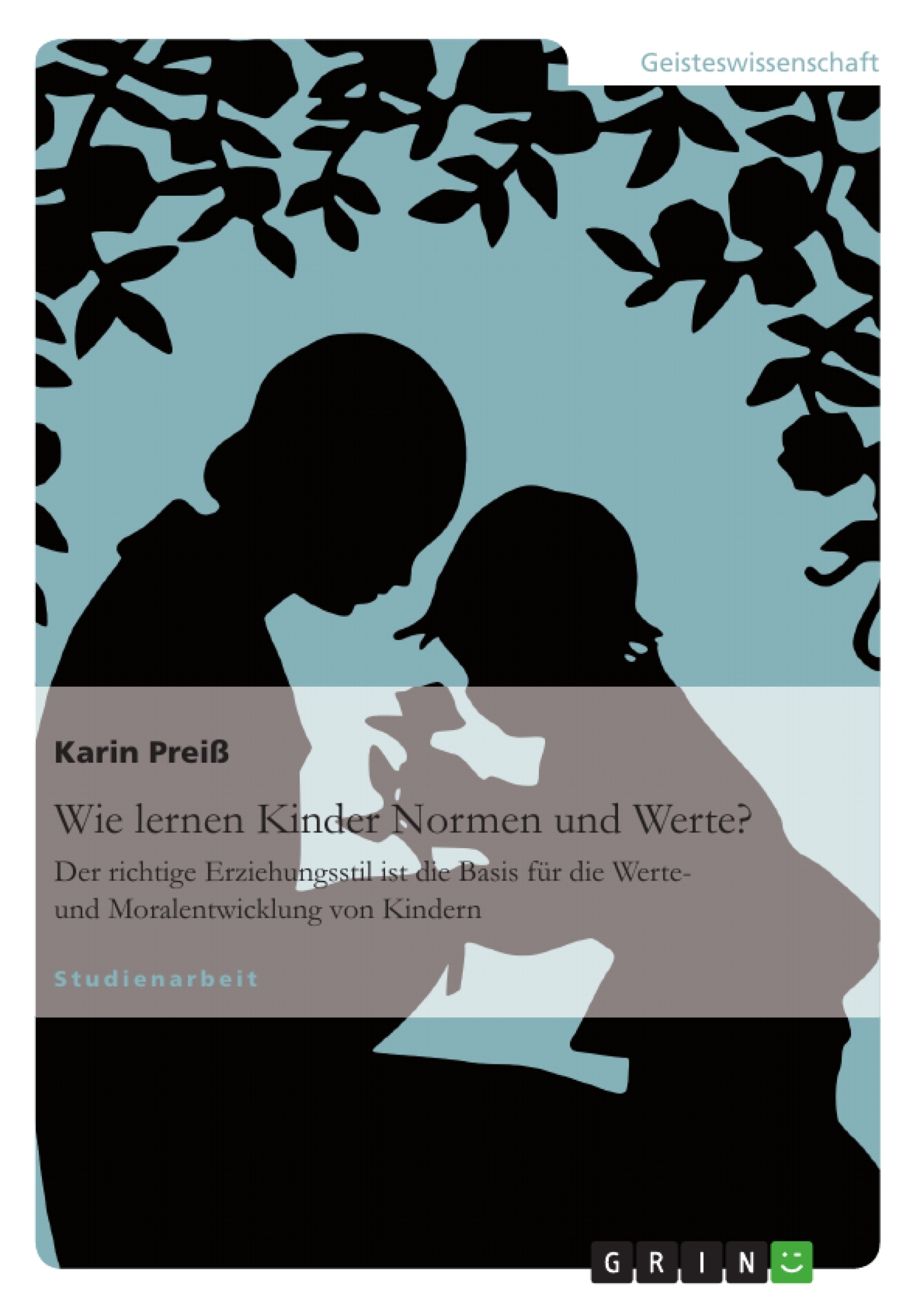Kinder lernen Normen und Werte in erster Linie durch Beobachtung und Nachahmung. Deshalb sind gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes entscheidend für sein weiteres emotionales und moralisches Leben. Daher sollte es Eltern ein großes Bedürfnis sein, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind die Möglichkeit bekommt, unter einer autoritativen Erziehung aufzuwachsen.
Der Prozess der Sozialisation sollte kein beschwerliches Unterfangen werden, sondern sich "automatisch" im Familienleben vollziehen. Wenn Eltern positive Vorbilder sind und auch das Umfeld eines Kindes sich positiv gestaltet, wird ein Kind sich auch an Regeln, sozialen Normen und Werte, die die Eltern ihm vorlebt und erklärt, anpassen. Durch gegenseitige Achtung, durch Förderung der Eigenverantwortlichkeit, durch die Bereitschaft zum Zuhören, durch die Toleranz gegenüber anderen Einstellungen und Erfahrungen, durch Kompromissbereitschaft und Gewaltverzicht können Werte, die den Eltern zur Vermittlung an ihre Kinder wichtig sind, von den Kindern internalisiert und emotional betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind Normen bzw. soziale Normen?
- Was sind Werte?
- Der Prozess der Sozialisation
- Sichere Bindung an die Bezugspersonen
- Erziehung ist Beziehung
- Kinder sind manipulierbare Wesen
- Anlage-Umwelt-Debatten
- Auswirkungen der autoritären Manipulation
- Erziehung im Wandel
- Gesellschaftliche Veränderungen
- Der Weg des geringsten Widerstandes
- Autonom, emotional und selbstbewusst
- Warum ist die Internalisierung von Normen und Werten so wichtig?
- Theorien über die Entwicklung von Normen und Werten bzw. moralischem Denken, Handeln und Urteilen
- Soziale Perspektive im präkonventionellen Niveau (Kohlberg)
- Ist die Abgrenzung der Moralentwicklung in Ebenen und Stufen (nach Kohlberg) wirklich realistisch? (Kritik an Kohlberg)
- Dein Kind - dein Spiegelbild
- Emotionen sollten Kinder begleiten - von Anfang an!
- Theorien auf der einen - Realitäten auf der anderen Seite
- Was ist eigentlich Moral?
- Lehren und Lernen
- Regeln veranschaulichen und begründen
- Wieso? Weshalb? Warum?
- Normen und Werte – keine Kopfsache, sondern eine spontane Entscheidung aus dem „Bauch“ heraus?
- Von Vorbildern, die keine sind
- Belohnung und Bestrafung
- Welche Werte sind „wertvoll“?
- Auch kindliche Fantasie kann Werte beinhalten
- Dilemma-Situationen oder moralische Dilemmata
- Last but not least
- Zusammenfassung
- Persönliches Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Kinder Normen und Werte lernen und internalisieren. Dabei werden verschiedene Aspekte der Sozialisation und Erziehung beleuchtet, um ein tieferes Verständnis für den Einfluss von sozialen Strukturen, persönlichen Beziehungen und individuellen Erfahrungen auf die Entwicklung von Moral und Werten zu gewinnen.
- Die Bedeutung von sicheren Bindungen und Beziehungen in der frühen Kindheit
- Die Herausforderungen und Chancen der Erziehung im Wandel
- Der Einfluss von Theorien zur Moralentwicklung auf das Verständnis von Normen und Werten
- Die Rolle von Emotionen und Empathie im Lernprozess
- Die Bedeutung von Vorbildrollen und moralischen Dilemmata für die Entwicklung von Werten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und definiert die Begriffe „Normen“ und „Werte“. Anschließend wird der Prozess der Sozialisation aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wobei der Fokus auf der Bedeutung von Bindung, Erziehung und dem Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen liegt. In einem weiteren Kapitel werden verschiedene Theorien zur Entwicklung von Normen und Werten vorgestellt, darunter die Theorie von Kohlberg zur moralischen Entwicklung. Die Arbeit befasst sich auch mit der Frage, inwiefern die Internalisierung von Normen und Werten für das Individuum wichtig ist. Weitere Kapitel beleuchten die Bedeutung von Emotionen und Empathie im Lernprozess, die Rolle von Vorbildrollen und moralischen Dilemmata sowie die Herausforderungen der modernen Erziehung.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Normen, Werte, Moralentwicklung, Erziehung, Bindung, Empathie, Vorbildrolle, Dilemmata, Gesellschaftliche Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie lernen Kinder am effektivsten Normen und Werte?
Kinder lernen primär durch Beobachtung und Nachahmung, weshalb die Vorbildfunktion der Eltern in den ersten Lebensjahren entscheidend ist.
Was ist autoritative Erziehung?
Es ist ein Erziehungsstil, der auf gegenseitiger Achtung, Förderung der Eigenverantwortung und klarer Kommunikation basiert, um Werten eine emotionale Bedeutung zu geben.
Welche Rolle spielen Emotionen bei der Moralentwicklung?
Emotionen und Empathie sind zentral für den Lernprozess, da Werte nicht nur kognitiv verstanden, sondern internalisiert werden müssen.
Was besagt die Theorie von Kohlberg?
Kohlberg beschreibt die Moralentwicklung in verschiedenen Stufen und Ebenen, wobei die Arbeit auch kritisch hinterfragt, ob diese Abgrenzung realistisch ist.
Was versteht man unter der Internalisierung von Normen?
Internalisierung bedeutet, dass Kinder gesellschaftliche Regeln und Werte als ihre eigenen übernehmen und danach handeln, ohne dass äußerer Druck nötig ist.
- Arbeit zitieren
- Karin Preiß (Autor:in), 2010, Wie lernen Kinder Normen und Werte?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153418