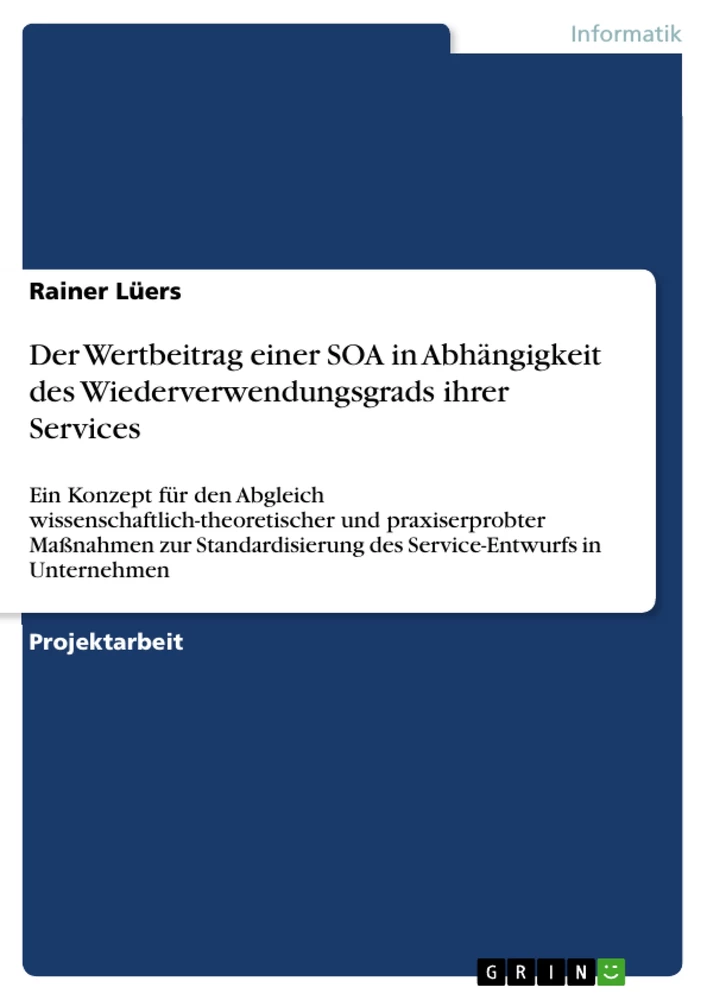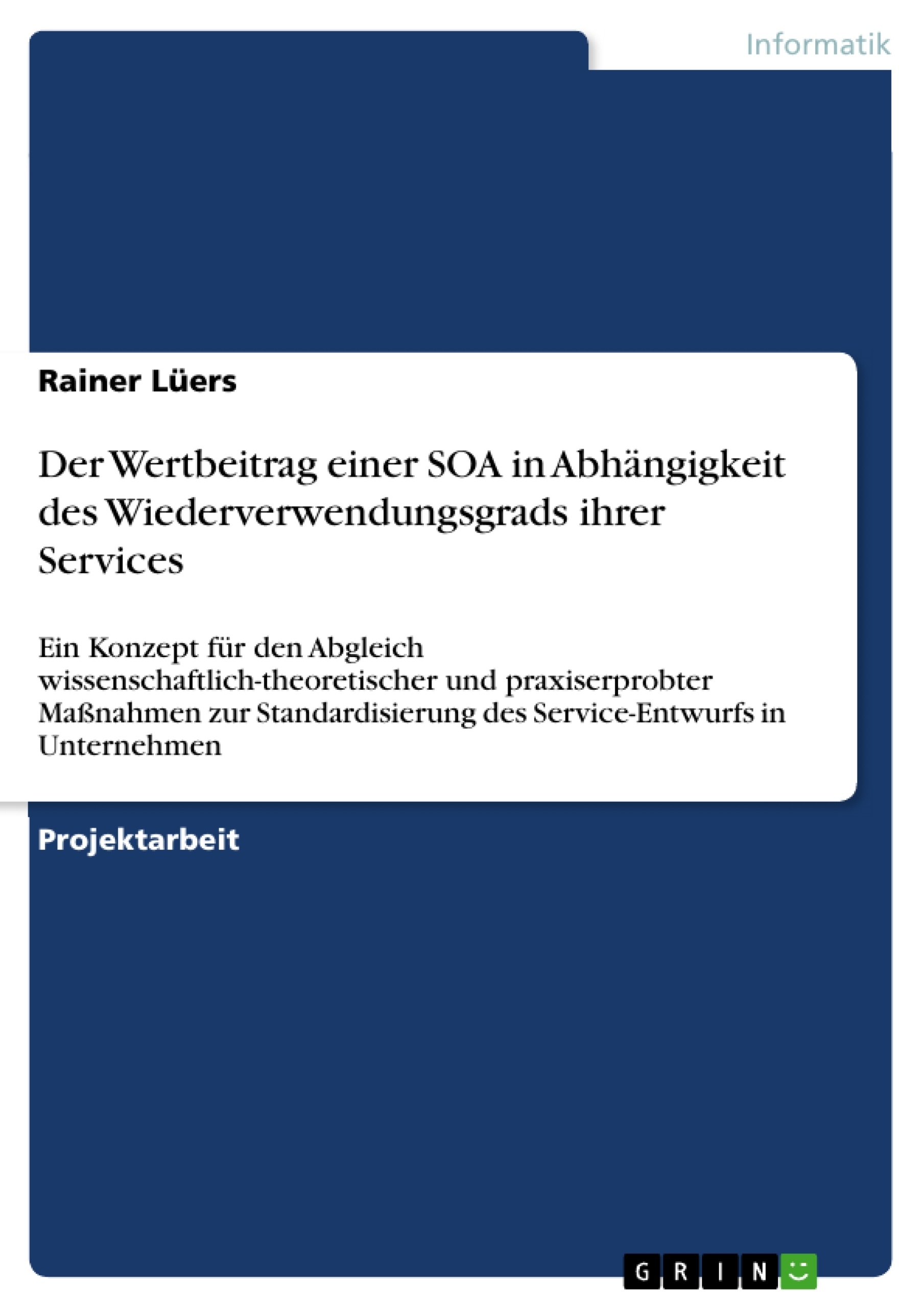Ziel serviceorientierter Softwarearchitekturen ist es, die Informationsverarbeitung in Unternehmen schneller und besser an immer volatilere Anforderungen moderner Geschäftsprozesse anpassen zu können als dies in traditionell monolithischen Architekturen möglich ist. Die zugrunde liegende Idee dabei ist, Geschäftsprozesse durch flexible und lose gekoppelte Softwaredienste (Webservices) in die IT-Landschaft zu adaptieren. Strategisch ausgerichtete Geschäftsprozessmodelle fungieren bei der Umsetzung als Bindeglied zwischen Business und IT und begründen die Forderung nach der Aufhebung künstlicher Grenzen hin zu einem interdisziplinären Lösungsansatz.
Die größten Hindernisse der Vergangenheit, wie u.a. die offenen Fragen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit (QoS) webbasierter Lösungen, die einer breiten Akzeptanz zur Umsetzung des neuen Architektur-Paradigmas in den Unternehmen im Wege standen, sind durch die Schaffung technologischer Standards beseitigt und haben dazu geführt, dass seit dem Jahr 2009 laut statistischer Erhebungen ca. 89 % aller Großunternehmen mit der Nutzung von Webservices begonnen haben (Vgl. Ried 2009, S. 38).
Agilität, Wiederverwendbarkeit und Reduzierung der IT-Kosten gehören zu den wesentlichen Potenzialen einer ausgereiften serviceorientierten Architektur. Es wäre aber falsch anzunehmen, dass die reine Existenz einer SOA bereits einen Business Case darstellt. "Zur Erinnerung: Nur ein sparsames Auto zu besitzen ist auch noch kein Business Case. Der Aufbau einer Car-Sharing-Gemeinschaft kann jedoch mit einem klaren wirtschaftlichen Vorteil rechnen ..." (Vgl. Ried 2009, S. 39).
Um einen messbaren Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg haben zu können, ist es also von größter Bedeutung, ein Service-Repository zu entwickeln, dessen kleinste Bausteine oder Orchestrierungen dieser, einen maximalen Grad an Wiederverwendbarkeit aufweisen. Webservices, die sich als bestgeeignete Technologie zur Modularisierung von Geschäftprozessen etabliert haben, ist diese Eigenschaft nicht automatisch inhärent. Vielmehr ist dies einer der neuralgischen Punkte, von denen ein langfristig zu erwartender wirtschaftlicher Nutzen einer Serviceorientierung abhängt. Die Produktion qualitativ hochwertiger Services darf nicht von glücklichen Umständen abhängen (Vgl. Erl 2008, S. 17), sondern muss im Rahmen festgelegter Regeln und standardisierter Vorgehensweisen betrieben und im Kontext einer SOA Governance fortlaufend kontrolliert werden (Vgl. Finger et al. 2009, S. 87).
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Motivation
- Ziele
- SERVICEORIENTIERTE ARCHITEKTUR
- Schlüsselkonzepte einer SOA
- Wesentliche Merkmale einer SOA
- Lose Kopplung
- Interoperabilität
- Wiederverwendung
- Komponierbarkeit
- Service-Repository
- Akteure und Rollen
- SERVICEORIENTIERUNG
- Theorie der Serviceorientierung
- Definition aus Sicht des Service-Entwurfs
- Wurzeln der Serviceorientierung
- Objektorientierung
- Webservices
- Business Process Management (BPM)
- Enterprise Application Integration (EAI)
- SERVICE
- Klassifizierung
- Basis-Service
- Daten-Service
- Logik-Service
- Komponierter-Service
- Prozess-Service
- Motivation für Webservices
- Architektur von Webservices
- Standardisierte Webservice-Technologien
- SOAP
- WSDL
- UDDI
- Sicherheitsspezifikationen
- ZWISCHENFAZIT UND VORSCHAU
- SERVICE-ENTWURF
- Governance
- Service-Lifecycle
- Service-Identifikation
- Entwurfsprinzipien im Überblick
- Standardisierter Service-Vertrag
- Lose Kopplung
- Abstraktion
- Autonomie
- Zustandslosigkeit
- Auffindbarkeit
- Kompositionsfähigkeit
- Wiederverwendbarkeit
- Wiederverwendbarkeit im Fokus
- GENERIERUNG DES DATENMATERIALS
- Literarische Erhebung
- Empirische Erhebung
- Auswahl der geeigneten Interviewtechnik
- Auswahl der Experten
- Semistrukturiertes Leitfadeninterview
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Auswahlkriterien für die Analysemethode
- Vorgang der „Inhaltlichen Strukturierung“
- Auswertung des Datenmaterials
- Ablaufmodell der Analyse
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Wiederverwendungsgrads von Services in einer Service-orientierten Architektur (SOA) für den Wertbeitrag der SOA. Ziel ist es, ein Konzept zu entwickeln, das wissenschaftlich-theoretische und praxiserprobte Maßnahmen zur Standardisierung des Service-Entwurfs in Unternehmen zusammenführt und die Steigerung der Wiederverwendbarkeit von Services fördert.
- Die Relevanz von SOA in Unternehmen
- Die Rolle der Wiederverwendbarkeit von Services
- Standardisierungsmaßnahmen für den Service-Entwurf
- Die Anwendung von theoretischen Konzepten in der Praxis
- Die Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und unternehmerischer Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Motivation und die Ziele der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der Wirtschaftsinformatik.
- Serviceorientierte Architektur: In diesem Kapitel werden die Schlüsselkonzepte und wesentlichen Merkmale einer SOA, wie lose Kopplung, Interoperabilität, Wiederverwendung und Komponierbarkeit, sowie die Bedeutung des Service-Repositorys und der Akteure in einer SOA beleuchtet.
- Serviceorientierung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Theorie der Serviceorientierung, ihrer Definition aus Sicht des Service-Entwurfs und ihren Wurzeln in der Objektorientierung, den Webservices, dem Business Process Management (BPM) und der Enterprise Application Integration (EAI).
- Service: Das Kapitel beschreibt verschiedene Service-Klassifizierungen, wie Basis-Services (Daten- und Logik-Services), komponierte Services und Prozess-Services, sowie die Motivation und Architektur von Webservices und die wichtigsten standardisierten Webservice-Technologien (SOAP, WSDL, UDDI und Sicherheitsspezifikationen).
- Zwischenfazit und Vorschau: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln zusammen und stellt die Themenschwerpunkte der folgenden Kapitel vor.
- Service-Entwurf: In diesem Kapitel werden Governance, der Service-Lifecycle, die Service-Identifikation und Entwurfsprinzipien wie standardisierte Service-Verträge, lose Kopplung, Abstraktion, Autonomie, Zustandslosigkeit, Auffindbarkeit, Kompositionsfähigkeit und Wiederverwendbarkeit diskutiert.
- Generierung des Datenmaterials: Das Kapitel erläutert die Methoden zur Datenerhebung, wie literarische Erhebung, empirische Erhebung (einschließlich der Auswahl der geeigneten Interviewtechnik, der Experten und des semistrukturierten Leitfadeninterviews) und die qualitative Inhaltsanalyse (einschließlich der Auswahlkriterien für die Analysemethode, dem Vorgang der "Inhaltlichen Strukturierung", der Auswertung des Datenmaterials und dem Ablaufmodell der Analyse).
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Serviceorientierte Architektur (SOA), Service-Entwurf, Wiederverwendbarkeit, Standardisierung, Webservices, Business Process Management (BPM), Enterprise Application Integration (EAI), Governance, Service-Lifecycle, qualitative Inhaltsanalyse, Interviewtechnik, und Experteninterview.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Serviceorientierten Architektur (SOA)?
Ziel ist es, die IT flexibler an Geschäftsprozesse anzupassen, indem lose gekoppelte Softwaredienste (Webservices) genutzt werden.
Warum ist die Wiederverwendbarkeit von Services so wichtig?
Ein hoher Wiederverwendungsgrad ist der entscheidende Faktor für den wirtschaftlichen Nutzen und den Wertbeitrag einer SOA zum Unternehmenserfolg.
Was versteht man unter "loser Kopplung"?
Es bedeutet, dass Services unabhängig voneinander funktionieren und Änderungen an einem Service keine direkten Auswirkungen auf andere haben.
Was ist SOA Governance?
SOA Governance umfasst die Regeln und standardisierten Vorgehensweisen, die den Entwurf und Betrieb von Services kontrollieren.
Welche Rolle spielen Webservices in einer SOA?
Sie sind die technologische Basis zur Modularisierung von Geschäftsprozessen und nutzen Standards wie SOAP, WSDL und UDDI.
- Quote paper
- Rainer Lüers (Author), 2010, Der Wertbeitrag einer SOA in Abhängigkeit des Wiederverwendungsgrads ihrer Services, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153589