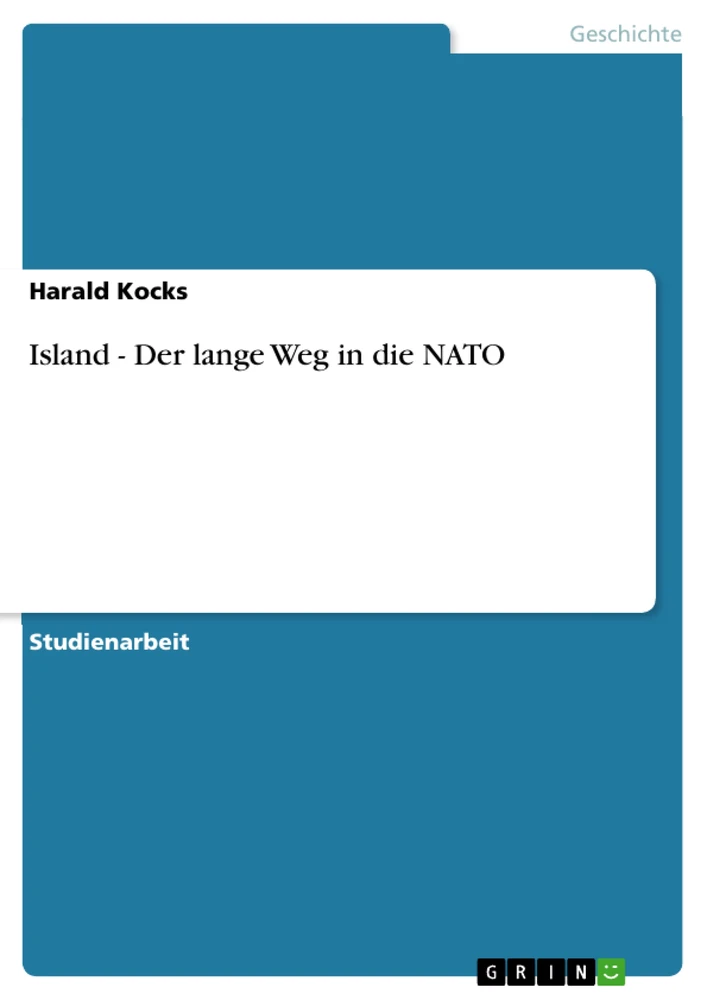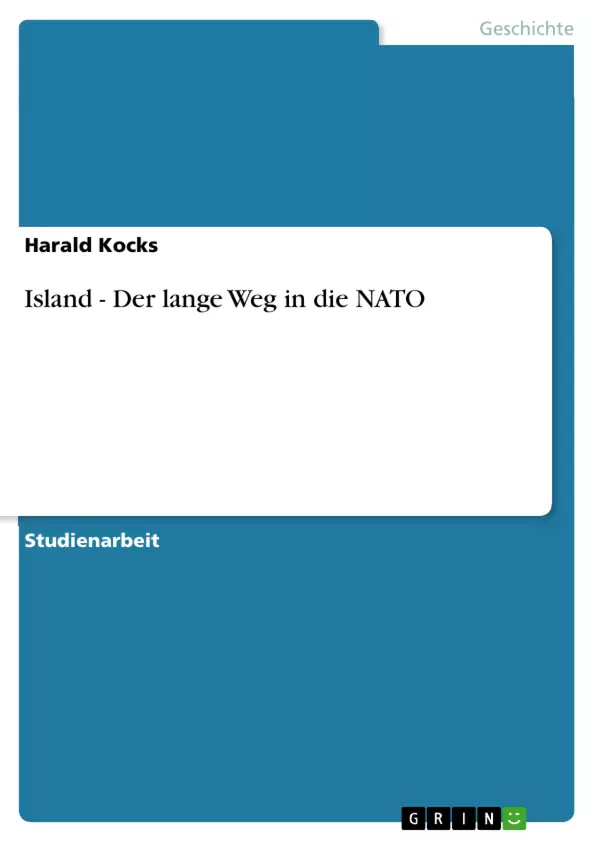„Um die Ziele dieses Vertrages besser zu verwirklichen, werden die Parteien einzeln und
gemeinsam durch ständige und wirksame Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung die
eigene und die gemeinsame Widerstandskraft gegen bewaffnete Angriffe erhalten und fortentwickeln.“
1
Artikel 3 des NATO – Vertrages verpflichtet die Mitgliedstaaten, ihre eigene und die
kollektive Sicherheit zu stärken.2 Island nimmt in dieser Formulierung eine Sonderstellung
unter den nordischen Staaten ein. Zum einen durch seine geografische Lage, als Insel im
Nordatlantik, zum anderen durch seine demographischen Gegebenheiten. Island hat eine
Fläche von 103000 km2, allerdings leben auf dieser Fläche nur 240000 Menschen.3 Dieses
verhältnismäßig kleine Land gilt es nun im Folgenden in seiner Funktion für den Kalten
Krieg zu beleuchten. Dabei wird zu klären sein, in welcher Weise Island versucht die
politischen Gegebenheiten der Zeit für seine eigenen Interessen zu nutzen und ob das
kleine Land auch gleichzeitig eine untergeordnete Stellung im Weltbündnis NATO einnimmt.
Es wird ebenso zu klären sein, ob Island seine 1918, nach der Abspaltung von
Dänemark, erklärte immerwährende Neutralität behaupten kann,4 oder ob wirtschaftliche
und politische Zwänge es zum Umschwenken seiner Politik zwingen. Ausgehend vom
Zweiten Weltkrieg wird die Arbeit sich mit der Aufnahme Islands in die NATO beschäftigen.
Es soll der Weg dorthin skizziert werden, um von diesem Ausgangspunkt die
Rolle der USA im Verteidigungswesen des Landes genauer zu betrachten. Darauf aufbauend
wird es dann darauf ankommen, das Krisenjahr 1956, im besonderen Bezug auf
Island, genauer zu betrachten. Damit steht auch der zeitliche Rahmen der Arbeit fest. Sie
wird sich vom Ende des Zweiten Weltkrieges, bis in das internationale Krisenjahr 1956
erstrecken.5 Eine zeitliche Ausdehnung würde die vertiefte Beschäftigung mit den angesprochenen
Problemfeldern verhindern. Außerdem wird die innenpolitische Entwicklung
der Parteienlandschaft nur am Rand eine Rolle spielen und ausschließlich im Zusammenhang
mit dem Krisenjahr 1956 Erwähnung finden, denn das Hauptaugenmerk dieser Arbeit
liegt auf der Einbettung Islands in die internationalen Verflechtungen dieser Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Island - Der lange Weg in die NATO
- Island im Zweiten Weltkrieg
- Keflavik - Vereinbarung
- Der NATO - Beitritt
- Island als NATO - Mitglied
- Verteidigung Islands durch die USA
- Das Krisenjahr 1956 – Kommunisten in der Regierung Islands
- Reaktionen der NATO
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Islands Rolle im Kalten Krieg, insbesondere den Weg des Landes in die NATO. Sie analysiert, wie Island die politischen Gegebenheiten für seine eigenen Interessen nutzte und welche Stellung es innerhalb der NATO einnahm. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Island seine Neutralität aufrechterhalten konnte oder ob wirtschaftliche und politische Zwänge zu einem Politikwechsel führten.
- Islands Außenpolitik im Zweiten Weltkrieg und die britische Besetzung
- Der Einfluss der USA auf Islands Verteidigung
- Die innenpolitische Krise von 1956 und deren internationale Auswirkungen
- Islands strategische Bedeutung im Nordatlantik
- Der Balanceakt zwischen Neutralität und Bündnispolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, Islands Rolle im Kalten Krieg zu untersuchen, insbesondere seinen Weg in die NATO und die damit verbundenen Herausforderungen. Es wird die Bedeutung Islands als Inselstaat im Nordatlantik hervorgehoben und die Frage nach dem Umgang mit Neutralität und Bündnispolitik im Kontext der Zeit diskutiert. Der zeitliche Rahmen der Arbeit wird auf den Zeitraum vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Krisenjahr 1956 begrenzt.
Island – Der lange Weg in die NATO: Dieses Kapitel behandelt Islands Situation während des Zweiten Weltkriegs. Der deutsche Überfall auf Dänemark und Norwegen führte zum Ende der dänischen Kontrolle über Island und zu dessen erstmaliger eigenständiger Außenpolitik. Das Kapitel beleuchtet die Annäherungsversuche Deutschlands an Island, die aufgrund des Misstrauens gegenüber dem aggressiven Vorgehen Deutschlands auf dem europäischen Festland abgelehnt wurden. Die anschließende britische Besetzung Islands wird als Bruch der isländischen Neutralität, jedoch als notwendige Maßnahme zum Schutz vor einer deutschen Invasion dargestellt. Die Zusammenarbeit zwischen Island und Großbritannien wird als pragmatisch und im gegenseitigen Interesse beschrieben, da Island vom Handel mit Großbritannien profitierte.
Schlüsselwörter
Island, Kalter Krieg, NATO, Neutralität, Zweiter Weltkrieg, USA, Britische Besetzung, Keflavík, Krisenjahr 1956, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Nordatlantik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Islands Weg in die NATO"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Islands Rolle im Kalten Krieg, insbesondere den Weg des Landes in die NATO. Sie analysiert, wie Island die politischen Gegebenheiten für seine eigenen Interessen nutzte und welche Stellung es innerhalb der NATO einnahm. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Island seine Neutralität aufrechterhalten konnte oder ob wirtschaftliche und politische Zwänge zu einem Politikwechsel führten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Islands Außenpolitik im Zweiten Weltkrieg und die britische Besetzung, den Einfluss der USA auf Islands Verteidigung, die innenpolitische Krise von 1956 und deren internationale Auswirkungen, Islands strategische Bedeutung im Nordatlantik und den Balanceakt zwischen Neutralität und Bündnispolitik.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Islands langen Weg in die NATO (inklusive der Situation im Zweiten Weltkrieg, der Vereinbarung von Keflavik und dem NATO-Beitritt), ein Kapitel über Island als NATO-Mitglied (mit den Themen Verteidigung durch die USA, der Krise 1956 und den Reaktionen der NATO) und ein Fazit.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, Islands Rolle im Kalten Krieg zu untersuchen, insbesondere seinen Weg in die NATO und die damit verbundenen Herausforderungen. Es wird die Bedeutung Islands als Inselstaat im Nordatlantik hervorgehoben und die Frage nach dem Umgang mit Neutralität und Bündnispolitik im Kontext der Zeit diskutiert. Der zeitliche Rahmen der Arbeit wird auf den Zeitraum vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Krisenjahr 1956 begrenzt.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Island – Der lange Weg in die NATO"?
Dieses Kapitel behandelt Islands Situation während des Zweiten Weltkriegs, die Ablehnung von Annäherungsversuchen Deutschlands, die britische Besetzung Islands als Bruch der isländischen Neutralität, aber auch als Schutzmaßnahme vor einer deutschen Invasion, und die pragmatische Zusammenarbeit zwischen Island und Großbritannien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Island, Kalter Krieg, NATO, Neutralität, Zweiter Weltkrieg, USA, Britische Besetzung, Keflavík, Krisenjahr 1956, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Nordatlantik.
Welchen Zeitraum umfasst die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Krisenjahr 1956.
- Citar trabajo
- Harald Kocks (Autor), 2008, Island - Der lange Weg in die NATO, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153595