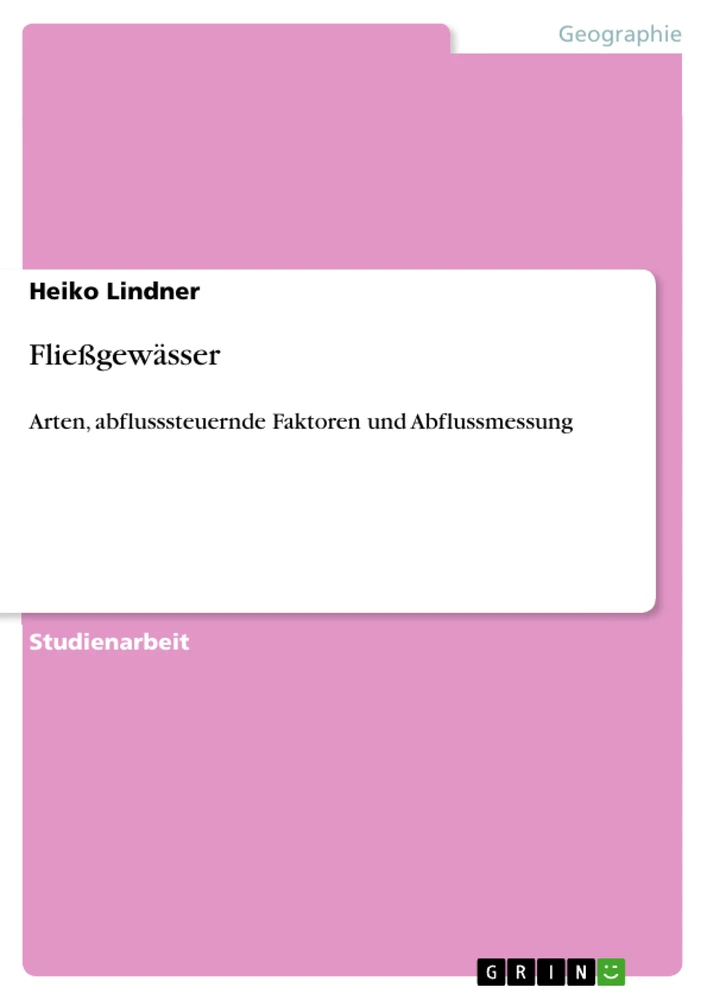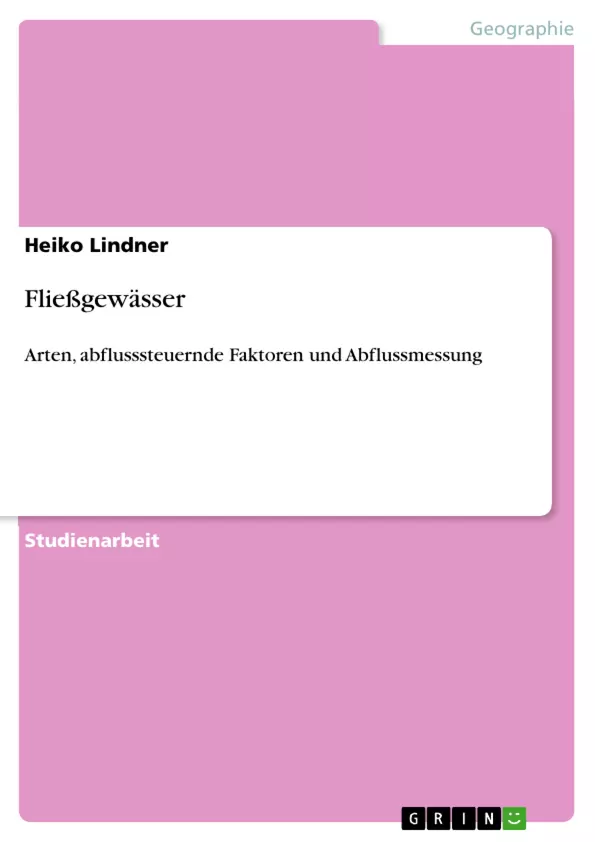Fließgewässer stellen Lebensraum und -grundlage für zahlreiche Arten - den Menschen inbegriffen - dar.
Durch fluviale Prozesse prägen Fließgewässer die Landschaft geomorphologisch.
Für den Menschen sind sie von großer Bedeutung. Frühe Siedlungen und damit heutige Städte und Großstädte entstanden an ihren Ufern. Fließgewässer stellen eine wichtige Quelle der Wasserversorgung dar und sind deshalb, und als Transportwege wichtige Standortfaktoren für die Wirtschaft.
In diesem Werk soll ein Ein- bzw. Überblick über Fließgewässer gegeben werden. Es wird sowohl auf die Arten, als auch auf abflusssteuernde Faktoren und die Messung des Abflusses eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arten von Fließgewässern
- Flussordnungen
- Abflusssteuernde Faktoren
- Bildung des Abflusses
- Abflusssteuernde Faktoren außerhalb des Gerinnebetts
- Abflusssteuernde Faktoren im Gerinnebett
- Abflussmessung
- Punktmessung mit Messflügel
- Durchflussmessung mit der Verdünnungsmethode
- Künstliche Beeinflussung des Abflusses
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Fließgewässer, ihre Arten, abflusssteuernden Faktoren und Messmethoden. Sie beleuchtet die Bedeutung von Fließgewässern für die Umwelt, den Menschen und die Wirtschaft. Im Fokus steht die Analyse der Faktoren, die den Abfluss beeinflussen, sowohl außerhalb als auch innerhalb des Gerinnebetts.
- Arten von Fließgewässern und deren Klassifizierung
- Abflussbildung und Einflussfaktoren
- Abflussmessung mit unterschiedlichen Methoden
- Künstliche Beeinflussung des Abflusses durch den Menschen
- Die Bedeutung von Fließgewässern für Mensch und Umwelt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Fließgewässern für die Umwelt, den Menschen und die Wirtschaft dar. Sie definiert den Abfluss als Schlüsselgröße für die Untersuchung von Fließgewässern.
- Arten von Fließgewässern: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Arten von Fließgewässern und ihre Klassifizierung anhand von Abflussganglinien und Quellort. Es wird zwischen perrenierenden, periodischen und episodischen Gewässern unterschieden.
- Flussordnungen: Dieses Unterkapitel beschreibt die unterschiedlichen Flussordnungen und ihre Bedeutung für die Analyse von Flussnetzen. Es werden verschiedene Methoden zur Klassifizierung von Flussnetzen erläutert.
- Abflusssteuernde Faktoren: Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die den Abfluss von Fließgewässern beeinflussen. Es wird zwischen Faktoren außerhalb und innerhalb des Gerinnebetts unterschieden.
- Bildung des Abflusses: In diesem Unterkapitel wird der Prozess der Abflussbildung erläutert. Es wird die Bedeutung von Niederschlag, Infiltration und Oberflächenabfluss für die Bildung des Abflusses dargestellt.
- Abflussmessung: Dieses Kapitel präsentiert zwei gängige Methoden zur Abflussmessung: die Punktmessung mit Messflügel und die Durchflussmessung mit der Verdünnungsmethode.
Schlüsselwörter
Fließgewässer, Abfluss, Abflusssteuerung, Flussordnungen, Abflussmessung, Gerinnebett, Niederschlag, Infiltration, Oberflächenabfluss, Punktmessung, Verdünnungsmethode, künstliche Beeinflussung.
Häufig gestellte Fragen zu Fließgewässern
Was sind Fließgewässer und welche Bedeutung haben sie?
Fließgewässer sind Lebensräume für zahlreiche Arten und dienen dem Menschen als Wasserversorgung und Transportweg. Geomorphologisch prägen sie die Landschaft durch fluviale Prozesse.
Wie werden Fließgewässer klassifiziert?
Die Klassifizierung erfolgt nach Abflussganglinien und Quellort, wobei zwischen perennierenden (ständig fließend), periodischen und episodischen Gewässern unterschieden wird.
Welche Faktoren steuern den Abfluss eines Gewässers?
Der Abfluss wird durch Faktoren innerhalb des Gerinnebetts (z. B. Rauheit) und außerhalb (z. B. Niederschlag, Infiltration und Oberflächenabfluss) beeinflusst.
Welche Methoden zur Abflussmessung gibt es?
Gängige Methoden sind die Punktmessung mit einem Messflügel sowie die Durchflussmessung mittels der Verdünnungsmethode.
Was versteht man unter Flussordnungen?
Flussordnungen dienen der hierarchischen Analyse von Flussnetzen und helfen dabei, die Struktur und Größe eines Gewässersystems zu beschreiben.
- Quote paper
- Heiko Lindner (Author), 2010, Fließgewässer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153607