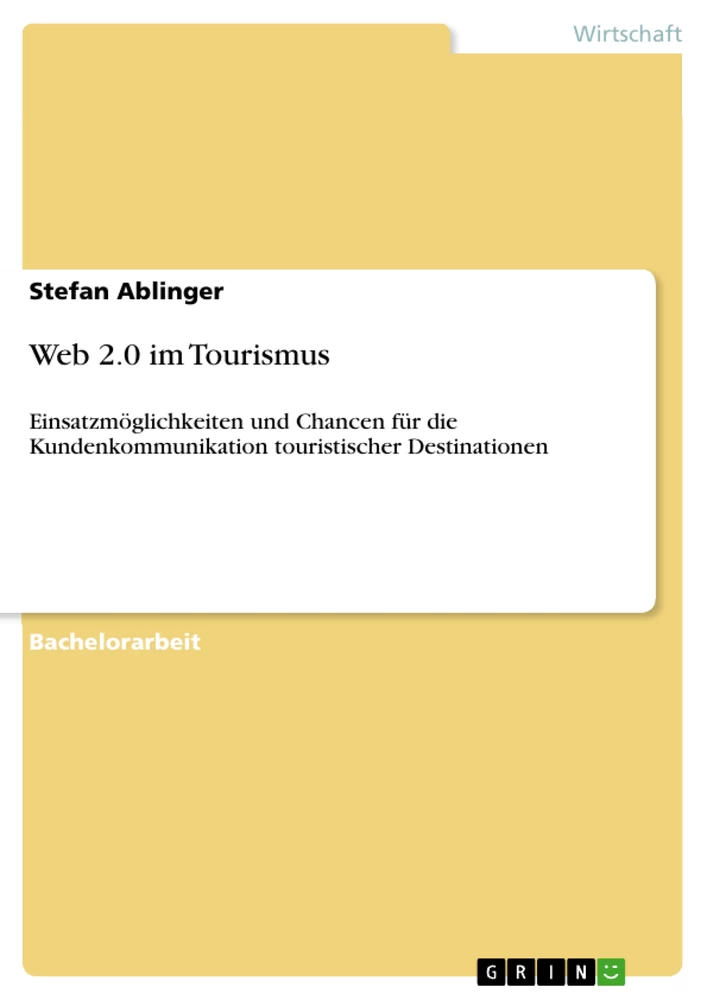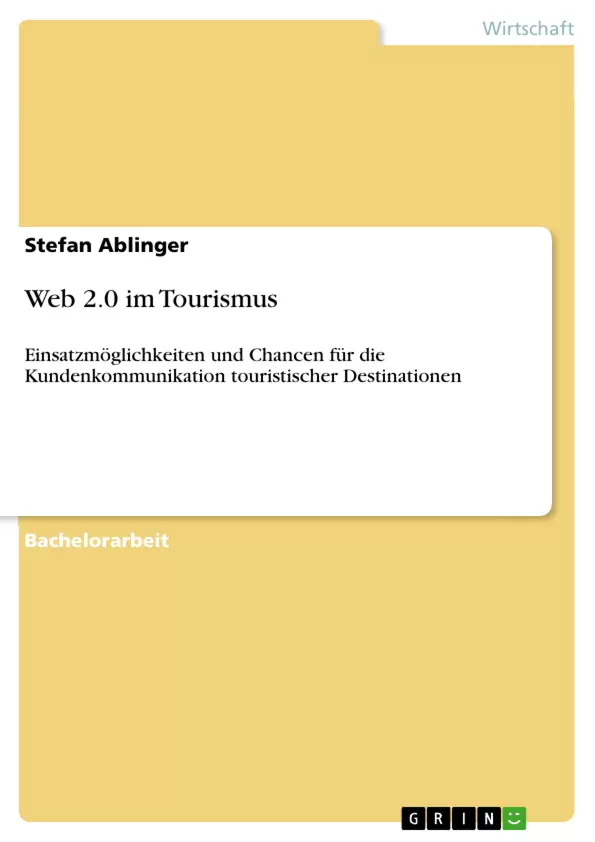Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ist heute unabdingbar. Diese Technologien sind lange nicht als nützliches Instrument für die Destinationsentwicklung angesehen worden. Nichtdestotrotz entdecken Destinationsvermarkter schrittweise die potentiellen Möglichkeiten von Web 2.0 Anwendungen. Diese Instrumente ermöglichen Reisenden, sich gegenseitig, über ihre Urlaubserfahrungen und Reiseerlebnisse, auszutauschen. Diese Gespräche sind oft entscheidend für die Wahl der nächsten Urlaubsdestination. Für touristische Destinationen ist es wichtig, diesen Dialog zu verfolgen und ihn aktiv mitzugestalten. Das Ziel dieser Arbeit war, anhand von theoretischen Grundlagen und Best Practice Beispielen zu analysieren, ob und welche Web 2.0 Tools Chancen für die Kundenkommunikation touristischer Destinationen, bieten. Im ersten Teil der Arbeit wird das Thema Web 2.0 aufgegriffen und ausführlich behandelt. Die verschiedenen Instrumente werden anhand wissenschaftlicher Literatur erklärt. Im nächsten Teil der Arbeit wird die geschaffene Basis mittels praktischer Beispiele ergänzt. Anhand der gewonnenen Informationen ist am Ende ein Optionenkatalog mit Web 2.0 Technologien, die sich speziell für touristische Destinationen eignen, entstanden. Weiters wird beschrieben, wie die Web 2.0 Anwendungen erfolgreich eingesetzt werden können. Die Arbeit hat ergeben, dass sich grundsätzlich die meisten Web 2.0 Anwendungen für den Einsatz in der Kundenkommunikation touristischer Destinationen, eignen. Um diese Instrumente erfolgreich einzusetzen, ist eine individuelle Strategie zu entwickeln. Web 2.0 Strategien basieren auf langfristigen Prozessen und nicht auf einzelnen Werkzeugen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel der Arbeit
- Forschungsfrage und Hypothesen
- Hypothesen
- Aufbau
- Theorie
- Begriffsdefinitionen
- Web 2.0
- Abgrenzung der Begriffe Social Software und Web 2.0
- Destination
- DMO
- Web 2.0
- Die sieben Kernkompetenzen des Web 2.0
- Vom Web 1.0 zum Web 2.0
- Tourismus 2.0
- Relevanz für touristische Destinationen
- Klassifikation von Web 2.0 Plattformen und Anwendungen
- Content-orientierte Web 2.0 Anwendungen
- Blogs
- Wikis
- Media Sharing Plattformen
- Plattformen zum Informationsaustausch
- Social Tagging & Social Bookmarking Plattformen
- Beziehungsorientierte Web 2.0 Anwendungen
- Virtuelle Welten
- Fallbeispiele
- Beispiele für content-orientierte Web 2.0 Anwendungen
- Blog des Lammertals
- Stadtwiki Karlsruhe
- 100% Pure New Zealand YouTube Kanal
- Geobeats
- Zell am See - Kaprun TV
- HolidayCheck @ MySwitzerland.com
- Beispiele für beziehungsorientierte Web 2.0 Anwendungen
- Oberösterreich Botschaft auf Facebook
- friends @hihostels Applikation auf Facebook
- Beispiele Virtuelle Welten
- Ergebnisse
- Beantwortung der Hypothesen
- Interpretation der Ergebnisse
- Optionenkatalog mit Web 2.0 Tools für touristische Destinationen
- Schlussbetrachtung
- Fazit
- Kritische Reflexion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einsatz von Web 2.0 Technologien in der Tourismusbranche, insbesondere für die Kundenkommunikation touristischer Destinationen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Chancen und Herausforderungen dieser neuen Technologien aufzuzeigen und einen praxisnahen Überblick über deren Einsatzmöglichkeiten zu bieten.
- Die Bedeutung und das Potenzial von Web 2.0 im Tourismus
- Die wichtigsten Web 2.0 Anwendungen und Plattformen
- Die Herausforderungen und Chancen für touristische Destinationen bei der Nutzung von Web 2.0
- Beispiele aus der Praxis, die die Anwendung von Web 2.0 im Tourismus demonstrieren
- Ein Optionenkatalog mit Web 2.0 Tools für touristische Destinationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und beschreibt die Zielsetzung sowie die Forschungsfrage. Es werden zudem die Hypothesen der Arbeit formuliert und der Aufbau der Arbeit erläutert.
Theorie
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe, wie Web 2.0, Social Software, Destination und DMO, definiert und erläutert. Außerdem werden die sieben Kernkompetenzen des Web 2.0 vorgestellt und die Entwicklung vom Web 1.0 zum Web 2.0 sowie die Relevanz des Web 2.0 für den Tourismus beleuchtet. Es werden unterschiedliche Arten von Web 2.0 Anwendungen und Plattformen, wie Blogs, Wikis, Media Sharing Plattformen, Plattformen zum Informationsaustausch, Social Tagging & Social Bookmarking Plattformen, beziehungsorientierte Anwendungen und virtuelle Welten, erläutert.
Fallbeispiele
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Fallbeispiele für den Einsatz von Web 2.0 Technologien in der Kundenkommunikation touristischer Destinationen. Es werden Beispiele für content-orientierte Anwendungen, wie Blogs, Wikis, YouTube Kanäle und Geobeats, sowie Beispiele für beziehungsorientierte Anwendungen, wie Facebook-Auftritte von Destinationen und Apps, vorgestellt. Zudem werden Beispiele für den Einsatz von virtuellen Welten im Tourismus gezeigt.
Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die Hypothesen anhand der Forschungsergebnisse beantwortet. Darüber hinaus werden die Ergebnisse interpretiert und ein Optionenkatalog mit Web 2.0 Tools für touristische Destinationen erstellt.
Schlüsselwörter
Web 2.0, Tourismus, Kundenkommunikation, Destination Management, Social Media, Social Software, Blogs, Wikis, Media Sharing, Facebook, Virtuelle Welten, Destination Marketing, Online Marketing, Tourismusmarketing
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Web 2.0 für touristische Destinationen wichtig?
Reisende tauschen sich heute intensiv online über Urlaubserfahrungen aus. Diese Gespräche beeinflussen die Wahl der nächsten Destination maßgeblich, weshalb Destinationen diesen Dialog aktiv mitgestalten sollten.
Was ist der Unterschied zwischen Web 1.0 und Web 2.0 im Tourismus?
Während Web 1.0 primär statische Informationen lieferte, ermöglicht Web 2.0 Interaktion, nutzergenerierte Inhalte (User Generated Content) und den Aufbau sozialer Netzwerke (Social Software).
Welche inhaltsorientierten Web 2.0 Anwendungen gibt es?
Dazu gehören Blogs, Wikis, Media Sharing Plattformen (wie YouTube), Plattformen zum Informationsaustausch sowie Social Tagging und Bookmarking Dienste.
Was sind Beispiele für erfolgreiches Tourismus-Marketing 2.0?
Beispiele sind der Blog des Lammertals, das Stadtwiki Karlsruhe, der YouTube-Kanal von Neuseeland oder Facebook-Applikationen von Destinationen wie Oberösterreich.
Was ist ein DMO?
DMO steht für Destination Management Organization. Diese Organisationen sind für die Vermarktung und Entwicklung einer touristischen Region verantwortlich und nutzen zunehmend Web 2.0 zur Kundenkommunikation.
- Quote paper
- Stefan Ablinger (Author), 2010, Web 2.0 im Tourismus , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153646