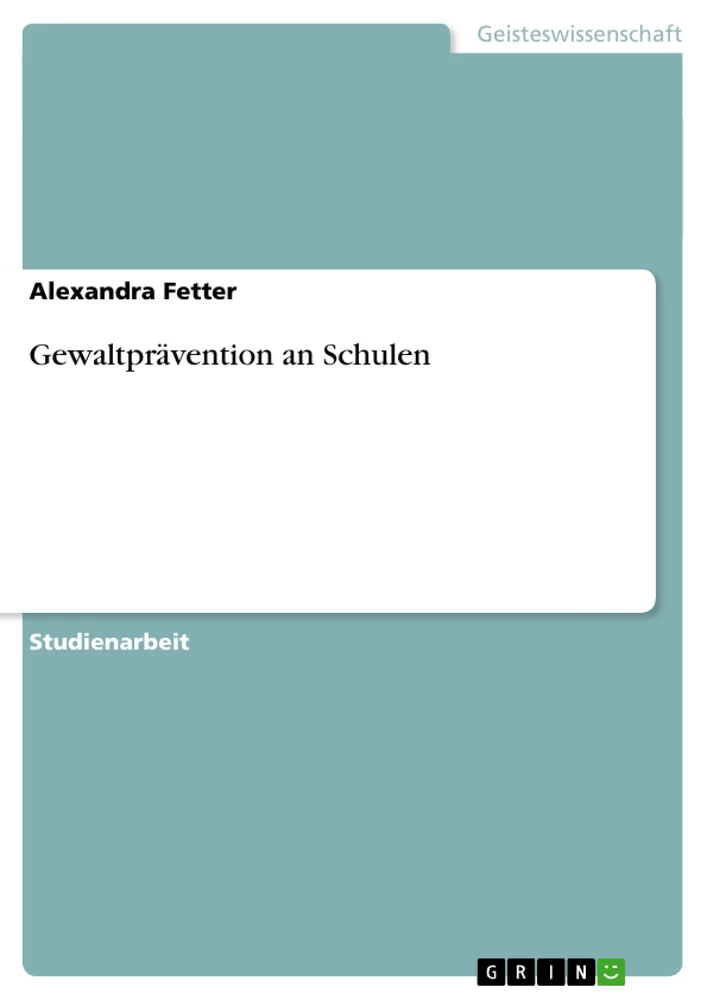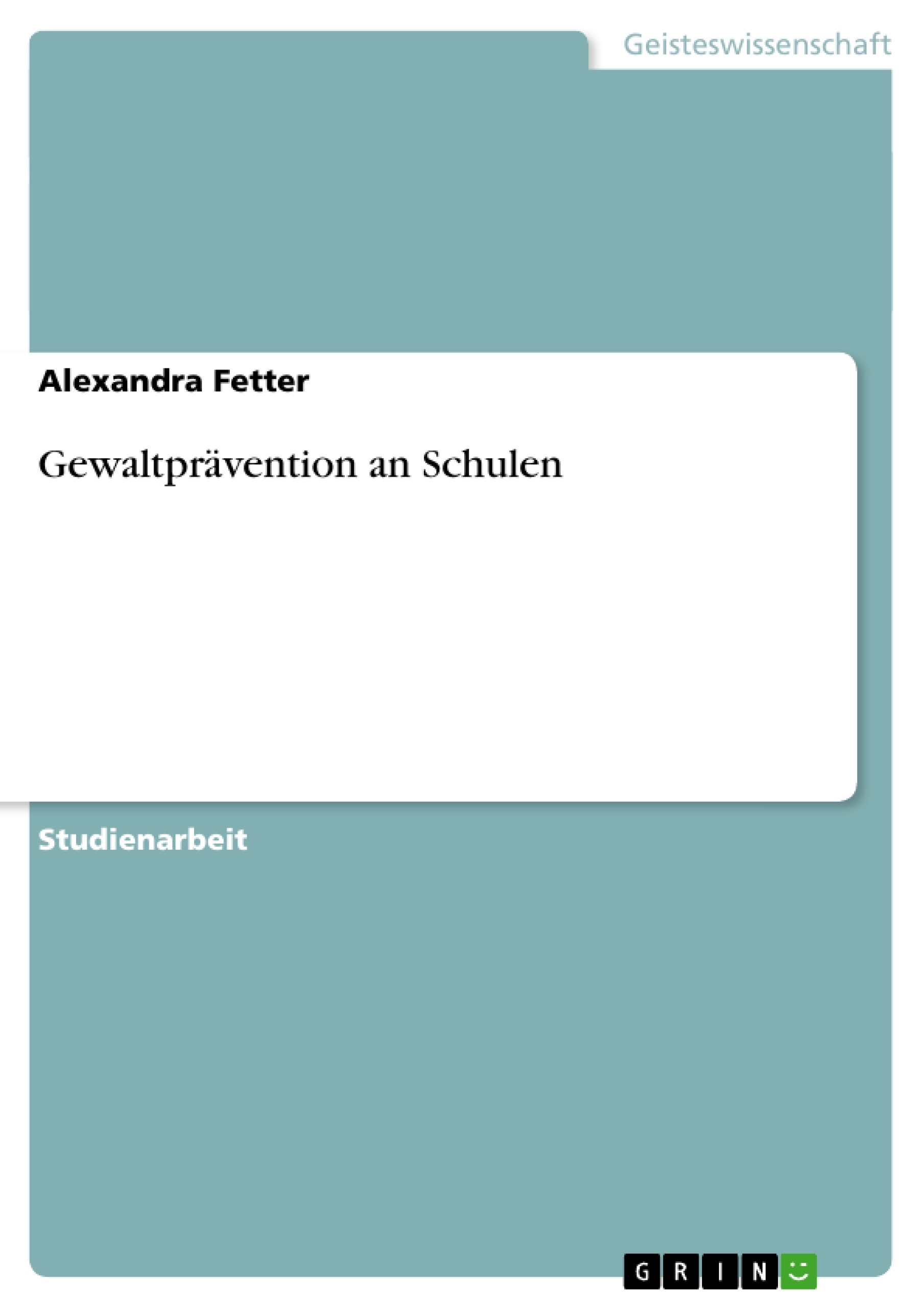In den letzten Jahren ist das Thema „Gewalt an Schulen“ immer mehr ins Zentrum sowohl der Öffentlichkeit, wie wissenschaftlicher Disskussionen gerückt. Die Enstehung von Gewalt wird anhand verschiedener Modelle mit unterschiedlichen Risikfaktoren erklärt. Studien zur Prävalenz von Aggressionen unter SchülerInnen belegen, das diesem Thema auch in Deutschland Relevanz zukommt, wobei nicht von einer extremen Brutalisierung die Rede sein kann. Im folgenden möchte ich zunächst einmal verschiedene Begriffe zu diesem Thema definieren. Auf Mobbing wird nicht explizit eingegangen, da dieser Begriff mittlerweile seine Abgrenzung in der Anwendung auf Erwachsene findet. Des weiteren erfolgt eine Unterteilung Gewaltpräventiver Massnahmen an und für Schulen. Hier sei erwähnt, das es eine Unzahl an verschiedensten gewaltpräventiven Programmen gibt, und dies lediglich eine Auswahl einiger davon ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition relevanter Begriffe
- Unterteilung von Gewalt in der Schule
- Zielformulierung der Gewaltkommission
- Warum gewaltpräventive Massnahmen an Schulen erfolgen sollten
- Unterteilung gewaltpräventiver Massnahmen
- Strukturelle & organisatorische Massnahmen
- Förderung gewaltpräventiver Kompetenzen der Lehrkräfte
- Gewaltpräventions-Programme für SchülerInnen
- Mehr-Ebenen-Konzepte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Prävention von Gewalt an Schulen. Ziel ist es, verschiedene Ansätze und Maßnahmen zur Gewaltprävention zu beleuchten und deren Wirksamkeit zu diskutieren. Der Fokus liegt auf der Entwicklung einer gewaltfreien Schulkultur.
- Definition von Gewalt und Aggression im schulischen Kontext
- Kategorisierung von Gewaltformen an Schulen (Schüler-Schüler, Schüler-Lehrer etc.)
- Analyse gewaltpräventiver Maßnahmen (strukturelle, organisatorische, pädagogische)
- Bewertung der Wirksamkeit von Präventionsprogrammen
- Rollen von Lehrkräften und Schülern in der Gewaltprävention
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Gewalt an Schulen in den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontext. Sie hebt die Relevanz des Themas in Deutschland hervor, betont aber gleichzeitig, dass keine extreme Brutalisierung vorliegt. Die Arbeit kündigt die Definition relevanter Begriffe und die Unterteilung gewaltpräventiver Maßnahmen an, wobei Mobbing explizit ausgeschlossen wird, da der Begriff seine Abgrenzung in der Anwendung auf Erwachsene findet.
Definition relevanter Begriffe: Dieses Kapitel liefert etymologische und wissenschaftliche Definitionen von Gewalt und Aggression. Es unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Aggressionen (instinktiv, ärgerbezogen, instrumental) und definiert Bullying als psychische und physische Unterdrückung Stärkerer gegenüber Schwächeren. Die Definitionen liefern eine fundierte Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema Gewaltprävention.
Unterteilung von Gewalt in der Schule: Dieses Kapitel kategorisiert Gewalt an Schulen nach den beteiligten Akteuren: Gewalt unter Schülern, Gewalt von Schülern gegen Lehrer, Gewalt gegen die Schuleinrichtung und Gewalt von Lehrern gegen Schüler. Es wird ein multikausales Bedingungsgefüge aus gesellschaftlichen, interpersonellen und intrapersonellen Faktoren hervorgehoben, und die langfristige Wirksamkeit von Präventionskonzepten im Vergleich zu Interventionsmaßnahmen betont.
Zielformulierung der Gewaltkommission: Dieses Kapitel präsentiert die Ziele der Gewaltkommission, einer unabhängigen Regierungskommission. Diese Ziele umfassen die Stärkung des Erziehungsauftrags von Schulen, die verbesserte Ausbildung von Lehrkräften im Hinblick auf ihre Erzieherrolle, die Förderung des Verantwortungsgefühls von Schülern und Lehrern und die Milderung von Frustrationen durch gezielte Unterstützung bei Leistungsdefiziten.
Warum gewaltpräventive Massnahmen an Schulen erfolgen sollten: Dieses Kapitel argumentiert für die Durchführung von Präventionsprogrammen an Schulen, da Schulen den idealen Rahmen für langfristige Projekte bieten. Der direkte und permanente Transfer des Gelernten in soziale Situationen, die Erreichbarkeit vieler Kinder, inklusive solcher aus belasteten Familien, und die Vermeidung von Stigmatisierungsprozessen werden als wichtige Vorteile genannt.
Unterteilung gewaltpräventiver Massnahmen: Dieses Kapitel gliedert gewaltpräventive Maßnahmen in strukturelle und organisatorische Maßnahmen, die Förderung gewaltpräventiver Kompetenzen bei Lehrkräften, Gewaltpräventionsprogramme für Schüler und Mehr-Ebenen-Konzepte. Dies bildet die Grundlage für die detailliertere Betrachtung in den folgenden Kapiteln.
Strukturelle & organisatorische Massnahmen: Dieses Kapitel befasst sich mit strukturellen und organisatorischen Veränderungen, wie der Neugestaltung der räumlichen Umgebung und der Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen. Es wird angemerkt, dass diese Maßnahmen bisher nicht ausreichend empirisch untersucht wurden. Beispiele für kreative Schulprojekte werden angeführt (Theatergruppen, Schülerradio etc.).
Förderung Gewaltpräventiver Kompetenzen der Lehrkräfte: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Trainingsprogramme zur Steigerung der Professionalität von Lehrkräften, wobei betont wird, dass deren Wirksamkeit bisher nicht ausreichend überprüft wurde. Es wird ein 3-jähriges Interventionskonzept und ein Trainingsprogramm zur Veränderung der subjektiven Handlungstheorien von Lehrkräften vorgestellt. Beide Programme zielen auf eine Verbesserung der Fähigkeiten der Lehrkräfte im Umgang mit Konflikten und Gewaltprävention ab.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Schule, Gewalt, Aggression, Bullying, Präventionsprogramme, Lehrkräfte, Schüler, strukturelle Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, Kompetenzförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewaltprävention an Schulen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Prävention von Gewalt an Schulen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entwicklung einer gewaltfreien Schulkultur und der Analyse verschiedener Ansätze und Maßnahmen zur Gewaltprävention.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Definition von Gewalt und Aggression im schulischen Kontext, die Kategorisierung verschiedener Gewaltformen (Schüler-Schüler, Schüler-Lehrer etc.), die Analyse gewaltpräventiver Maßnahmen (strukturelle, organisatorische, pädagogische), die Bewertung der Wirksamkeit von Präventionsprogrammen und die Rollen von Lehrkräften und Schülern in der Gewaltprävention. Mobbing wird explizit ausgeschlossen, da der Begriff seine Abgrenzung in der Anwendung auf Erwachsene findet.
Wie werden Gewaltformen an Schulen kategorisiert?
Gewalt an Schulen wird nach den beteiligten Akteuren kategorisiert: Gewalt unter Schülern, Gewalt von Schülern gegen Lehrer, Gewalt gegen die Schuleinrichtung und Gewalt von Lehrern gegen Schüler. Ein multikausales Bedingungsgefüge aus gesellschaftlichen, interpersonellen und intrapersonellen Faktoren wird hervorgehoben.
Welche Arten von gewaltpräventiven Maßnahmen werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt strukturelle und organisatorische Maßnahmen (z.B. Neugestaltung der räumlichen Umgebung, Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen), die Förderung gewaltpräventiver Kompetenzen bei Lehrkräften (mit Beispielen von Trainingsprogrammen), Gewaltpräventionsprogramme für Schüler und Mehr-Ebenen-Konzepte.
Welche Ziele verfolgt die im Dokument erwähnte Gewaltkommission?
Die Ziele der Gewaltkommission umfassen die Stärkung des Erziehungsauftrags von Schulen, die verbesserte Ausbildung von Lehrkräften in ihrer Erzieherrolle, die Förderung des Verantwortungsgefühls von Schülern und Lehrern und die Milderung von Frustrationen durch gezielte Unterstützung bei Leistungsdefiziten.
Warum sollten gewaltpräventive Maßnahmen an Schulen durchgeführt werden?
Schulen bieten den idealen Rahmen für langfristige Präventionsprojekte. Der direkte und permanente Transfer des Gelernten in soziale Situationen, die Erreichbarkeit vieler Kinder (auch aus belasteten Familien) und die Vermeidung von Stigmatisierungsprozessen werden als wichtige Vorteile genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gewaltprävention, Schule, Gewalt, Aggression, Bullying, Präventionsprogramme, Lehrkräfte, Schüler, strukturelle Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, Kompetenzförderung.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Das Dokument bietet für jedes Kapitel eine kurze Zusammenfassung, die die zentralen Inhalte und Ergebnisse darlegt. Es werden die Definitionen relevanter Begriffe erläutert, verschiedene Ansätze der Gewaltprävention detailliert beschrieben und die Wirksamkeit der Maßnahmen diskutiert.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Die Zielgruppe umfasst Wissenschaftler, Pädagogen, Schulverwaltung und alle Interessierten, die sich mit dem Thema Gewaltprävention an Schulen auseinandersetzen. Die Informationen sind für eine akademische Auseinandersetzung mit dem Thema konzipiert.
Gibt es empirische Belege für die Wirksamkeit der beschriebenen Maßnahmen?
Das Dokument weist darauf hin, dass die empirische Untersuchung der Wirksamkeit einiger Maßnahmen, insbesondere struktureller und organisatorischer Maßnahmen sowie bestimmter Trainingsprogramme für Lehrkräfte, bisher unzureichend ist.
- Citation du texte
- Alexandra Fetter (Auteur), 2003, Gewaltprävention an Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15368