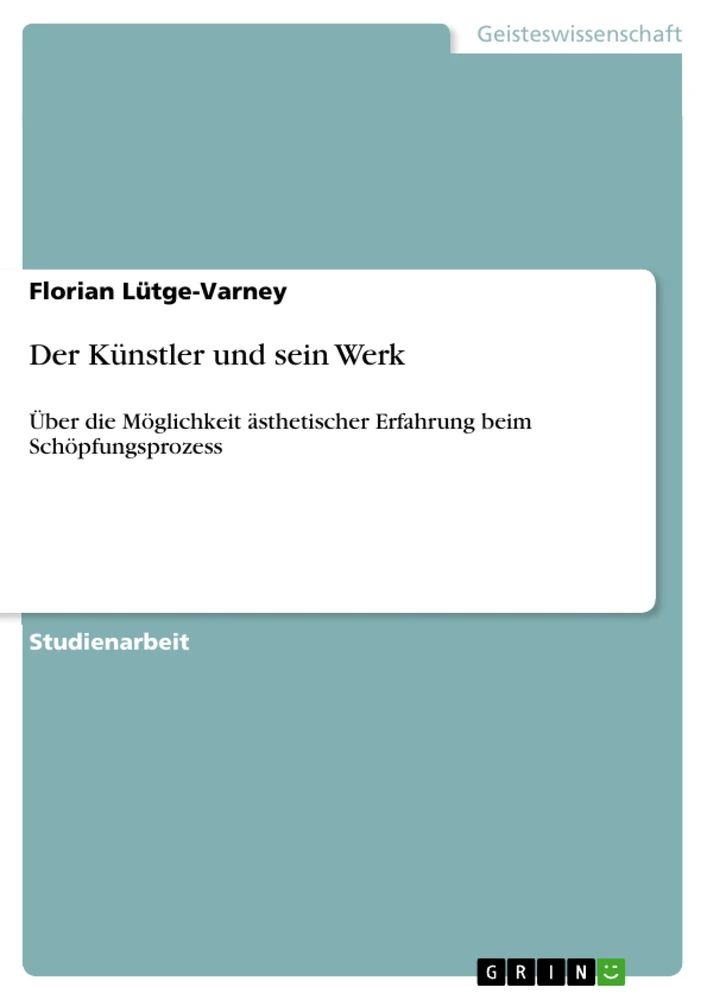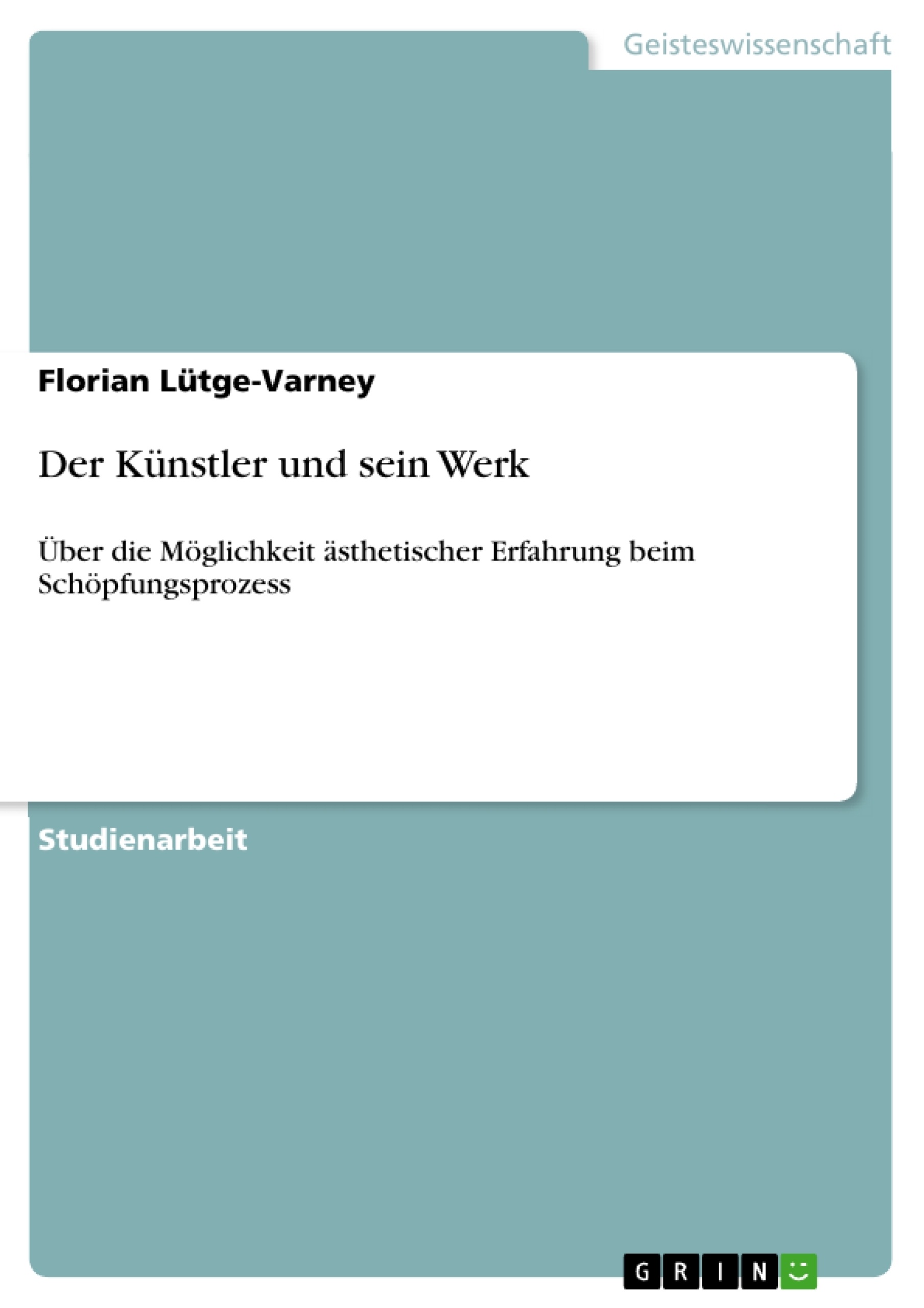Diese Arbeit fragt nach der Möglichkeit von Künstlern, mit ihren eigenen Werken ästhetische Erfahrungen zu machen. Um diese Frage in einem dritten Teil dieser Arbeit beantworten zu können, muss zunächst einmal in einem ersten Teil geklärt werden, was der Begriff der Kunst aussagt, wie nach ihm zu fragen ist und welche Berechtigung die Philosophie hat, sich mit dem Begriff der Kunst auseinanderzusetzen, um dann in einem zweiten Teil die Künste in ihren Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten in Bezug auf den zuvor erarbeiteten Kunstbegriff zu betrachten, damit alles Nötige geklärt ist, um die oben formulierte Kernfrage zu beantworten.
Zu Beginn des ersten Teils wird intuitiv die Frage „Was ist Kunst?“ gestellt, um ihre Inadäquatheit aufzuzeigen und dadurch zu der eigentlichen Frage nach der Kunst zu kommen: „Was ist der Wert der Kunst?“ Diese Frage wird am Ende dieses ersten Teils beantwortet sein.
Der zweite Teil befasst sich mit der Unterschiedlichkeit und den Gemeinsamkeiten der einzelnen Künste und wird aufzeigen, dass die Künste in einem Spannungsfeld ästhetischer Medien und Verfahrensweisen, unter einem Begriff der Kunst als Beziehungsgefüge der Künste, bestehen.
Letztendlich wird im dritten Teil die Kernfrage dieser Arbeit erstmalig aufgegriffen und anhand der Vorarbeit aus den ersten beiden Teilen schnell zu beantworten sein. Die zu beweisende These lautet: Wenn ein Künstler seine Werke während des Schöpfungsprozesses als ästhetisches Selbstverständigungsgeschehen erfahren will, sollte er seine Werke der bloßen Handlung des Schöpfens wegen und aus keinem anderen Zwecke schaffen. Um sein eigenes Schaffen als Werk ästhetisch erfahren zu können, muss dieses Schaffen frei von jedem gesetzten Zweck und das Werk beim Künstler selbst als solches umstritten sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über die Frage nach der Kunst
- Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Künsten
- Über die Erfahrung des Künstlers mit seinem eigenen Werk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit für Künstler, ästhetische Erfahrungen mit ihren eigenen Werken während des Schöpfungsprozesses zu machen. Sie argumentiert, dass diese Erfahrung möglich ist, wenn Künstler ihre Werke aus reiner Schaffensfreude und nicht aus einem vorgegebenen Zweck kreieren.
- Definition und Wesen der Kunst
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Kunstformen
- Die Rolle des Künstlers im Schöpfungsprozess
- Die Bedeutung von Zweckfreiheit für ästhetische Erfahrungen
- Die Beziehung zwischen Künstler und Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Möglichkeit ästhetischer Erfahrungen von Künstlern mit ihren eigenen Werken. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der in drei Teile gegliedert ist: die Definition des Kunstbegriffs, die Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Künsten und die Beantwortung der Kernfrage.
Über die Frage nach der Kunst
Dieses Kapitel untersucht die Frage nach dem Wesen der Kunst und argumentiert, dass die traditionelle Frage „Was ist Kunst?“ unzureichend ist. Es wird vorgeschlagen, die Frage nach dem Wert der Kunst zu stellen, um die Umstrittenheit des Kunstbegriffs zu beleuchten.
Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Künsten
Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Kunstformen und zeigt auf, dass sie sich in einem Spannungsfeld ästhetischer Medien und Verfahrensweisen befinden. Es wird argumentiert, dass der Kunstbegriff als ein Beziehungsgefüge der Künste verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der ästhetischen Erfahrung im Schöpfungsprozess. Dabei werden zentrale Begriffe wie Kunstbegriff, ästhetisches Selbstverständnis, Zweckfreiheit, Schöpfungsprozess und Künstler-Werk-Beziehung beleuchtet. Die Arbeit bezieht sich auf kunstphilosophische Werke von Georg W. Bertram und Martin Heidegger.
Häufig gestellte Fragen
Kann ein Künstler mit seinem eigenen Werk eine ästhetische Erfahrung machen?
Ja, die Arbeit beweist, dass dies möglich ist, wenn der Künstler das Werk um des reinen Schöpfungsprozesses willen und ohne äußeren Zweck erschafft.
Warum ist "Zweckfreiheit" für den Künstler so wichtig?
Nur wenn das Schaffen frei von gesetzten Zwecken ist, kann der Künstler sein eigenes Werk als ein "ästhetisches Selbstverständigungsgeschehen" erfahren.
Was ist die Inadäquatheit der Frage "Was ist Kunst?"?
Die Arbeit argumentiert, dass die Frage nach dem "Wert der Kunst" zielführender ist, um das Wesen und die Bedeutung künstlerischen Schaffens zu verstehen.
Welche Rolle spielt der Schöpfungsprozess in dieser Analyse?
Der Prozess des Erschaffens wird als zentraler Moment gesehen, in dem die Beziehung zwischen Künstler und Werk definiert wird.
Auf welche Philosophen stützt sich die Arbeit?
Die Untersuchung bezieht sich unter anderem auf kunstphilosophische Ansätze von Georg W. Bertram und Martin Heidegger.
- Arbeit zitieren
- Florian Lütge-Varney (Autor:in), 2007, Der Künstler und sein Werk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153683