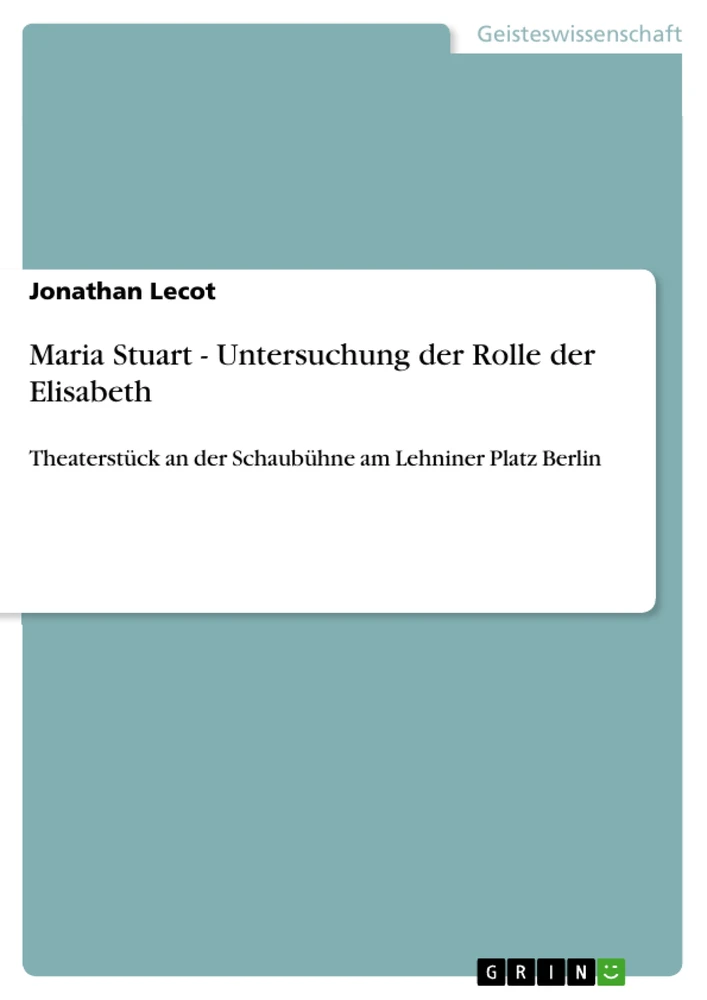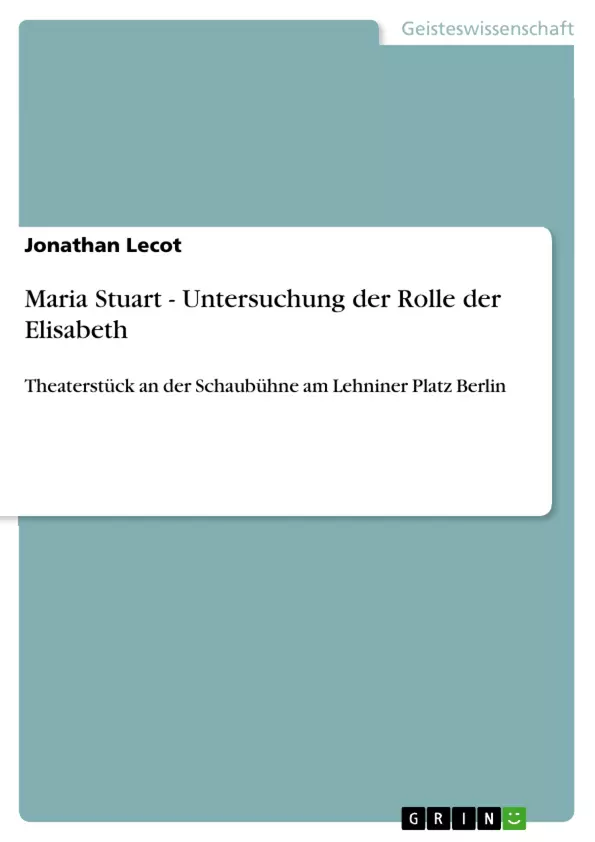„Der Mensch muss wie alle Tiere jagen um zu überleben. Im Unterschied zu den Tieren, jagt er allerdings seine eigene Sorte. Jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens entweder Jäger oder Gejagter. Manchmal auch Beides zur gleichen Zeit.“ (Luk Perceval)
Der Kampf um Respekt und Ansehen von Menschen in ihrem sozialen Umfeld ist laut Theatermacher Luk Perceval eines der wichtigsten Themen seiner Inszenierung von ‚Maria Stuart’, die am 11. Februar 2006 in der Schaubühne am Lehniner Platz Premiere feierte.
Nach einer Projektpräsentation von Bühnenbildstudenten aus Straßburg, hatte ich das Glück, ihn persönlich kennenzulernen und nutzte die Gelegenheit, um mit ihm über seine aktuelle Inszenierung zu diskutieren.
In unserem Gespräch beschrieb Perceval die Elisabeth unter anderem als „ewige unermüdliche Kämpferin“ und bezeichnte sie als „die Starke und Mächtige“ in seiner Inszenierung. Über diese Aussage war ich sehr überrascht, da ich Elisabeth im Stück ganz und gar nicht als reine Kämpfernatur empfunden habe. Die Behauptung hat micht dazu inspiriert, zu untersuchen, wie Percevel die Figur der Elisabeth (gespielt von Jule Böwe) konzipiert hat und mich insbesondere mit dem Aspekt des „Kämpferischen“ in Elisabeth kritisch auseinanderzusetzen. Meiner Meinung nach wird Elisabeth durchgängig auch als schwach und verletzlich dargestellt.
In der folgenden Arbeit werde ich zunächst Aspekte des Stückes betrachten, durch die Elisabeth als mächtig und stark gezeigt wird. Dazu gehe ich von der Szene aus, in der sie ihren ersten Bühnenauftritt hat und betrachte diese näher. Andererseits sehe ich in derselben Szene auch viele Anzeichen der Schwäche, die im zweiten Teil meiner Hausarbeit angeführt werden sollen. In Bezug auf die Konzipierung, betrachte ich Elisabeths Auftreten, d.h. Kostüm und ihre Stimme.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. These: Elisabeth, die „Starke, Mächtige“ und „unermüdliche Kämpferin“ des Stückes
- 1.1 Der erste Auftritt
- 1.2 Macht
- 1.3 Elisabeths Erscheinungsbild
- 1.4 Präsenz
- 2. Antithese: Die Schwäche der Elisabeth
- 2.1 Erster Auftritt
- 2.2 Angst vor Verantwortung
- 2.3 Elisabeths besondere Beziehung zu Leicester
- 2.4 Weitere Momente der Schwäche
- 2.5 Kleidung
- 3. Synthese und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die widersprüchliche Darstellung Elisabeths in Luk Percevals Inszenierung von Maria Stuart. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, inwiefern Elisabeths Figur sowohl Stärke und Macht als auch Schwäche und Verletzlichkeit verkörpert. Die Arbeit basiert auf Beobachtungen der Aufführung an der Schaubühne am Lehniner Platz im Februar 2006.
- Elisabeths Machtdemonstration und ihre Strategien der Selbstinszenierung
- Die Ambivalenz von Elisabeths Figur: Stärke und Schwäche
- Elisabeths Beziehung zu Leicester und deren Einfluss auf ihre Entscheidungen
- Die Rolle des Publikums und die Inszenierung von Macht und Ohnmacht
- Die Inszenierung von Weiblichkeit und Macht im Kontext der politischen Verhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Diskrepanz zwischen Percevals Beschreibung Elisabeths als „ewige unermüdliche Kämpferin“ und der Wahrnehmung der Figur als schwach und verletzlich. Die Autorin kündigt ihre Absicht an, Aspekte der Inszenierung zu analysieren, die sowohl Elisabeths Stärke als auch ihre Schwäche belegen, wobei der Fokus auf ihrem ersten Auftritt und ihrer Erscheinung liegt. Die Einleitung verankert die Arbeit in der persönlichen Erfahrung der Autorin und ihrer Auseinandersetzung mit Percevals Inszenierung.
1. These: Elisabeth, die „Starke, Mächtige“ und „unermüdliche Kämpferin“ des Stückes: Dieses Kapitel analysiert Szenen, in denen Elisabeth als mächtig und stark dargestellt wird. Der erste Auftritt Elisabeths wird detailliert beschrieben: Ihre physische Präsenz, ihre Interaktion mit den Hofbeamten, ihre Entschlossenheit und ihr Umgang mit den französischen Gesandten zeigen eine dominante und selbstbewusste Figur. Die Autorin argumentiert, dass Elisabeths Fähigkeit, die Situation zu kontrollieren, ihre Entscheidungen zu treffen und ihren Willen durchzusetzen, ihre Macht demonstriert. Ihr Selbstbewusstsein und ihre unerschütterliche Haltung unterstreichen ihr starkes Auftreten.
2. Antithese: Die Schwäche der Elisabeth: Dieses Kapitel beleuchtet die Aspekte der Inszenierung, die Elisabeths Schwäche und Verletzlichkeit aufzeigen. Obwohl sie auf der Bühne als mächtig agiert, offenbart sich ihre Unsicherheit in ihren Entscheidungen und ihrer Abhängigkeit von den Ratschlägen der Männer. Die Autorin untersucht Elisabeths besondere Beziehung zu Leicester als Beispiel für ihre emotionale Verletzlichkeit und ihre Zweifel. Das Kapitel deutet darauf hin, dass Elisabeths scheinbare Stärke eine Fassade sein könnte, die ihre inneren Konflikte und Unsicherheiten verdeckt. Ihre Kleidung und ihr Auftreten werden als Indikatoren ihrer inneren Zerrissenheit interpretiert.
Schlüsselwörter
Maria Stuart, Luk Perceval, Schaubühne am Lehniner Platz, Elisabeth I., Macht, Schwäche, Inszenierung, Weiblichkeit, Politik, Selbstinszenierung, Leicester, Kämpferin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Figur Elisabeth in Luk Percevals Inszenierung von Maria Stuart
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert die widersprüchliche Darstellung der Figur Elisabeth I. in Luk Percevals Inszenierung von Maria Stuart an der Schaubühne am Lehniner Platz (Februar 2006). Der Fokus liegt auf der Ambivalenz von Elisabeths Charakter: Ihre gleichzeitige Stärke, Macht und ihre Schwäche, Verletzlichkeit.
Welche These wird aufgestellt?
Die Analyse untersucht die These, dass Elisabeth sowohl als „starke, mächtige und unermüdliche Kämpferin“ als auch als schwache und verletzliche Figur dargestellt wird. Diese widersprüchlichen Aspekte werden anhand von konkreten Szenen und Inszenierungsdetails untersucht.
Welche Aspekte der Inszenierung werden betrachtet?
Die Analyse bezieht sich auf Elisabeths ersten Auftritt, ihre physische Präsenz, ihre Interaktion mit anderen Figuren (insbesondere Leicester), ihre Kleidung, ihre Entscheidungen und ihre Strategien der Selbstinszenierung. Die Rolle des Publikums und die Inszenierung von Macht und Ohnmacht werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Analyse strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Eine Einleitung, ein Kapitel zur These (Elisabeth als starke Figur), ein Kapitel zur Antithese (Elisabeth als schwache Figur) und eine Synthese/ein Resümee. Die Kapitel analysieren Szenen, die Elisabeths Stärke und Schwäche belegen, wobei der Fokus auf ihrem ersten Auftritt und ihrem Erscheinungsbild liegt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Maria Stuart, Luk Perceval, Schaubühne am Lehniner Platz, Elisabeth I., Macht, Schwäche, Inszenierung, Weiblichkeit, Politik, Selbstinszenierung, Leicester, Kämpferin.
Welche Beziehung hat Elisabeth zu Leicester?
Elisabeths Beziehung zu Leicester wird als Beispiel für ihre emotionale Verletzlichkeit und ihre Zweifel untersucht. Diese Beziehung wird als Indikator für ihre inneren Konflikte und Unsicherheiten interpretiert.
Wie wird Elisabeths Machtdemonstration dargestellt?
Elisabeths Machtdemonstration wird durch ihre Fähigkeit, die Situation zu kontrollieren, ihre Entscheidungen zu treffen und ihren Willen durchzusetzen, gezeigt. Ihre physische Präsenz, Interaktion mit Hofbeamten und französischen Gesandten und ihre unerschütterliche Haltung unterstreichen ihr starkes Auftreten.
Wie wird Elisabeths Schwäche dargestellt?
Elisabeths Schwäche wird durch ihre Unsicherheit in ihren Entscheidungen, ihre Abhängigkeit von den Ratschlägen der Männer und ihre emotionale Verletzlichkeit in ihrer Beziehung zu Leicester offenbart. Ihre Kleidung und ihr Auftreten werden als Indikatoren ihrer inneren Zerrissenheit interpretiert.
Wo findet man die Quelle dieser Analyse?
Die Analyse basiert auf Beobachtungen der Aufführung von Luk Percevals Inszenierung von Maria Stuart an der Schaubühne am Lehniner Platz im Februar 2006.
Was ist das Fazit der Analyse?
Das Fazit (Synthese/Resümee) fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine abschließende Betrachtung der widersprüchlichen Darstellung Elisabeths in der Inszenierung.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Jonathan Lecot (Autor:in), 2006, Maria Stuart - Untersuchung der Rolle der Elisabeth, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153723