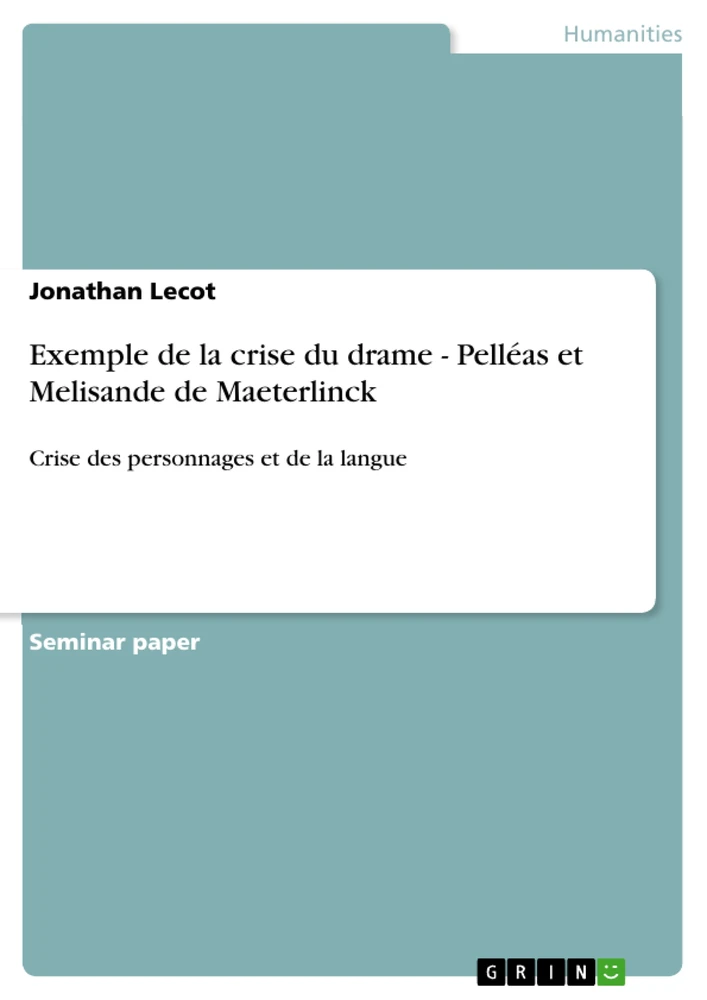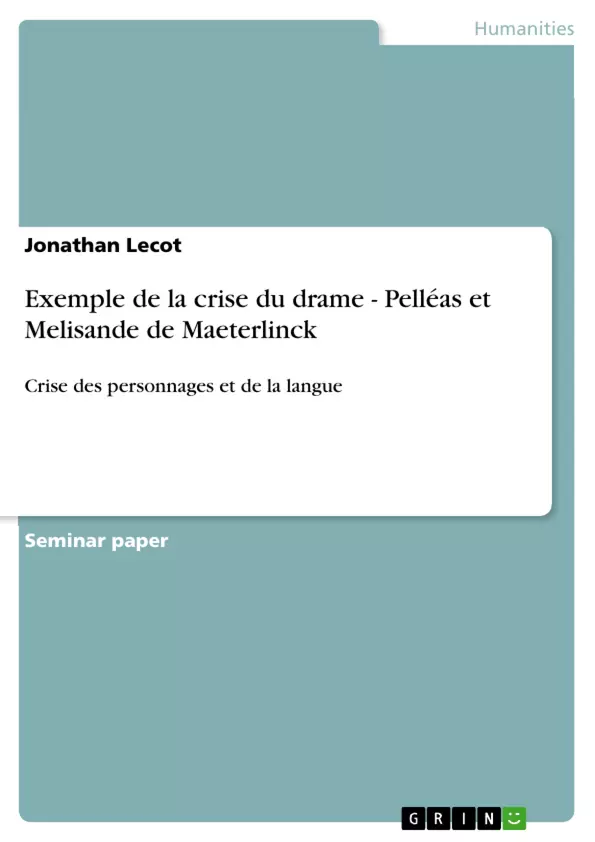L’écrivain belge Maurice Maeterlinck (1862-1949) fait partie des grands dramaturges, qui, à la fin du 19ième siècle, ont contribué à transformer la conception du drame.
Il invente son propre théâtre tragique pour marionnettes et met en cause ou bien supprime les conventions du théâtre traditionnel et tout ce qui détourne l’homme du spectacle de sa condition mortelle.
Maurice Maeterlinck est considéré comme l’un des grands poètes symbolistes.
Ses pièces sont empreintes de l’atmosphère désesperante de la fin du monde que ressent la génération avant la Premiere Guerre mondiale.
Il a été influencé par Novalis, par E. A. Poe, par le mysthyque Ruysboerck du 14ième siècle ainsi que par le théâtre elisabéthien de Shakespeare
Sa pièce « Pelléas et Mélisande » (1892) a fait date. De toutes les pièces de Maeterlinck elle est sans doute la plus personnelle et la plus envoûtante. Le thème proche de Roméo et Juliette mais encore plus du mythe celtique de Tristan et Iseut ainsi que du Liebestod wagnérien, met en scène le trio du mari, de la femme et de l’amant. Nous ne conaissons pas le passé des personnages. Tout commence, dans une forêt, où Golaud est perdu alors qu'il chassait et rencontre Mélisande en pleurs au bord de l’eau. Golaud l’épouse et l'emmène avec lui dans son château, où se trouve son frère, Pelléas. Avec le temps Mélisande et Pelléas tombent amoureux, mais tout n'est que non-dits, ils avouent qu'à la fin leur amour, où ils sont surpris par Golaud, fou de jalousie, qui tue Pelléas. Peu après Mélisande meurt aussi dans son lit dans le château. La fable est simple mais le vrai drame se joue à l’insu des personnages. Elle perd sa banalité dans l’atmosphère inquiétante et étrange, avec des nombreux symboles.
La pièce « Pelléas et Mélisande » montre très bien la rupture avec le théâtre classique. Je traiterai un aspect de la crise du drame, en regardant de plus près des personnages.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Introduction
- 2. La crise du personnage
- a) Quelques faits sur les personnages
- b) Perte des caractéristiques humaines
- c) Impossibilité de l'analyse psychologique
- d) Personnes errantes
- e) Immobilisme
- e1) Golaud
- e2) Pelléas
- e3) Arkel et Genviève
- e4) Mélisande
- f) Contradictions entre les propos et les actions des personnages
- g) Somnambules en osmose avec univers
- h) Peur métaphysique et le personnage sublime
- i) Marionnettes
- 3. Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Krise des Dramas am Beispiel von Maeterlincks "Pelléas und Mélisande". Das Hauptziel ist es, die Veränderungen der Figurenkonzeption im späten 19. Jahrhundert aufzuzeigen und die spezifischen Merkmale der Figuren in Maeterlincks Stück zu analysieren.
- Die Krise des traditionellen Theatercharakters
- Der Verlust menschlicher Eigenschaften bei den Figuren
- Die Rolle der Sprache und Kommunikation im Drama
- Die symbolische Bedeutung der Figuren und ihrer Handlungen
- Der Einfluss des Symbolismus auf die Darstellung der Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Introduction: Die Einleitung stellt Maurice Maeterlinck als bedeutenden Dramatiker des späten 19. Jahrhunderts vor, der die Konventionen des traditionellen Theaters in Frage stellte und ein neues, symbolistisches Verständnis des Dramas entwickelte. "Pelléas und Mélisande" wird als Schlüsselwerk hervorgehoben, das die Merkmale dieses neuen dramatischen Ansatzes besonders deutlich zeigt. Der Fokus der Arbeit wird auf die Analyse der Figuren und deren Krise gelegt.
2. La crise du personnage: Dieses Kapitel analysiert die Krise des dramatischen Charakters in Maeterlincks "Pelléas und Mélisande". Es zeigt, wie die Figuren ihre traditionellen Funktionen verlieren und sich durch Passivität, Unfähigkeit zur psychologischen Analyse und marionettenhaftes Verhalten auszeichnen. Die Namen der Figuren, ihre soziale Stellung und ihre Kommunikation werden als Ausdruck dieser Krise betrachtet. Beispiele aus dem Stück veranschaulichen das unnatürliche Verhalten der Figuren, ihre fehlende Interaktion und deren fast schon unmenschliche Darstellung. Die Sprache der Figuren ist einfach und kindlich, im Gegensatz zu dem was man von ihrem sozialen Status erwarten würde, was ebenfalls zur Krise des Charakters beiträgt. Die Figuren wirken entseelt und nah am Tod.
Schlüsselwörter
Maurice Maeterlinck, Pelléas und Mélisande, Krise des Dramas, Symbolismus, Figurencharakter, dramatische Konventionen, Psychologie, Sprache, Marionetten, Tod, Mysterium.
Häufig gestellte Fragen zu "Pelléas und Mélisande": Eine Analyse der Figurenkrise
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Krise des dramatischen Charakters in Maurice Maeterlincks Stück "Pelléas und Mélisande". Sie untersucht, wie die Figuren von Maeterlinck die traditionellen Konventionen des Theaters brechen und welche spezifischen Merkmale ihre Charaktere aufweisen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Krise des traditionellen Theatercharakters, den Verlust menschlicher Eigenschaften bei den Figuren, die Rolle der Sprache und Kommunikation, die symbolische Bedeutung der Figuren und Handlungen, sowie den Einfluss des Symbolismus auf die Figurendarstellung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Passivität, der Unfähigkeit zur psychologischen Analyse und dem marionettenhaften Verhalten der Figuren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: einer Einleitung, einem Hauptteil ("La crise du personnage"), der die Figurenkrise detailliert analysiert, und einer Schlussfolgerung. Der Hauptteil unterteilt sich in verschiedene Unterkapitel, die Aspekte wie die fehlende menschliche Tiefe, die Widersprüche zwischen Worten und Taten, die Kommunikationsprobleme und die symbolische Bedeutung der Figuren beleuchten.
Wie werden die Figuren in "Pelléas und Mélisande" dargestellt?
Die Figuren in Maeterlincks Stück werden als passiv, unfähig zur Selbstreflexion und fast marionettenhaft dargestellt. Sie zeigen einen Mangel an menschlicher Tiefe und ihre Kommunikation ist oft unverständlich oder bedeutungslos. Ihre Sprache ist einfach und kindlich, im Widerspruch zu ihrem sozialen Status. Das Stück betont deren Entseelung und Nähe zum Tod.
Welche Rolle spielt der Symbolismus in dem Stück?
Der Symbolismus spielt eine zentrale Rolle in der Darstellung der Figuren und ihrer Handlungen. Die Figuren und ihre Beziehungen zueinander sind symbolisch aufgeladen und tragen zu der geheimnisvollen und mehrdeutigen Atmosphäre des Stückes bei. Die Arbeit untersucht den Einfluss des Symbolismus auf die Interpretation der Figurenkrise.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Maurice Maeterlinck, Pelléas und Mélisande, Krise des Dramas, Symbolismus, Figurencharakter, dramatische Konventionen, Psychologie, Sprache, Marionetten, Tod, Mysterium.
Was ist das zentrale Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, die Veränderungen der Figurenkonzeption im späten 19. Jahrhundert aufzuzeigen und die spezifischen Merkmale der Figuren in Maeterlincks "Pelléas und Mélisande" zu analysieren, um so die Figurenkrise im Stück zu beleuchten.
- Quote paper
- Dipl. Jonathan Lecot (Author), 2008, Exemple de la crise du drame - Pelléas et Melisande de Maeterlinck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153735