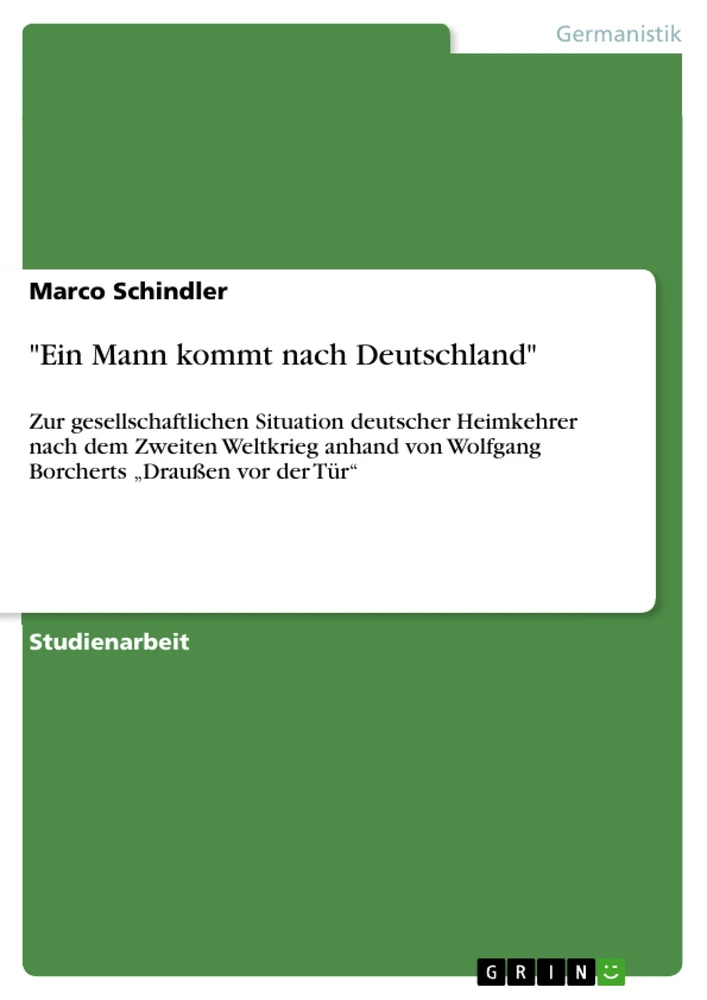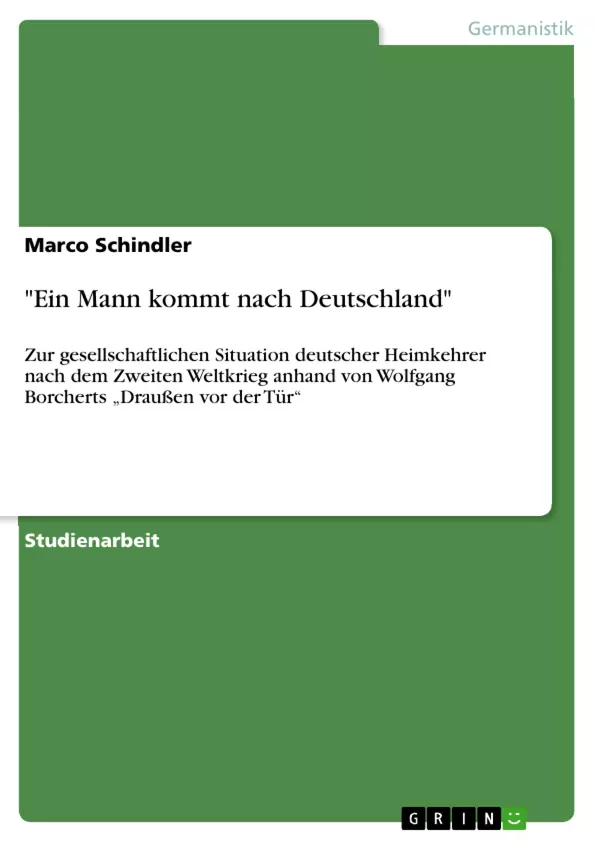„Unzählige Überlebende suchten bei Kriegsende und danach ihre Verwandten und Freunde oder eine neue Heimat, kehrten unter schwierigsten […] Bedingungen aus dem Krieg zurück.“ (Plato & Leh 1997, S. 11). Der Zweite Weltkrieg war eines der dramatischten und gravierendsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte. Mit dem Glauben an eine überlegene deutsche Rasse und verschuldet durch die Folgen des Ersten Weltkrieges versuchte die NSDAP, dem Führer folgend, Feinde im Land aber auch europaweit zu vernichten. Getrieben wurden die Soldaten, die dafür verantwortlich waren, die perversen Ziele des politischen Regimes auszuführen, von einer menschenverachtenden Ideologie. Dabei wurde auch das Volk in das Vorgehen involviert. Durch perfide Propaganda wurden die Menschen manipuliert und folgten zu großen Teilen ihrem Leitbild. „Schließlich sollten die Entscheidungen über Krieg und Rassenpolitik, die beiden zentralen Dimensionen der nationalsozialistischen Politik, auf Hitlers weltanschaulichen Willen zurückgehen.“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2009). Wenn ein Diktator das Volk soweit manipuliert, dass dieses nahezu willenlos folgt, stellt sich die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen. Mit perfiden Gedankenspielen zur Rassenlehre und Umdeutungen von Naturgesetzen versprach Hitler dem damaligen deutschen Volk, welches vom Ausgang des Ersten Weltkrieges unter anderem finanziell gezeichnet war, eine höhere Lebensqualität, da sie zur überlegenen Rasse gehören würden. Die leicht verständlichen und darüber hinaus verheißungsvollen Botschaften boten der rechtsextremistischen Ideologie Vorschub; ihren Anhängern eine glorreiche Perspektive. Die Folgen nach dem Zweiten Weltkrieg waren für die ganze Welt verheerend. Weite Landstriche Europas waren zerstört. Darüber hinaus haben ca. 55 Millionen Menschen ihr Leben verloren, darunter knapp 6 Millionen deutsche Soldaten und Zivilisten. Zudem verloren mehr als 6 Millionen Juden, Sinti und Roma oder auch Homosexuelle durch den Holocaust ihr Leben, was auf den Fremdenhass im Dritten Reich und der dahinterstehenden Ideologie zurückzuführen ist (vgl. Pötzsch 2005). Nach Pötzsch (2005) war „Deutschland […] dreifach geschlagen: militärisch, politisch und moralisch.“ Speziell der moralische Aspekt war für deutsche Heimkehrer, die den Krieg und die Gefangenschaft überlebten, von entscheidender Bedeutung bei der Wahrnehmung ihrer spezifischen Situation.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Intentionen und sprachliche Gestaltung von Nachkriegsliteratur
- 2.1 Intentionen deutscher Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.2 Sprachliche Gestaltung
- 3 Rückkehr in das Nachkriegsdeutschland – Die Unmöglichkeit der verantwortungsvollen Integration in die Gesellschaft
- 3.1 Familiäre Situation nach dem Krieg
- 3.2 Problematik der Arbeitssuche nach der Heimkehr
- 3.3 Umgang mit der Schuldfrage
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftliche Situation deutscher Heimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von Wolfgang Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“. Ziel ist es, die Intentionen Borcherts und die sprachliche Gestaltung seines Werkes zu analysieren und im Kontext der Nachkriegsliteratur zu verorten. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten der Reintegration in die Gesellschaft, sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene.
- Die Intentionen deutscher Schriftsteller der Nachkriegsgeneration
- Sprachliche Gestaltung in der Nachkriegsliteratur
- Die familiäre Situation und die Problematik der Arbeitssuche von Heimkehrern
- Der Umgang mit der Schuldfrage in der Nachkriegsgesellschaft
- Die gesellschaftliche Ausgrenzung von Heimkehrern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den Zweiten Weltkrieg und seine verheerenden Folgen für Deutschland dar. Sie beleuchtet die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus und die Manipulation der Bevölkerung durch Propaganda. Die Einleitung führt in die Thematik der deutschen Heimkehrer ein, die nach dem Krieg sowohl körperlich als auch seelisch schwer gezeichnet waren und auf große Schwierigkeiten bei der Reintegration in die Gesellschaft stießen. Der Fokus liegt auf der moralischen Verantwortung und dem Umgang der Gesellschaft mit den Rückkehrern, wobei Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ als Beispiel für die literarische Auseinandersetzung mit dieser Thematik genannt wird.
2 Intentionen und sprachliche Gestaltung von Nachkriegsliteratur: Dieses Kapitel untersucht die Intentionen deutscher Schriftsteller der Nachkriegsgeneration und deren sprachliche Gestaltung. Es wird die Dichotomie zwischen nüchternem Realismus und innerer Emigration in der Nachkriegsliteratur herausgestellt. Der nüchterne Realismus zeigt die Situation der Heimkehrer ohne Schönfärberei, während die innere Emigration die Abwendung von der bestehenden Gesellschaft widerspiegelt. Borcherts Werk wird als Beispiel für diese Merkmale angeführt, wobei besonders die sprachliche Gestaltung für seinen Erfolg verantwortlich gemacht wird. Das Kapitel betont das gesellschaftliche Engagement der jungen Schriftstellergeneration, die sich von der Vätergeneration abgrenzen wollte und eine realistische Darstellung der Situation für den Leser anstrebte.
3 Rückkehr in das Nachkriegsdeutschland – Die Unmöglichkeit der verantwortungsvollen Integration in die Gesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Herausforderungen, vor denen die heimgekehrten deutschen Soldaten nach dem Krieg standen. Es analysiert die schwierige familiäre Situation, die Probleme bei der Arbeitssuche und den Umgang mit der Schuldfrage. Die Heimkehrer fanden ein verändertes Deutschland vor, in dem sie oft ausgegrenzt wurden und sich nicht mehr zurechtfanden. Der Begriff der „Stunde Null“ wird in diesem Kontext erläutert, wobei die Verdrängung der Vergangenheit als ein zentrales Problem hervorgehoben wird. Das Kapitel unterstreicht die prekären Lebensumstände der Heimkehrer und ihre Schwierigkeiten, in die Gesellschaft integriert zu werden.
Schlüsselwörter
Nachkriegsliteratur, Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, Heimkehrer, Reintegration, gesellschaftliche Ausgrenzung, Schuldfrage, moralische Verantwortung, sprachliche Gestaltung, nüchterner Realismus, innere Emigration, Stunde Null.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Nachkriegsliteratur anhand von Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die gesellschaftliche Situation deutscher Heimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von Wolfgang Borcherts Drama "Draußen vor der Tür". Der Fokus liegt auf den Intentionen Borcherts, der sprachlichen Gestaltung seines Werkes und der Einordnung in den Kontext der Nachkriegsliteratur. Die Schwierigkeiten der Reintegration in die Gesellschaft auf individueller und gesellschaftlicher Ebene werden beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Intentionen deutscher Schriftsteller der Nachkriegsgeneration, die sprachliche Gestaltung in der Nachkriegsliteratur, die familiäre Situation und Arbeitssuche von Heimkehrern, den Umgang mit der Schuldfrage in der Nachkriegsgesellschaft, und die gesellschaftliche Ausgrenzung von Heimkehrern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Die Einleitung beschreibt den Zweiten Weltkrieg, seine Folgen und die Situation der Heimkehrer. Kapitel 2 untersucht die Intentionen und die sprachliche Gestaltung der Nachkriegsliteratur, unter anderem den Realismus und die innere Emigration. Kapitel 3 befasst sich mit den Herausforderungen der Heimkehrer: familiäre Situation, Arbeitssuche und der Umgang mit der Schuldfrage. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür" in die Analyse einbezogen?
Borcherts Drama dient als Fallbeispiel, um die gesellschaftliche Situation der Heimkehrer und die literarische Auseinandersetzung damit zu veranschaulichen. Seine Intentionen und die sprachliche Gestaltung seines Werkes werden im Detail analysiert und im Kontext der Nachkriegsliteratur eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nachkriegsliteratur, Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, Heimkehrer, Reintegration, gesellschaftliche Ausgrenzung, Schuldfrage, moralische Verantwortung, sprachliche Gestaltung, nüchterner Realismus, innere Emigration, Stunde Null.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Intentionen Borcherts und die sprachliche Gestaltung seines Werkes zu analysieren und im Kontext der Nachkriegsliteratur zu verorten. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten der Reintegration in die Gesellschaft sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene.
Welche sprachlichen Merkmale der Nachkriegsliteratur werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den "nüchternen Realismus" und die "innere Emigration" als charakteristische sprachliche Merkmale der Nachkriegsliteratur. Diese werden im Kontext von Borcherts Werk analysiert.
Wie wird die "Stunde Null" in die Analyse einbezogen?
Der Begriff "Stunde Null" wird im Zusammenhang mit der Verdrängung der Vergangenheit und den damit verbundenen Schwierigkeiten der Reintegration der Heimkehrer in die Gesellschaft erläutert.
- Arbeit zitieren
- B.A. Marco Schindler (Autor:in), 2009, "Ein Mann kommt nach Deutschland", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153759