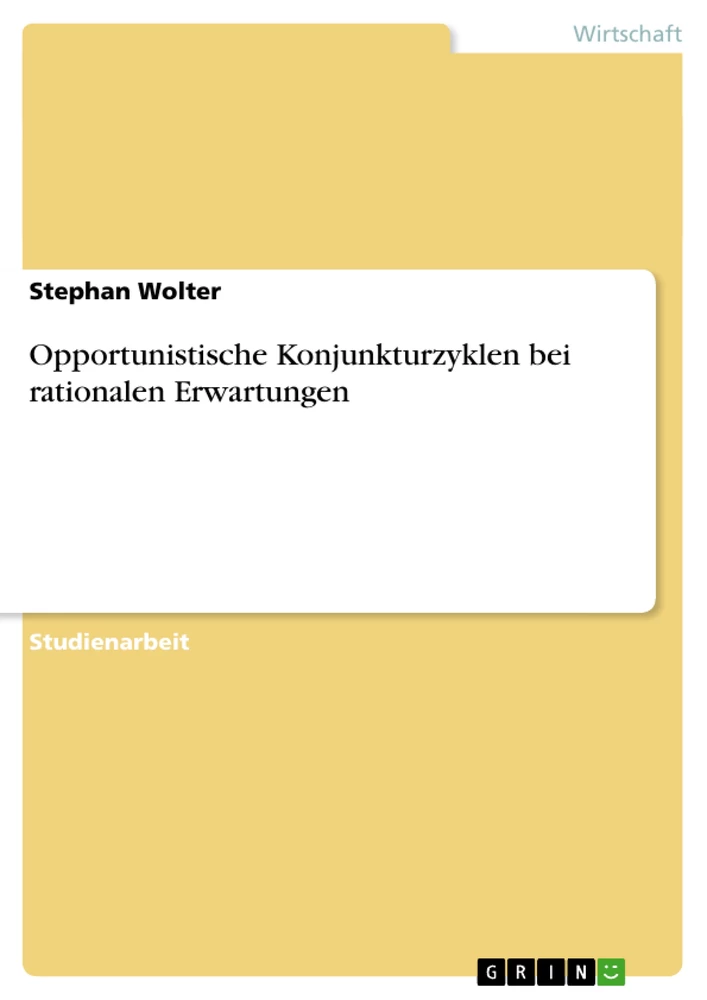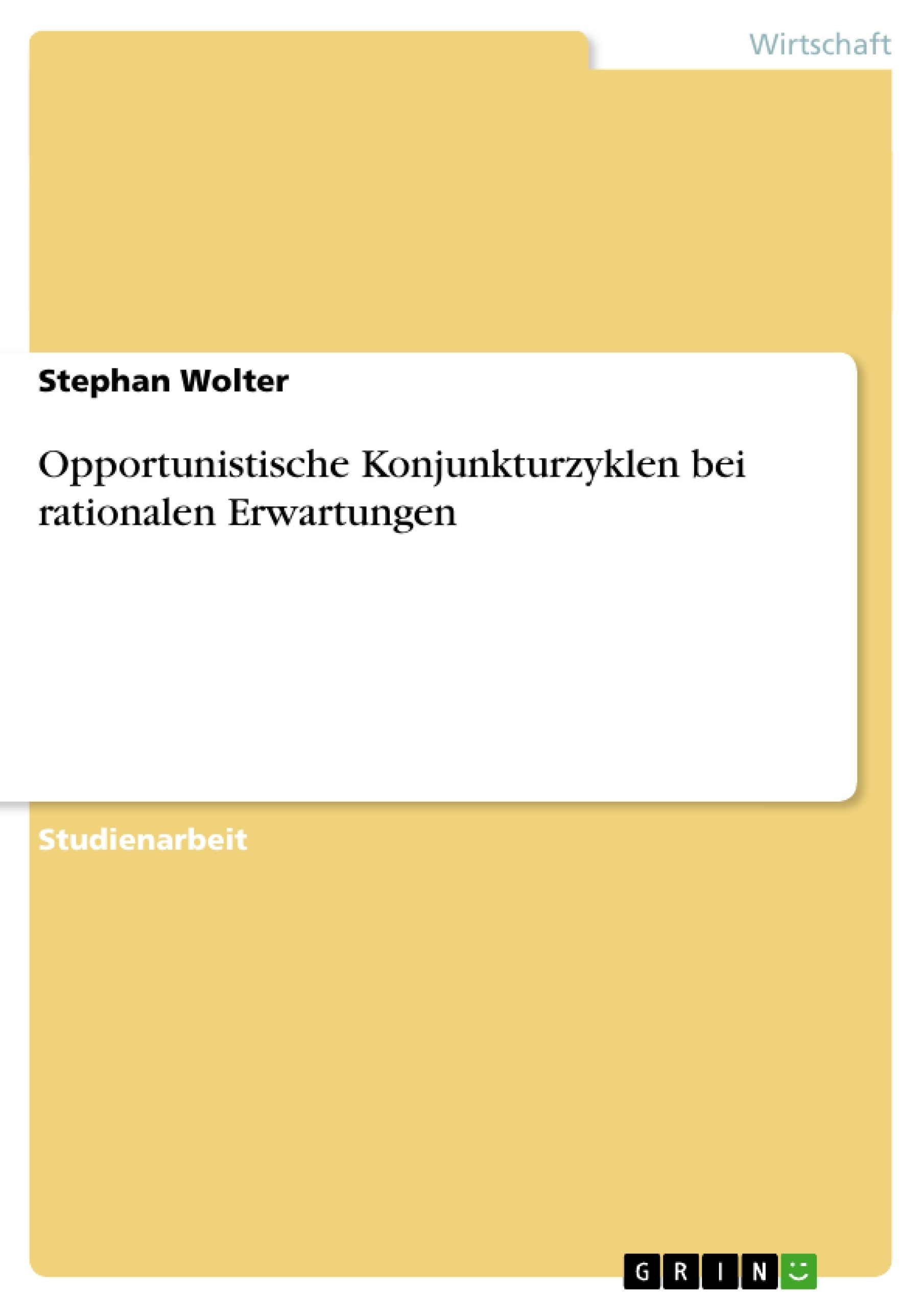[...]
"Die Ökonomen sollen aufhören, politischen Rat zu erteilen, als wären sie bei einem wohlwollenden Despoten
beschäftigt. Stattdessen sollten sie den Rahmen ins Auge fassen, in dem politische Entscheidungen gefällt
werden."
Diese Seminararbeit betrachtet dabei insbesondere das opportunistische Ziel der im Amt befindlichen
Regierung, wiedergewählt zu werden. Selbst wenn die Wähler rational agieren, sie also die Intentionen
der Regierung erkennen, können eigennutzorientierte Eingriffe der Regierung in die wirtschaftliche
Entwicklung unter noch zu klärenden Umständen zur Erzeugung politisch initiierter Konjunkturzyklen
führen. Wesentlich für die Theorie ist dafür die Einbeziehung der Spieltheorie. In der Interaktion von
Wähler und Regierung finden sich Reputations- und Signalgleichgewichte, die regelmäßige
wirtschaftliche Schwankungen erklären.
Die Theorie hält zur Beschreibung politischer Konjunkturzyklen mehrere Ansätze bereit, welche
man anhand der Ausgestaltung der Erwartungsbildungshypothese und der Zielfunktion der Politiker
voneinander abgrenzen kann. Diese Ansätze werden im 2. Kapitel in grober Form beschrieben. Das
opportunistische Erklärungsmodell unter rationalen Erwartungen soll dann vertieft werden. In Kapitel 3
werden dazu der Zusammenhang zwischen Ökonomie und Wahlergebnis allgemein betrachtet und
anschließend die konkreten Grundlagen für eine mögliches Modell erarbeitet, welches im 4. Kapitel
durch Lösung und Interpretation mit unterschiedlichen Annahmen und Erweiterungen auf die
Erklärbarkeit von Konjunkturzyklen hin untersucht wird.1 Der kritische Blick auf die ökonomische und
politische Modellstruktur sowie auf die Ergebnisse eröffnet sich in Kapitel 5. Darin wird auch auf die
empirische Evidenz eingegangen. Im letzten Kaptitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und wird
ein Fazit gezogen. Das 6. Kapitel enthält abschließend zudem einige ausblickende Bemerkungen, in
denen vor allem auf die Notwendigkeit weiterer Forschungsarbeiten hingewiesen wird.
1 Aus platztechnischen Gründen wird in dieser Arbeit auf die graphischen Lösung nur verwiesen. Für Kap 4.1 findet man sie
bei Scheuerle (1999, S. 84 ff.), für Kap. 4.2 in Scheuerle (1999, S. 92 und S. 99) und für Kap. 4.3 bei Scheuerle (1999, S. 124 ff.
und S. 129 ff.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie der politischen Konjunkturzyklen
- Modellrahmen opportunistisch-rationaler Konjunkturzyklen
- Modellmechanismus: Zusammenhang zwischen Ökonomie und Wahlergebnis
- Politisches und ökonomisches System im Grundmodell
- Herleitung opportunistisch- rationaler Konjunkturzyklen
- Dynamisches Spiel mit Reputationsmechanismus
- Erweiterung des Grundmodells
- Signalgleichgewichte und daraus resultierende Konjunkturzyklen
- Lösung des statischen Spiels
- Signalspiele und Kompetenzzyklen
- Separierendes Gleichgewicht
- Poolendes Gleichgewicht
- Kritische Bemerkungen
- Modellformulierung
- Empirische Evidenz
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der opportunistischen Konjunkturzyklen bei rationalen Erwartungen und untersucht, wie eigennützig motivierte Eingriffe der Regierung in die wirtschaftliche Entwicklung zu regelmäßigen wirtschaftlichen Schwankungen führen können. Dabei wird der Fokus auf das Ziel der im Amt befindlichen Regierung gelegt, wiedergewählt zu werden, und wie die Interaktion von Wähler und Regierung zu Reputations- und Signalgleichgewichten führt.
- Die Rolle der Spieltheorie bei der Erklärung politischer Konjunkturzyklen
- Der Zusammenhang zwischen Ökonomie und Wahlergebnis
- Die Bedeutung rationaler Erwartungen bei der Modellierung opportunistischer Konjunkturzyklen
- Die Analyse von Signalgleichgewichten und deren Einfluss auf Konjunkturzyklen
- Die empirische Evidenz für opportunistische Konjunkturzyklen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema der opportunistischen Konjunkturzyklen vor und beleuchtet die Motivation der Regierung, durch gezielte Wirtschaftspolitik ihre Wiederwahl zu sichern.
- Theorie der politischen Konjunkturzyklen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze zur Erklärung von Konjunkturzyklen, wobei der Fokus auf die opportunistische und die ideologische Schule liegt. Die Bedeutung der Erwartungen von Wählern und Regierung wird hervorgehoben.
- Modellrahmen opportunistisch-rationaler Konjunkturzyklen: Hier wird der Zusammenhang zwischen Ökonomie und Wahlergebnis im Detail betrachtet und die Grundlage für das Modell gelegt, welches die Interaktion von Wähler und Regierung beschreibt.
- Herleitung opportunistisch- rationaler Konjunkturzyklen: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung von Konjunkturzyklen im Modell, indem es dynamische Spiele mit Reputationsmechanismen und Signalgleichgewichten analysiert.
- Kritische Bemerkungen: In diesem Kapitel werden die Stärken und Schwächen des Modells sowie die empirische Evidenz für opportunistische Konjunkturzyklen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen politischer Konjunkturzyklen, Opportunismus, rationale Erwartungen, Spieltheorie, Signalgleichgewichte und die Interaktion von Wählern und Regierung. Die wichtigsten Begriffe sind: Philips-Trade-off, Reputationsmechanismus, Modellrahmen, Signalspiele, Kompetenzzyklen, seprarerendes und poolendes Gleichgewicht.
Häufig gestellte Fragen
Was sind opportunistische Konjunkturzyklen?
Dies sind wirtschaftliche Schwankungen, die durch eigennützige Eingriffe einer Regierung entstehen, um ihre Chancen auf eine Wiederwahl zu verbessern.
Wie beeinflussen rationale Erwartungen diese Zyklen?
Obwohl Wähler die Absichten der Regierung erkennen können, führen Informationsasymmetrien und Signalspiele dennoch zu politisch initiierten Schwankungen.
Welche Rolle spielt die Spieltheorie in diesem Modell?
Die Spieltheorie hilft, die Interaktion zwischen Wählern und Regierung durch Reputationsmechanismen sowie separierende und poolende Gleichgewichte zu erklären.
Was ist ein Signalgleichgewicht?
Ein Zustand, in dem die Regierung durch wirtschaftspolitische Maßnahmen Signale über ihre Kompetenz an die Wähler sendet, um deren Wahlentscheidung zu beeinflussen.
Gibt es empirische Evidenz für diese Theorie?
Die Arbeit diskutiert im 5. Kapitel die empirische Belegbarkeit und kritisiert die Modellstruktur im Hinblick auf reale wirtschaftliche Daten.
Was ist der Philips-Trade-off?
Es beschreibt den Zielkonflikt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, den Regierungen im Rahmen von Konjunkturzyklen oft auszunutzen versuchen.
- Arbeit zitieren
- Stephan Wolter (Autor:in), 2003, Opportunistische Konjunkturzyklen bei rationalen Erwartungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15378