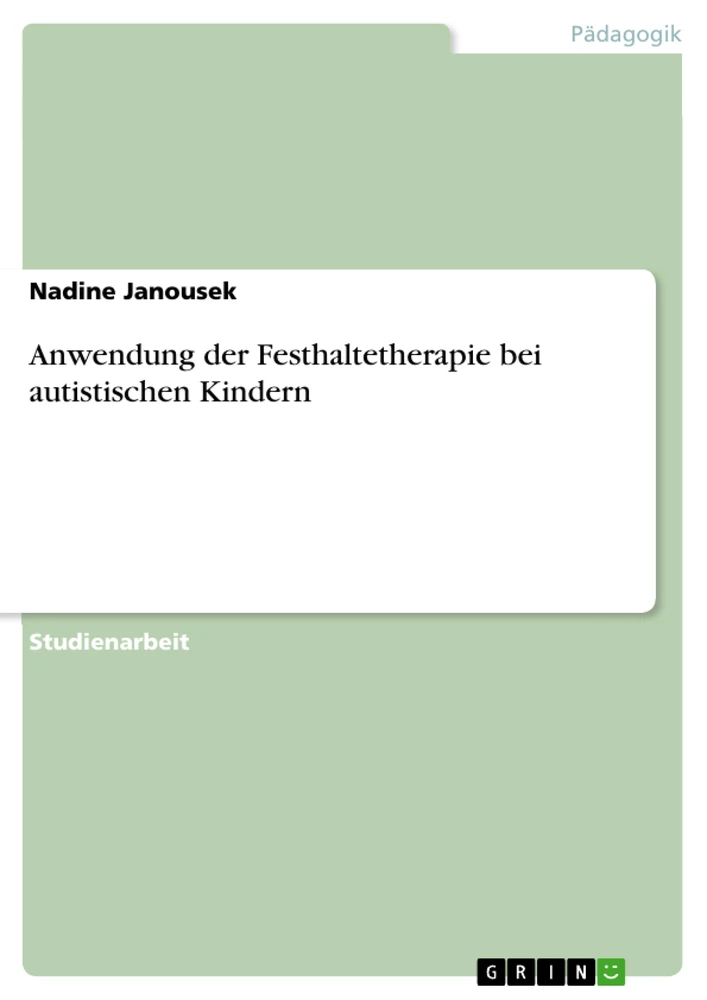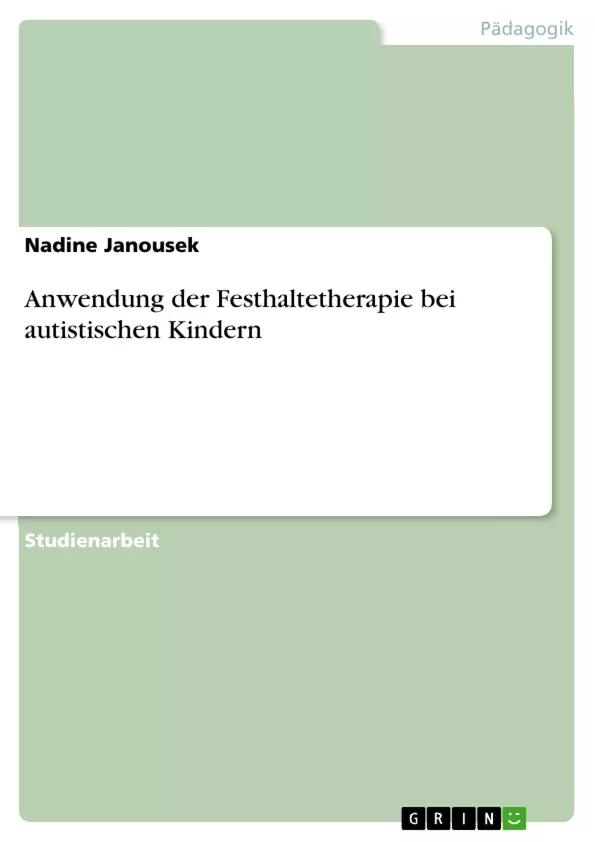Die Arbeit befasst sich mit der Festhaltetherapie als eine Behandlungsmethode bei Autismus. Die Festhaltetherapie ist unter (Sonder-) Pädagogen sehr umstritten, da sie nicht nur bezüglich ihrer Anwendung unzeitgemäß erscheint, sondern ihr auch Verstöße gegen wissenschaftliche Erkenntnisse auf den Gebieten der Entwicklungspsychologie vorgehalten werden. Dennoch liefert eine Beschäftigung mit eben diesem Thema wichtige Einblicke in die theoretische Fundierung pädagogischer Praxis, deren (gesellschaftliche) Grenzen und zeigt die Notwendigkeit eines Dialoges in der Pädagogik – auch oder gerade bezüglich dieser Therapieform - auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Autismus
- Definition
- Theorien
- Erscheinungsbilder
- Ursachen aus heutiger Sicht
- Therapien und Fördermöglichkeiten
- Die Festhaltetherapie
- Grundlagen der Festhaltetherapie
- Die Begründer
- Beschreibung der Therapie
- Ziele der Haltetherapie
- Anwendungsgebiete
- Die Bedeutung des Haltens
- Welche Prozesse werden durch und während des Haltens ausgelöst?
- Die Bedeutung des Haltens für die Bindung
- Festhalten als Therapie bei Autismus
- Autismus aus festhaltetherapeutischer Sicht
- Erscheinungsbilder
- Ursachen
- Festhalten als Therapiemethode
- Bewertung der Festhaltetherapie aus pädagogischer Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Festhaltetherapie als Behandlungsmethode für Autismus und analysiert ihre Kontroversen in der (Sonder-)Pädagogik. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Festhaltetherapie und ihre Anwendung in der Praxis, wobei sie die Notwendigkeit eines Dialogs in der Pädagogik bezüglich dieser Therapieform betont.
- Definition und Theorien von Autismus
- Grundlagen der Festhaltetherapie und ihre Ziele
- Die Bedeutung des Haltens für die Bindungsbildung
- Die Anwendung der Festhaltetherapie bei Autismus
- Kritische Bewertung der Festhaltetherapie aus pädagogischer Sicht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Festhaltetherapie als ein umstrittenes Thema in der Pädagogik vor und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- Autismus: Dieses Kapitel definiert Autismus als Entwicklungsstörung und beleuchtet Theorien über seine Ursachen, Erscheinungsbilder sowie Therapiemöglichkeiten.
- Die Festhaltetherapie: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Festhaltetherapie, ihre Begründer, Ziele und Anwendungsgebiete. Es analysiert die Bedeutung des Haltens für die Entwicklung des Kindes.
- Festhalten als Therapie bei Autismus: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung der Festhaltetherapie bei Autismus aus festhaltetherapeutischer Sicht und beleuchtet die Kritik aus pädagogischer Sicht.
Schlüsselwörter
Autismus, Festhaltetherapie, Entwicklungsstörung, soziale Interaktion, Kommunikation, Bindung, Halten, pädagogische Bewertung, Kritik, (Sonder-)Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Festhaltetherapie bei Autismus?
Es handelt sich um eine umstrittene Behandlungsmethode, bei der das Kind physisch festgehalten wird, um emotionale Durchbrüche zu erzwingen und die Bindung zu stärken.
Warum ist die Festhaltetherapie pädagogisch umstritten?
Kritiker werfen ihr Verstöße gegen entwicklungspsychologische Erkenntnisse vor, bezeichnen sie als unzeitgemäß und warnen vor potenziellen Traumatisierungen durch den physischen Zwang.
Welche Ziele verfolgt die Haltetherapie?
Hauptziele sind der Aufbau einer tieferen Bindung zwischen Eltern und Kind sowie die Überwindung von Kontaktstörungen, die für Autismus typisch sind.
Welche Prozesse werden beim Halten ausgelöst?
Aus Sicht der Therapeuten sollen während des Haltens emotionale Spannungen abgebaut und eine neue Form der Nähe und Akzeptanz ermöglicht werden.
Wie wird Autismus heute therapiert?
Neben umstrittenen Methoden wie der Festhaltetherapie gibt es heute eine Vielzahl an wissenschaftlich fundierten Förder- und Therapiemöglichkeiten, die auf Kommunikation und soziale Interaktion setzen.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Pädagogin Nadine Janousek (Autor:in), 2007, Anwendung der Festhaltetherapie bei autistischen Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153783