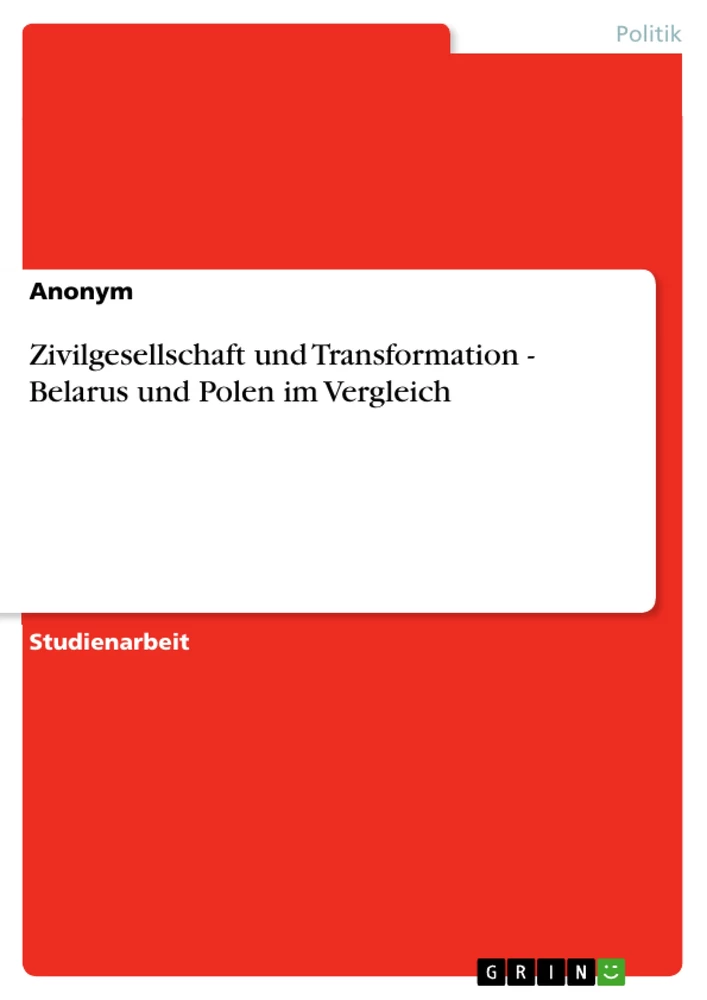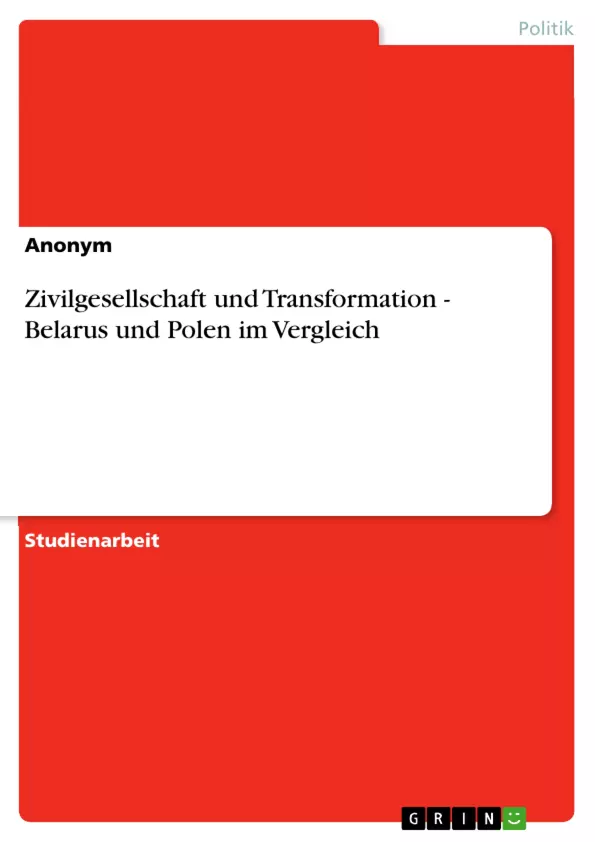Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion standen die Staaten des Ostblocks vor
einer unsicheren politischen und wirtschaftlichen Zukunft. In den einsetzenden
Transformationsprozessen gelang es den meisten dieser Staaten, demokratische und
marktwirtschaftliche Strukturen zu etablieren. Auf der Landkarte des demokratischen Europas
finden sich jedoch noch immer weiße Flecken. Einer dieser weißen Flecken ist die Republik
Belarus, welche von Politikern und Wissenschaftlern gleichermaßen als letzte Diktatur
Europas bezeichnet wird. Verglichen mit dem durchaus erfolgreichen Wandel in anderen
osteuropäischen Staaten, ist Belarus in seiner anti-demokratischen Entwicklung ein
Sonderfall, dessen politische Entwicklung keineswegs in dieser Form antizipiert wurde. Es
stellt sich also die Frage, warum der begonnene Transformationsprozess in Belarus nicht
erfolgreich war.
In der politischen Debatte um das Schicksal Belarus wurde immer wieder die Ansicht
vertreten, dass das Fehlen einer starken Zivilgesellschaft das Scheitern der belarussischen
Transformation bedingt hätte. Da es sich sowohl beim Begriff der Zivilgesellschaft als auch
der Transformation um komplexe Konzepte handelt, scheint diese Aussage höchst
simplifiziert. In der vorliegenden Hausarbeit soll daher geprüft werden, inwieweit das Fehlen
einer starken Zivilgesellschaft das Scheitern der Transformation in Belarus erklären kann.
Untersucht wird also der Grad der Demokratisierung (abhängige Variable), d.h. der Erfolg der
post-kommunistischen Transformation, in Abhängigkeit von der zivilgesellschaftlichen Stärke
(unabhängige Variable). Die Hypothese lautet hierbei: Je stärker die Zivilgesellschaft eines
Landes, desto höher ist der Grad der Demokratisierung.
Die Operationalisierung der abhängigen Variablen erfolgt dabei relativ unkompliziert
über den Freedom House „Freedom in the World“-Index1 und den Freedom House „Nations
in Transit“-Index. Die Stärke der Zivilgesellschaft lässt sich jedoch ungleich schwerer
messbar machen. Ein Versuch der Messbarmachung wird in Kapitel 2 dargelegt. Es sei bereits
darauf hingewiesen, dass in Kapitel 5 der Kritik am Konzept der Zivilgesellschaft und deren
Operationalisierung Raum gegeben wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung, Hypothese und Operationalisierung
- Methodik
- Aufbau der Arbeit
- Begriffsklärung
- Demokratie
- Transformation
- Theoretischer Hintergrund: Zivilgesellschaft und Transformation
- Demokratie und Zivilgesellschaft: Polen und Belarus im Vergleich
- Polen
- Ende des autokratischen Regimes
- Institutionalisierung der Demokratie
- Konsolidierung der Demokratie
- Belarus
- Ende des autokratischen Regimes
- Institutionalisierung der Demokratie
- Ende der Transformation
- Konsolidierung der Diktatur
- Fazit
- Kritik: Zivilgesellschaft als unzureichendes Analysewerkzeug
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Stärke der Zivilgesellschaft und dem Erfolg der post-kommunistischen Transformation in Belarus. Dabei wird die Hypothese aufgestellt, dass eine starke Zivilgesellschaft zu einem höheren Grad der Demokratisierung führt. Der Fokus liegt auf einem Vergleich zwischen Belarus und Polen, wobei Polen als Beispiel für eine erfolgreiche Transformation betrachtet wird. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Zivilgesellschaft und des Demokratisierungsgrades in beiden Ländern, um den Einfluss der Zivilgesellschaft auf den Transformationsprozess zu beleuchten.
- Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Demokratisierung
- Der Vergleich der Transformationsprozesse in Polen und Belarus
- Die Bedeutung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Zivilgesellschaft
- Die Herausforderungen der Transformation in post-kommunistischen Ländern
- Die Bedeutung der "most-similar case study" als Methode des Vergleichs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung, die Hypothese und die Operationalisierung der Arbeit vor. Sie erläutert die Methode des Vergleichs und das gewählte Fallbeispiel: Polen und Belarus.
- Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Rahmen der Arbeit und definiert die zentralen Begriffe wie Zivilgesellschaft, Transformation und Demokratie.
- Demokratie und Zivilgesellschaft: Polen und Belarus im Vergleich: Dieser Abschnitt analysiert die politische und wirtschaftliche Entwicklung von Polen und Belarus im Vergleich. Er untersucht den Einfluss der Zivilgesellschaft auf den Transformationsprozess in beiden Ländern.
Schlüsselwörter
Zivilgesellschaft, Transformation, Demokratisierung, Polen, Belarus, most-similar case study, Freedom House, politische Rechte, Bürgerrechte, post-kommunistische Transformation, Vergleichende Methode, Analysewerkzeug
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte die Transformation in Belarus im Vergleich zu Polen?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass das Fehlen einer starken Zivilgesellschaft in Belarus maßgeblich für das Scheitern der Demokratisierung verantwortlich ist.
Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft bei der Demokratisierung?
Eine starke Zivilgesellschaft gilt als unabhängige Variable, die den Erfolg der post-kommunistischen Transformation und den Grad der Demokratisierung positiv beeinflusst.
Wie wird der Grad der Demokratisierung gemessen?
Zur Operationalisierung werden Indizes wie der Freedom House „Freedom in the World“-Index und der „Nations in Transit“-Index herangezogen.
Warum wird Belarus als "letzte Diktatur Europas" bezeichnet?
Aufgrund seiner anti-demokratischen Entwicklung und der Konsolidierung eines autokratischen Regimes nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion stellt Belarus einen Sonderfall in Europa dar.
Was ist das Ergebnis des Vergleichs zwischen Polen und Belarus?
Polen dient als Beispiel für eine erfolgreiche Institutionalisierung und Konsolidierung der Demokratie, während Belarus den Weg zur Konsolidierung einer Diktatur einschlug.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, Zivilgesellschaft und Transformation - Belarus und Polen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153850