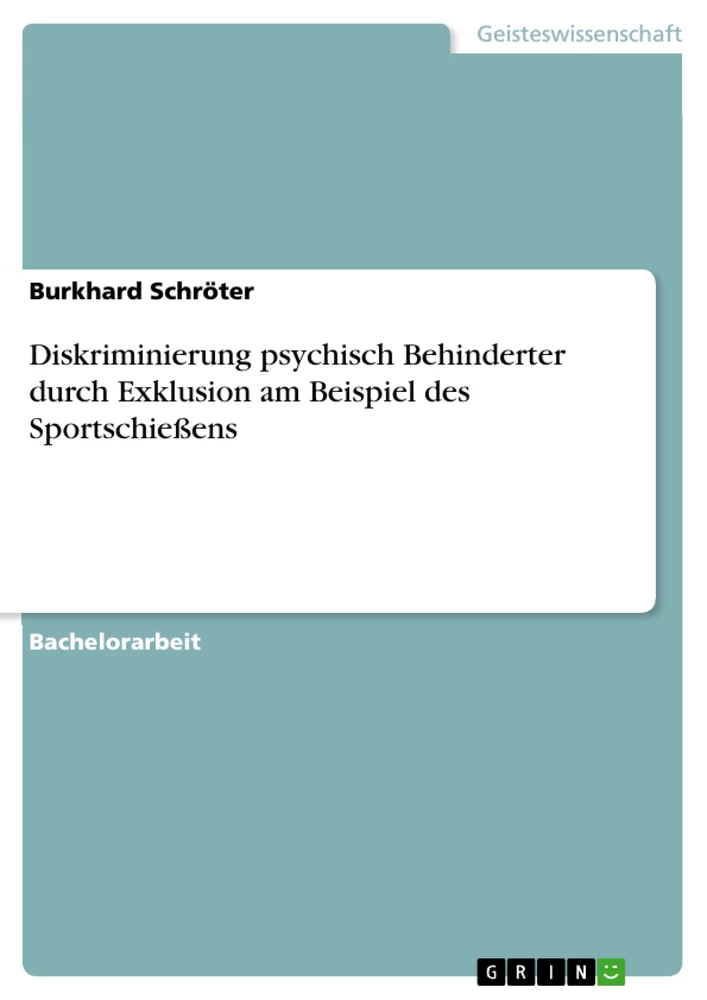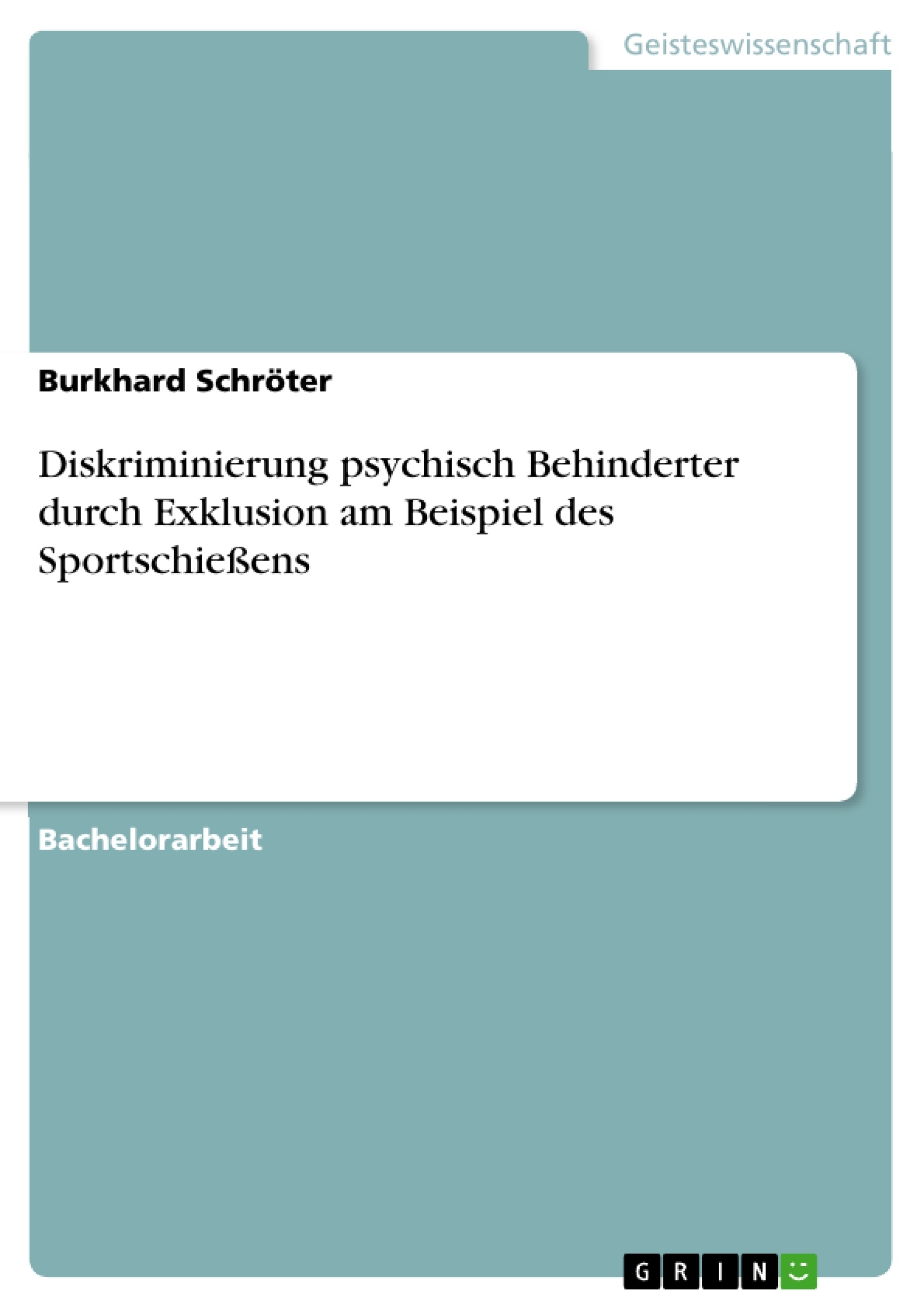Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 bis 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist ein Grundbestandteil der Verfassung und gilt als rechtsstaatliches Prinzip in allen Rechtsbereichen. In Artikel 3 heißt es hierzu: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“
Es stellt sich die Frage, inwieweit dies in der Praxis umgesetzt wird. Reichen die gesetzlichen Vorgaben aus, um dem Artikel 3 des Grundgesetzes gerecht zu werden? Darüber besteht Uneinigkeit. Anlässlich der ersten Beratung der Antidiskriminierungsrichtlinie der Europäischen Union im Bundesrat forderte Bayerns Bundesratsminister Dr. Markus Söder die Bundesregierung auf, im Europäischen Rat ihr Veto gegen die Richtlinie einzulegen. Söder: „… Die Richtlinie ist überflüssig, bürokratisch und lebensfern.“ Nach den Worten Söders bestehen auf nationaler Ebene bereits ausreichende Regelungen zur Verhinderung von Diskriminierungen. Der Vorschlag der Kommission greife massiv in die Vertragsfreiheit ein und schaffe in der Praxis unnötige Rechtsunsicherheit. Söder: „Die Kommission schießt mit ihrer Regelungswut weit über ihr Ziel hinaus. Mit ihrem Entwurf reduziert die Kommission auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für diejenigen, die das Gesetz zu schützen vorgibt. Der beste Diskriminierungsschutz liegt in einer toleranten, vorurteilsfreien Gesellschaft, nicht aber in einem Maximum an Verboten.“
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Die Behinderung
- Die Psychische Störung
- Die Psychische Behinderung
- Gesetzliche Regelungen für Menschen mit Behinderungen
- Das Gleichheitsprinzip Behinderter
- Der Begriff der Teilhabe
- Gesellschaft und Gemeinschaft
- Gesetze der Antidiskriminierung und der Gleichstellung
- Die Behindertenrechtskonvention - BRK
- Zur Entstehung
- Bedeutung
- Die Situation in Deutschland
- Exklusion psychisch Behinderter
- Begriffsklärung
- Stigmatisierung psychisch Kranker
- Exklusion als gesellschaftliches Problem
- Exklusion psychisch Kranker und Behinderter im Arbeitsleben
- Diskriminierung durch die Hilfesysteme selbst
- Psychische Erkrankung als gesellschaftliches Erklärungsmodell für - Unfassbares – aufgezeigt am Beispiel des Amoklaufs
- Der Amoklauf
- Die Rolle der Medien
- Kriminalstatistische Gesichtspunkte
- Die Rolle des Sports in der Psychiatrie
- Kompetenzförderung durch den Sport
- Das Sportschießen
- Allgemeines über den Schießsport
- Kompetenzen im Schießsport
- Die Technik
- Mentales Training
- Alternativen zu scharfen Waffen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Diskriminierung psychisch Behinderter durch Exklusion am Beispiel des Sportschießens. Ziel ist es, die Problematik der Exklusion psychisch Behinderter in der Gesellschaft, insbesondere im Bereich des Sports, aufzuzeigen und die rechtlichen Grundlagen der Antidiskriminierung zu beleuchten.
- Begriffliche Abgrenzung von Behinderung, psychischer Störung und psychischer Behinderung
- Gesetzliche Regelungen zur Gleichstellung und Antidiskriminierung von Menschen mit Behinderungen
- Exklusionsmechanismen im Kontext psychischer Erkrankungen und Behinderungen
- Die Rolle des Sports als Mittel zur Integration und Inklusion psychisch Behinderter
- Analyse des Sportschießens als Beispiel für die Diskriminierung psychisch Behinderter
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort schildert die persönlichen Erfahrungen des Autors mit psychisch kranken Jugendlichen in einer Wohngruppe und deren positive Entwicklung durch die Teilnahme am Sportschießen. Die Einleitung führt den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus dem Grundgesetz ein und diskutiert die Notwendigkeit von Antidiskriminierungsmaßnahmen.
Das Kapitel "Begriffsklärungen" definiert die Begriffe Behinderung, psychische Störung und psychische Behinderung. Das Kapitel "Gesetzliche Regelungen für Menschen mit Behinderungen" beleuchtet das Gleichheitsprinzip, Gesetze der Antidiskriminierung und die Bedeutung der Behindertenrechtskonvention.
Das Kapitel "Exklusion psychisch Behinderter" analysiert verschiedene Formen der Exklusion, insbesondere im Arbeitsleben und durch die Hilfesysteme selbst. Das Kapitel "Psychische Erkrankung als gesellschaftliches Erklärungsmodell für - Unfassbares – aufgezeigt am Beispiel des Amoklaufs" untersucht die Rolle der Medien im Zusammenhang mit Amokläufen und die stigmatisierende Wirkung von psychischen Erkrankungen.
Die Kapitel "Die Rolle des Sports in der Psychiatrie" und "Kompetenzförderung durch den Sport" beleuchten die positiven Auswirkungen des Sports auf die Gesundheit und Integration von psychisch Kranken. Das Kapitel "Das Sportschießen" analysiert den Schießsport als Beispiel für die Diskriminierung psychisch Behinderter und präsentiert alternative Sportarten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Diskriminierung, Exklusion, psychische Behinderung, Inklusion, Integration, Gleichstellung, Antidiskriminierung, Sportschießen, gesellschaftliche Teilhabe, Stigmatisierung, Medien, Amoklauf, Gesetzgebung, Behindertenrechtskonvention.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Artikel 3 des Grundgesetzes zur Behinderung?
Er legt fest, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Dies gilt als rechtsstaatliches Prinzip in allen Lebensbereichen.
Wie werden psychisch Behinderte exkludiert?
Exklusion findet durch Stigmatisierung, Benachteiligung im Arbeitsleben und oft auch durch Hürden in Freizeitbereichen wie dem Schießsport statt.
Warum dient das Sportschießen als Beispiel für Diskriminierung?
Oft wird psychisch Kranken der Zugang zu diesem Sport aufgrund von Vorurteilen oder pauschalen Sicherheitsbedenken verwehrt, obwohl Sport die Kompetenz fördern kann.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Stigmatisierung?
Medien nutzen psychische Erkrankungen oft als vorschnelles Erklärungsmodell für Gewaltverbrechen (z.B. Amokläufe), was Vorurteile in der Gesellschaft verstärkt.
Kann Sport bei psychischen Erkrankungen helfen?
Ja, Sport in der Psychiatrie fördert die mentale Stabilität, die Disziplin und die soziale Teilhabe, was zur Inklusion beiträgt.
- Quote paper
- Burkhard Schröter (Author), 2010, Diskriminierung psychisch Behinderter durch Exklusion am Beispiel des Sportschießens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153865