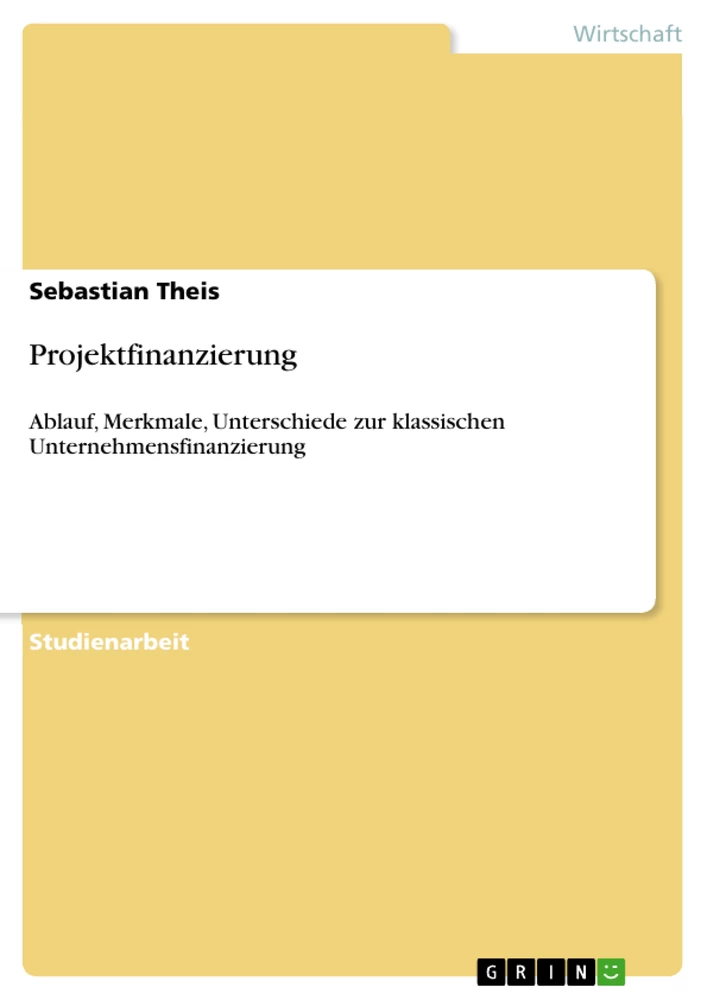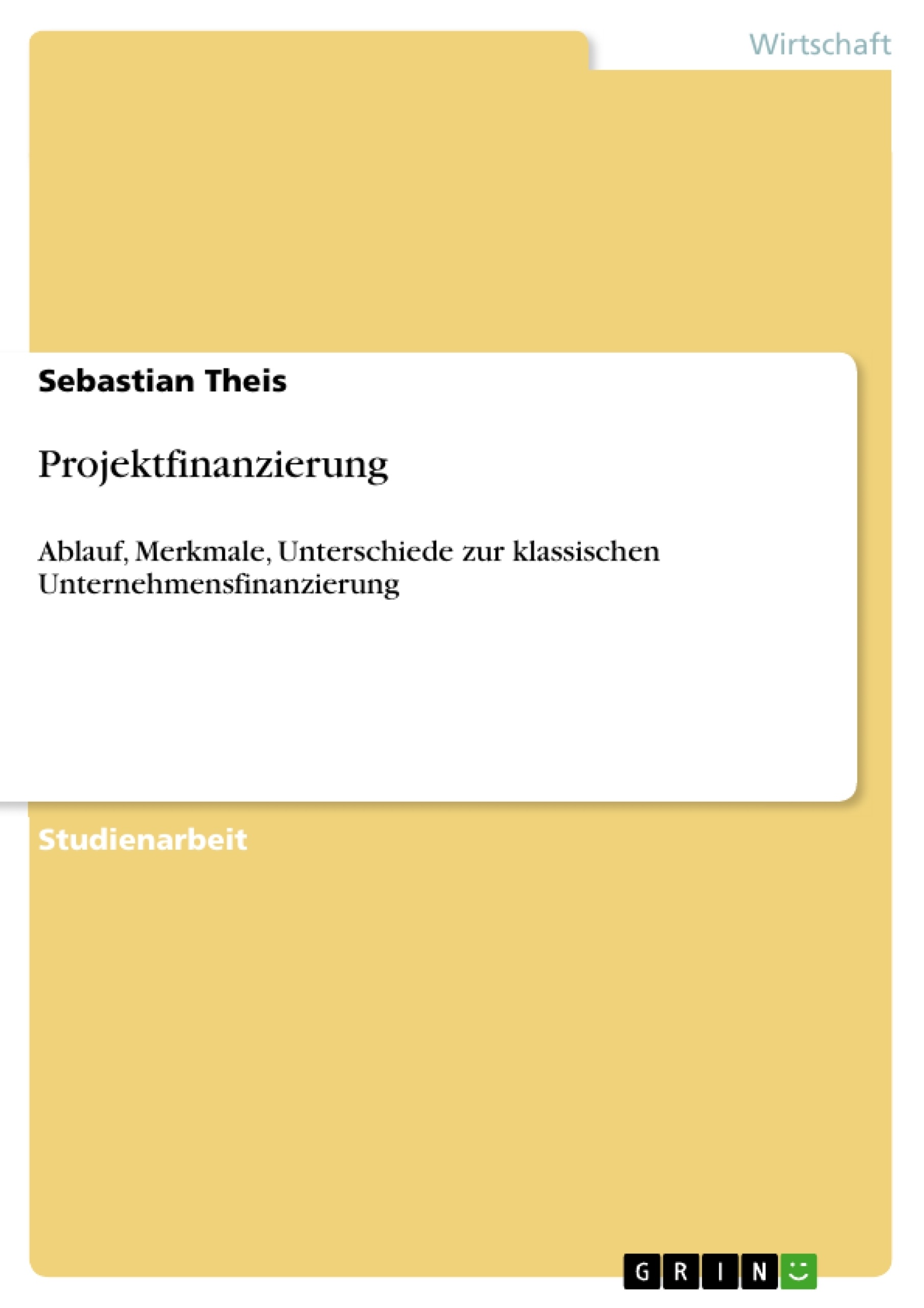Großprojekte, wie beispielsweise der Bau von Flughäfen oder Staudämmen, bringen Investitionsbedarf und Risiken mit sich, die für einzelne Unternehmen alleine nicht zu bewältigen sind. Das Hauptproblem bei derartigen Großprojekten ist die Akquise des notwendigen Kapitals. Ein weiteres Problem ist, dass in den seltensten Fällen ein Unternehmen allein das nötige Know-how besitzt um ein Großprojekt allein durchzuführen.
[...]
Ziel dieser Ausarbeitung ist es den theoretischen Ansatz der Projektfinanzierung zu erläutern. Hierbei sollen Chancen und Risiken der Projektfinanzierung als Alternative zu konventionellen Finanzierungsformen aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Projekt
- Projektbegriff
- Projektstruktur
- Projektrisiken
- Finanzierungsvorgang
- Ablauf
- Merkmale
- Unterschiede zur klassischen Unternehmensfinanzierung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem theoretischen Ansatz der Projektfinanzierung. Ziel ist es, die Chancen und Risiken der Projektfinanzierung als Alternative zu konventionellen Finanzierungsformen aufzuzeigen.
- Charakterisierung von Projekten und deren Finanzierung
- Analyse der Projektstruktur und der damit verbundenen Risiken
- Untersuchung des Ablaufs der Projektfinanzierung
- Hervorhebung der Unterschiede zur klassischen Unternehmensfinanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung behandelt die Problemstellung, die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Ausarbeitung. Es wird hervorgehoben, dass Großprojekte einen hohen Investitionsbedarf und Risiken mit sich bringen, die für einzelne Unternehmen nicht zu bewältigen sind. Das Hauptproblem ist die Akquise des notwendigen Kapitals, wobei auch das Know-how für die Projektumsetzung oft nicht in einem einzigen Unternehmen vorhanden ist.
Projekt
Kapitel 2 widmet sich dem Projektbegriff und der Projektstruktur. Der Begriff der Projektfinanzierung wird im Sinne des IAS 47 erläutert, der die Finanzierung einer sich selbst tragenden Wirtschaftseinheit beschreibt, die ausschließlich zu diesem Zweck gegründet wurde. Es wird außerdem ein Überblick über die Risiken der Projektfinanzierung gegeben.
Finanzierungsvorgang
In Kapitel 3 wird der aktuelle Forschungsstand zum Ablauf der Projektfinanzierung wiedergegeben. Die Merkmale der Projektfinanzierung werden beleuchtet und die Unterschiede zu klassischen Finanzierungsformen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Kernthemen Projektfinanzierung, Großprojekte, Investitionsbedarf, Risiken, Projektstruktur, Finanzierungsvorgang, IAS 47, klassische Unternehmensfinanzierung.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Projektfinanzierung von klassischer Unternehmensfinanzierung?
Bei der Projektfinanzierung steht die Cashflow-Generierung des Projekts selbst im Vordergrund, oft durch eine eigens gegründete Projektgesellschaft (Special Purpose Vehicle).
Für welche Arten von Vorhaben wird Projektfinanzierung genutzt?
Sie wird primär für kapitalintensive Großprojekte wie den Bau von Flughäfen, Staudämmen oder Energieinfrastruktur eingesetzt.
Welche Rolle spielt IAS 47 in diesem Dokument?
Die Arbeit erläutert den Projektbegriff im Sinne des IAS 47, der die Finanzierung einer rechtlich selbstständigen, sich selbst tragenden Wirtschaftseinheit beschreibt.
Was sind die größten Risiken bei Großprojekten?
Zu den Risiken zählen hohe Investitionsbedarfe, lange Amortisationszeiten, technisches Know-how-Defizite und politische oder wirtschaftliche Unsicherheiten.
Warum schließen sich Unternehmen für solche Projekte oft zusammen?
Da ein einzelnes Unternehmen oft weder das gesamte Kapital noch das notwendige Know-how besitzt, werden Risiken und Ressourcen in einer Projektstruktur geteilt.
Wie läuft der Finanzierungsvorgang typischerweise ab?
Der Prozess umfasst die Identifikation des Projekts, die Gründung einer Projektgesellschaft, die Akquise von Fremd- und Eigenkapital sowie die Absicherung der Cashflows.
- Citar trabajo
- Sebastian Theis (Autor), 2009, Projektfinanzierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154022