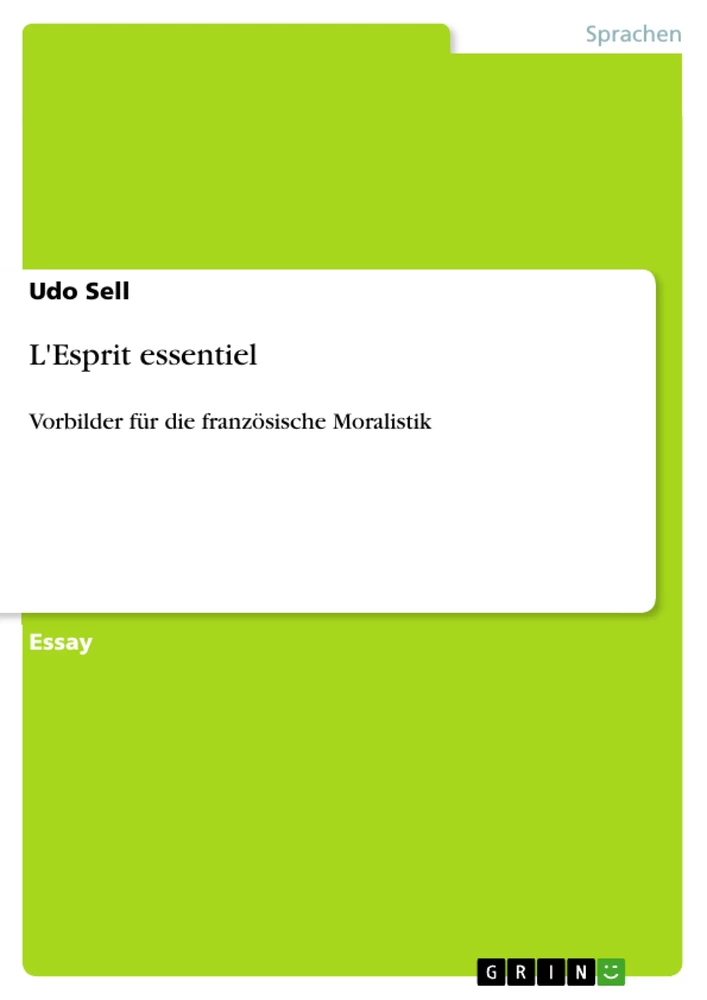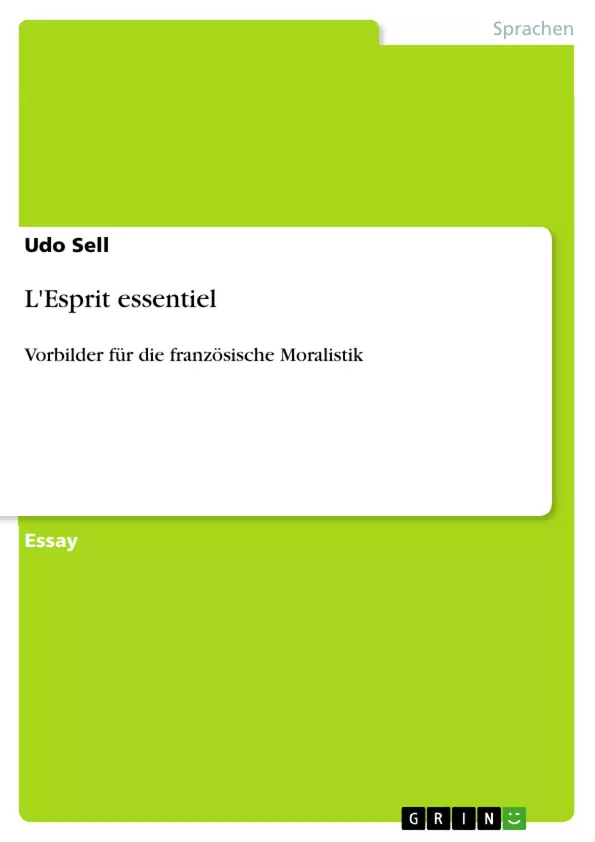Der Essay befaßt sich mit diversen Vorbildern für die französische Moralistik. Beginnend mit der griechischen Antike Theophrast, Aristoteles, Menander), geht er über die römische (Sallust, Cicero, Horaz, Seneca) bis hin zu den direkten europäischen Wegbereitern (Shakespeare, Bacon, Gracián, Montaigne). Mit französischen Moralisten selbst (La Bruyère, Chamfort, Vauvenargues, La Rochefoucauld) schließt der Text.
Inhaltsverzeichnis
- Essayistische Einleitung zur Frage „Was ist Moralistik?“
- Griechische Antike
- Theophrast
- Aristoteles
- Menander
- Römische Antike
- Horaz
- Cicero
- Seneca
- Sallust
- Wegbereiter der französischen Moralistik
- Michel de Montaigne
- Francis Bacon
- Baltasar Gracián
- William Shakespeare
- Französische Moralistik
- La Rochefoucauld
- La Bruyère
- Vauvenargues
- Nicolas Chamfort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die französische Moralistik und ihren Kontext, indem sie die Entwicklung des Genres von der Antike bis zum 17. Jahrhundert nachzeichnet. Ziel ist es, die charakteristischen Merkmale französischer Moralistik zu identifizieren und zu analysieren, insbesondere im Vergleich zu deutschen Ermahnungsliteratur. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen literarischen Formen, die die französischen Moralisten verwendeten.
- Entwicklung der Moralistik von der Antike bis zur französischen Klassik
- Vergleichende Analyse französischer und deutscher Moralistik
- Untersuchung charakteristischer Stilmittel der französischen Moralisten
- Analyse der literarischen Formen (Portrait und Essay)
- Die Rolle von Ironie, Zynismus und Hyperbel in der französischen Moralistik
Zusammenfassung der Kapitel
Essayistische Einleitung zur Frage „Was ist Moralistik?“: Diese Einleitung beschreibt die Schwierigkeiten, den Begriff "Moralistik" zu definieren und grenzt ihn von bloßer Ermahnung ab. Der Autor schildert seine anfänglichen Schwierigkeiten, französische Moralisten zu finden und die gängige Vorstellung von Moralistik zu hinterfragen. Er vergleicht die deutsche, oft mit dem "erhobenen Zeigefinger" assoziierte Ermahnung mit dem subtileren, ironischen und oft zynischen Ansatz der französischen Moralisten. Der Fokus liegt auf der Beobachtung des menschlichen Verhaltens und der Reflexion über dieses, anstatt auf direkter moralischer Belehrung.
Schlüsselwörter
Französische Moralistik, La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Hyperbel, Portrait, Essay, Theophrast, Vergleichende Literaturwissenschaft, Stilmittel, Menschenbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Französische Moralistik und ihre Vorläufer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die französische Moralistik und ihren historischen Kontext, von der Antike bis zum 17. Jahrhundert. Sie analysiert die Entwicklung des Genres, die charakteristischen Merkmale französischer Moralistik im Vergleich zur deutschen Ermahnungsliteratur und die verwendeten literarischen Formen.
Welche Autoren werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eine breite Auswahl an Autoren, beginnend mit griechischen und römischen Vorläufern wie Theophrast, Aristoteles, Menander, Horaz, Cicero, Seneca und Sallust. Sie konzentriert sich dann auf Wegbereiter der französischen Moralistik wie Michel de Montaigne, Francis Bacon, Baltasar Gracián und William Shakespeare, bevor sie detailliert auf die Hauptvertreter der französischen Moralistik eingeht: La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues und Nicolas Chamfort.
Welche Themen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Moralistik über die Jahrhunderte, vergleicht die französische und deutsche Moralistik, untersucht charakteristische Stilmittel der französischen Moralisten (wie Ironie, Zynismus und Hyperbel), analysiert die literarischen Formen (Portrait und Essay) und betrachtet das Menschenbild, das in den Werken der Moralisten zum Ausdruck kommt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer essayistischen Einleitung, die den Begriff "Moralistik" definiert und von der bloßen Ermahnung abgrenzt. Anschließend werden die einzelnen Autoren und Epochen chronologisch behandelt. Kapitelzusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Inhalte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Französische Moralistik, La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Hyperbel, Portrait, Essay, Theophrast, Vergleichende Literaturwissenschaft, Stilmittel, Menschenbild.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Identifizierung und Analyse der charakteristischen Merkmale französischer Moralistik, insbesondere im Vergleich zur deutschen Ermahnungsliteratur. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis der Entwicklung und der Besonderheiten dieses literarischen Genres vermitteln.
Welche Art von Literaturvergleich wird angestellt?
Die Arbeit führt einen Vergleich zwischen der französischen und der deutschen Moralistik durch, um die Unterschiede in Ansatz und Stil hervorzuheben. Der Fokus liegt dabei auf dem subtilen, oft ironischen und zynischen Charakter der französischen Moralistik im Gegensatz zur oft direkteren und weniger nuancierten deutschen Ermahnung.
- Quote paper
- Udo Sell (Author), 2010, L'Esprit essentiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154071