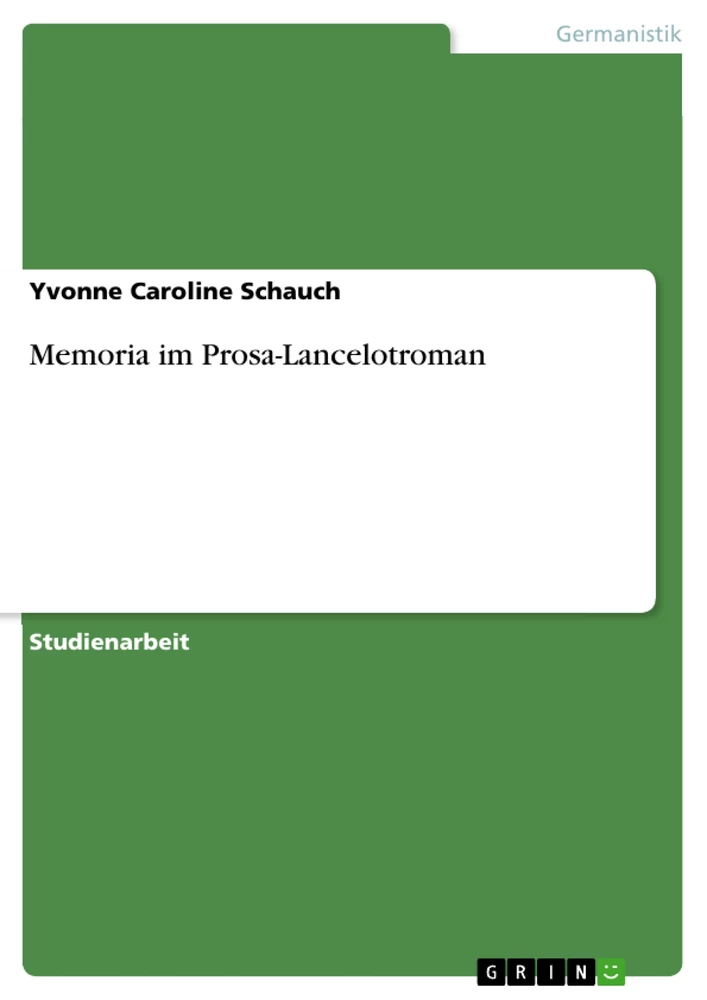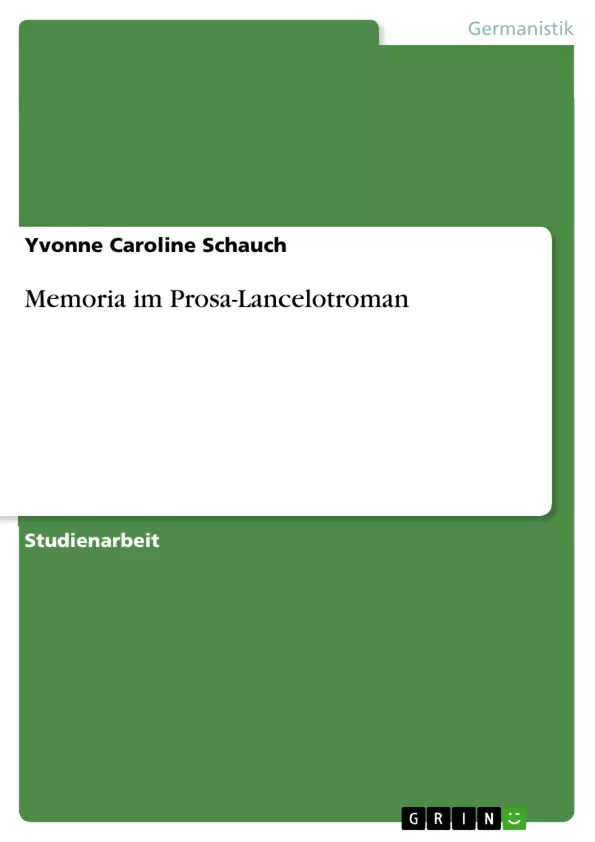Die vorliegende Seminararbeit befaßt sich mit den Anzeichen sowohl persönlicher als auch kollektiver Memoria im Prosa-Lancelotroman (im folgenden „Prosalancelot“ genannt). Hierbei stehen besonders die Textstellen im Vordergrund, die Lancelots Gefangenschaft im Reich der Morgane umfassen (Prosalancelot II, S. 475-485), sowie die Textstelle, in der Artus Lancelots Wandgemälde erblickt (Prosalancelot III, S. 465-470).
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MEMORIA IM PROSALANCELOT
- DER BILDERZYKLUS IM PROSALANCELOT
- Der Bilderzyklus als Gegenstand subjektiver Memoria
- Der Bilderzyklus als Gegenstand kollektiver Memoria
- DIE ROSE ALS MEMORIALZEICHEN
- DIE BEDEUTUNG DES GEDENCKENS IM PROSALANCELOT
- MEMORIA AM ARTUSHOF
- DER BILDERZYKLUS IM PROSALANCELOT
- ABSCHLIEBENDE ZUSAMMENFASSUNG
- QUELLENNACHWEIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Anzeichen von persönlicher und kollektiver Memoria im Prosa-Lancelotroman, insbesondere in den Passagen, die Lancelots Gefangenschaft im Reich der Morgane sowie Artus' Betrachtung von Lancelots Wandgemälden behandeln. Dabei geht es um die Frage, inwieweit diese Textstellen Hinweise auf die Memorialkultur des Mittelalters liefern.
- Analyse des von Lancelot während seiner Gefangenschaft erstellten Bilderzyklus als Gegenstand individuellen Gedenkens und dessen Auswirkungen.
- Untersuchung der Verschiebung von persönlicher zu kollektiver Memoria im Zusammenhang mit dem Bilderzyklus.
- Bedeutung des Bilderzyklus für die Gesellschaft des Artushofs und seine Funktion im Gesamtwerk.
- Die Rose als Memorialzeichen und deren Wirkung auf den Protagonisten.
- Die besondere Bedeutung des mittelhochdeutschen Wortes "gedencken" im Prosalancelot.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Fokus auf die Analyse von Memoria im Prosalancelot, insbesondere im Kontext von Lancelots Gefangenschaft und dem Bilderzyklus.
- Memoria im Prosalancelot: Dieser Abschnitt betrachtet den Bilderzyklus, der von Lancelot während seiner Gefangenschaft geschaffen wird. Er analysiert ihn als Beispiel für individuelle und kollektive Memoria, wobei die Rolle der Troja-Memoria als Ausgangspunkt erwähnt wird.
- Der Bilderzyklus im Prosalancelot: Hier geht es um die genaue Untersuchung des Bilderzyklus als Ausdruck von Lancelots persönlicher Erinnerung. Es wird insbesondere auf die Frage eingegangen, wie er die Geschichte seiner Liebe zu Ginover festhält und welche Auswirkungen diese Selbstdarstellung auf ihn hat.
- Die Rose als Memorialzeichen: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Rose als Symbol für Lancelot, ähnlich wie seine Gemälde, und analysiert die Wirkung, die dieses Zeichen auf ihn ausübt.
- Die Bedeutung des Gedenckens im Prosalancelot: Der Abschnitt untersucht die besondere Bedeutung des Wortes "gedencken" im Prosalancelot und wie es sich von den bereits bekannten Bedeutungen dieses Wortes unterscheidet.
- Memoria am Artushof: Dieser Abschnitt analysiert die Relevanz von Memoria im Kontext der Artushofgesellschaft, wobei die Textstellen mit Bezug auf Lancelots Wandgemälde im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Themen Memoria, Prosalancelot, Bilderzyklus, subjektive Memoria, kollektive Memoria, Troja-Memoria, Memorialzeichen, Rose, Artushof, Mittelalter, Memorialkultur.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Memoria“ im Kontext des Prosa-Lancelotromans?
Memoria bezeichnet das persönliche und kollektive Gedenken sowie die Erinnerungskultur innerhalb des literarischen Werks.
Welche Rolle spielt der Bilderzyklus in Lancelots Gefangenschaft?
Lancelot malt Wandgemälde, die seine Liebe zu Ginover dokumentieren, was als Akt subjektiver Memoria zur Bewältigung seiner Situation dient.
Wie wird aus persönlicher Memoria eine kollektive?
Wenn König Artus die Bilder erblickt, werden Lancelots private Erinnerungen öffentlich und beeinflussen das kollektive Wissen am Artushof.
Was symbolisiert die Rose im Roman?
Die Rose fungiert als Memorialzeichen, das beim Protagonisten tiefe Erinnerungen und emotionale Reaktionen auslöst.
Welche Bedeutung hat das Wort „gedencken“ im Mittelhochdeutschen?
Die Arbeit untersucht die spezifische Verwendung dieses Begriffs im Prosalancelot, die über das reine Erinnern hinausgeht und eine tätige Vergegenwärtigung impliziert.
- Arbeit zitieren
- Yvonne Caroline Schauch (Autor:in), 1998, Memoria im Prosa-Lancelotroman, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154088