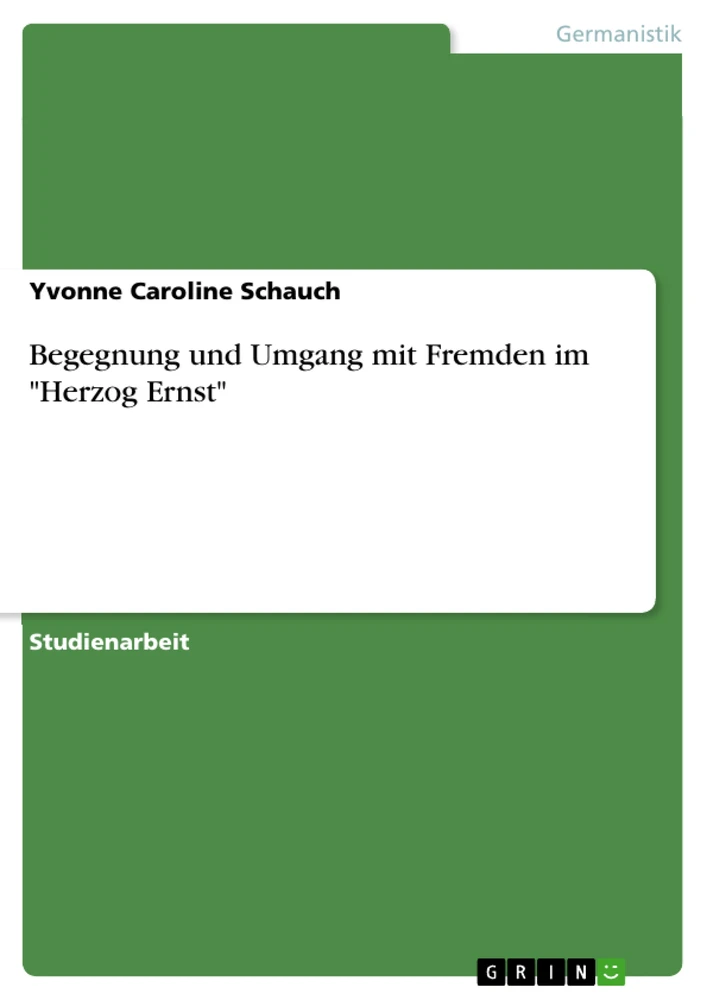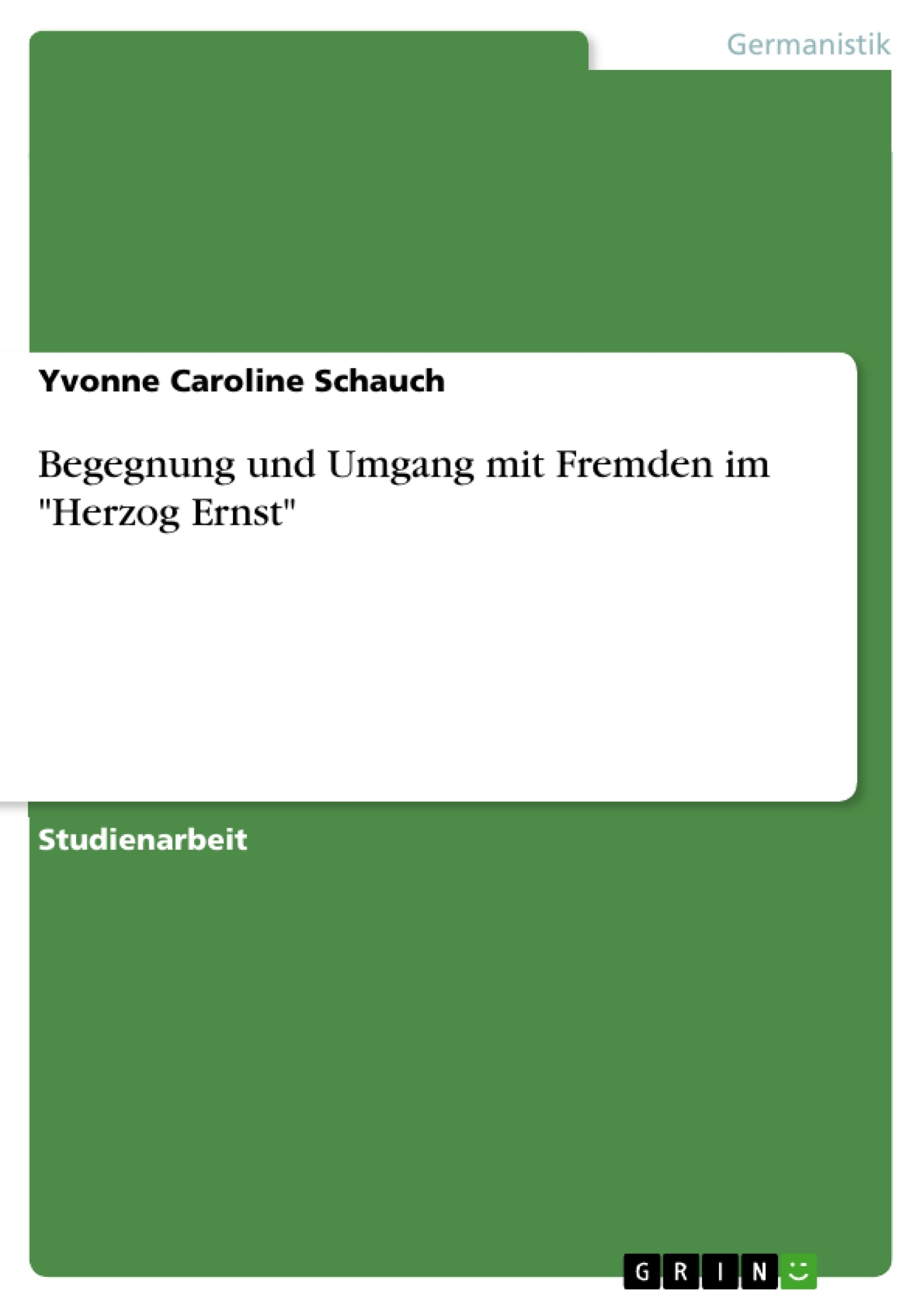Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit der Begegnung und dem Umgang mit Fremden im „Herzog Ernst“, insbesondere mit Ernsts Begegnungen mit den sog. Wundervölkern - das sind zum einen die Kranichmenschen in Grippia, zum anderen die einäugigen Arimaspen. Während Ernsts Aufenthalt im Land Arimaspî kämpft er gegen weitere Wundervölker, gegen „Plathüeve“, die „Ôren“, die Riesen, und er unterstützt die Pygmäen in einem Kampf gegen die Riesen. Nicht berücksichtigt werden die Abenteuer Ernst nachdem er Arimaspî verlassen hat.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE WUNDERVÖLKER IM MITTELALTER
- URSPRUNG UND DARSTELLUNG DER WUNDERVÖLKER
- DIE WUNDERVÖLKER UND DIE KIRCHE
- DIE FREMDEN IM HERZOG ERNST
- GRIPPIA
- DIE GRIPPIANER
- ARIMASPÎ
- DIE PLATHÜEVE
- DIE ÔREN
- DIE PYGMÄEN IN PRECHAMÎ
- DIE RIESEN IN CÂNÂAN
- DIE FUNKTION UND BEURTEILUNG DER FREMDE
- GRIPPIA
- RÉSUMÉE
- QUELLENNACHWEIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Begegnung und den Umgang mit Fremden im „Herzog Ernst“, insbesondere Ernsts Begegnungen mit den sog. Wundervölkern.
- Die Darstellung von Wundervölkern im Mittelalter
- Die Rolle der Kirche im Umgang mit Fremden
- Die Funktion der Begegnungen mit Fremden in der Erzählung
- Die Darstellung von verschiedenen Völkern im „Herzog Ernst“
- Die Bedeutung von Fremdheit im Kontext der mittelalterlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Begegnung und den Umgang mit Fremden im „Herzog Ernst“ und erläutert die zentrale Rolle der Wundervölker in der Erzählung.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Ursprung und der Darstellung von Wundervölkern im Mittelalter. Es werden die unterschiedlichen körperlichen Merkmale, Bräuche und Lebensweisen dieser Völker sowie ihre Darstellung in mittelalterlichen Texten und Weltkarten analysiert.
Das dritte Kapitel untersucht die Begegnungen des Herzogs Ernst mit den Wundervölkern in Grippia und Arimaspî. Es werden die spezifischen Charakteristika der einzelnen Völker und die Art ihrer Darstellung im „Herzog Ernst“ herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Wundervölker, Fremdheit, Mittelalter, „Herzog Ernst“, Begegnung, Umgang, Kirche, Darstellung, Literatur, Geographie, Kultur, Körperlichkeit, Bräuche, Weltbild.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Erzählung "Herzog Ernst"?
Die Erzählung handelt von den Abenteuern des Herzogs Ernst, der nach einem Konflikt mit dem Kaiser ins Morgenland zieht und dort auf verschiedene sagenhafte Völker trifft.
Wer sind die "Wundervölker" im Herzog Ernst?
Zu den Wundervölkern gehören unter anderem die Kranichmenschen in Grippia, die einäugigen Arimaspen, die Plattfüßler (Plathüeve), die Langohren (Ôren), Riesen und Pygmäen.
Welche Rolle spielten Wundervölker im mittelalterlichen Weltbild?
Sie waren fester Bestandteil der mittelalterlichen Geographie und Literatur, oft basierend auf antiken Quellen, und dienten dazu, das Fremde und Unbekannte jenseits der christlichen Welt darzustellen.
Wie begegnet Herzog Ernst den Fremden in Grippia?
In Grippia trifft Ernst auf die Kranichmenschen. Die Begegnung ist geprägt von der Konfrontation mit deren fremdartiger körperlicher Erscheinung und Lebensweise.
Wie positionierte sich die mittelalterliche Kirche zu diesen Wundervölkern?
Die Kirche setzte sich mit der Frage auseinander, ob diese Wesen als Nachfahren Adams göttlichen Ursprungs seien und somit eine Seele besäßen, was ihren Status in der Schöpfung bestimmte.
Welche Funktion haben die Begegnungen mit den Pygmäen?
Herzog Ernst unterstützt die Pygmäen in einem Kampf gegen die Riesen, was seine Rolle als ritterlicher Beschützer und Held in der Fremde unterstreicht.
- Quote paper
- Yvonne Caroline Schauch (Author), 1999, Begegnung und Umgang mit Fremden im "Herzog Ernst", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154091