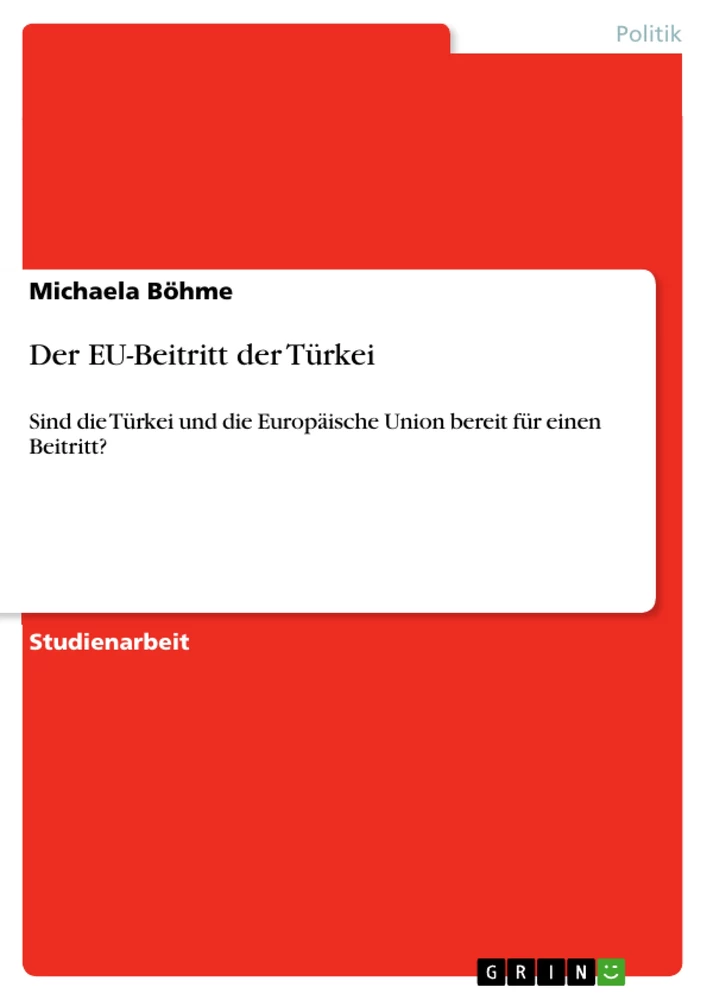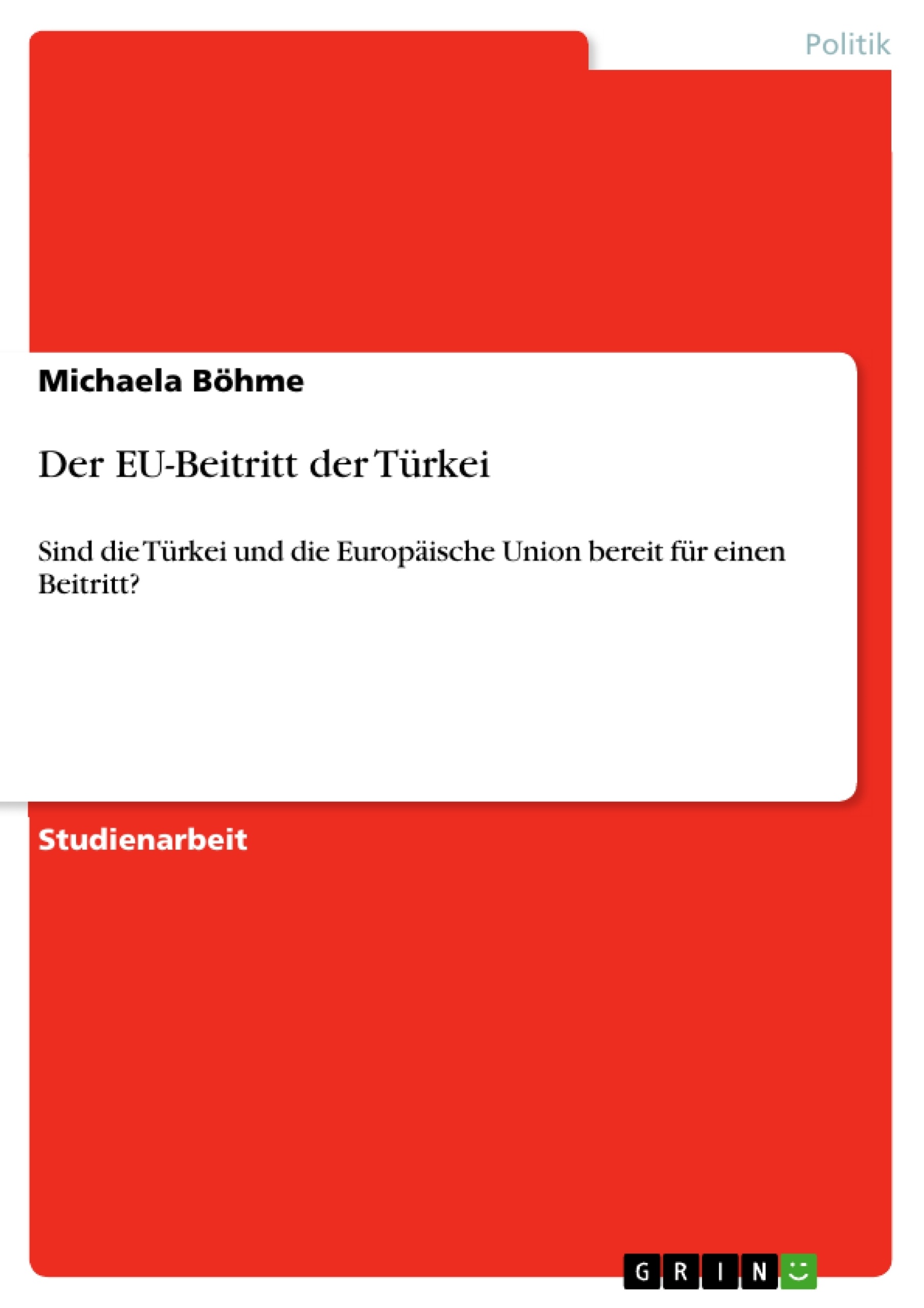Die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei laufen seit nunmehr fast 50 Jahren. Von Anbeginn gilt die Türkei als „der am schwersten zu integrierende Staat“ . Die Gründe dafür sind vielgestaltig. Unzulänglichkeiten im Bereich von Demokratie- und Menschenrechten gelten als Hauptursache für die Beitrittsskepsis. Die zu erwartende schwere Belastung für den EU-Haushalt auf Grund des wirtschaftlichen Defizits der Türkei entfachen weitere Bedenken. „Zum dritten schließlich tritt eine unterstellte kulturelle Andersartigkeit ins Bild“ . Dieser Punkt ist, entgegen aller Beteuerungen, ein verunsichernder Faktor für derzeitige Mitgliedstaaten . Diese Hausarbeit untersucht, ob die Europäische Union und die Türkei bereit sind für einen Beitritt. Basierend auf den angeführten Argumenten wird analysiert, wo zu erwartende Schwierigkeiten liegen und wie diese zu bewerten sind. Einleitend werden die Langwierigkeit der Beitrittsverhandlung und deren Auswirkungen untersucht. Als Ausgangspunkt für den analytischen Hauptteil dienen die Kopenhagener Beitrittskriterien. Diese sind seit den Beschlüssen von Helsinki alleinige Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union .
Das erste Kopenhagener Kriterium ist die institutionelle Stabilität. Anhand der Parteien und des Militärs wird das Demokratiedefizit in der Türkei beleuchtet. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Menschenrechte in der Europäischen Union und der Türkei. Die wirtschaftliche Lage der Türkei und die zu erwartenden finanzielle Auswirkungen im Falle eines Beitritts stellen den nächsten Punkt dar. Wichtig im Rahmen der Beitrittsfrage ist die Haltung der Türkei zum gemeinschaftlichen Besitzstand der Europäischen Unionsstaaten. Dem dritten Argument soll die hier ausgeführte Identitätsdebatte Rechnung tragen. Abschließend werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Es steht fest, dass ein Beitritt sich positiv für die Situation der Menschenrechte und den Wohlstand der Bevölkerung auswirken würde. Auch Unternehmen der EU-Staaten würden sehr von einem Beitritt profitieren. Dennoch nimmt diese Arbeit eine kritische Perspektive ein und versucht die Vorteile gegen drohenden Überlastungskollaps abzuwägen. Die verwendete Literatur setzt sich auf Grund der Aktualität sehr stark aus einzelnen Beiträgen zusammen. Ich habe den aktuellsten Stand der Debatte eingefangen um ein weites Spektrum von Positionen einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europa und die Türkei – die Langwierigkeit der Beitrittsverhandlungen
- Umsetzung der Kopenhagener Beitrittskriterien in der Türkei
- Das Politische Kriterium - Institutionelle Stabilität
- Die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung in der Türkei
- Wahrung der Menschenrechte in der EU und der Türkei
- Das Wirtschaftliche Kriterium
- Die wirtschaftliche Situation in der Türkei
- Wirtschaftliche Folgen für die Europäische Union
- Aqcuis Communautaire
- Die Umsetzung der Acquis Communautaire in der Türkei
- Das Politische Kriterium - Institutionelle Stabilität
- Die Identitätsfrage
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bereitschaft der Europäischen Union und der Türkei für einen Beitritt der Türkei zur EU. Die Analyse konzentriert sich auf die Schwierigkeiten und deren Bewertung, basierend auf den Kopenhagener Beitrittskriterien und den langwierigen Verhandlungen.
- Die Langwierigkeit der Beitrittsverhandlungen und deren Auswirkungen
- Die Umsetzung der Kopenhagener Beitrittskriterien in der Türkei (politische und wirtschaftliche Kriterien sowie das Acquis Communautaire)
- Das Demokratiedefizit und die Menschenrechtslage in der Türkei
- Die wirtschaftliche Situation der Türkei und die Folgen eines Beitritts für die EU
- Die Identitätsfrage und die damit verbundenen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des türkischen EU-Beitritts ein und skizziert die Hauptargumente der Beitrittskritiker und -befürworter. Sie hebt die langwierigen Verhandlungen und die vielschichtigen Gründe für die Beitrittskepsis hervor, darunter Demokratiedefizite, Menschenrechtsverletzungen und die wirtschaftlichen Folgen. Die Arbeit kündigt die Analyse der Kopenhagener Beitrittskriterien und der Identitätsfrage an und gibt einen Ausblick auf die kritische Bewertung der Vor- und Nachteile eines Beitritts.
Europa und die Türkei - langwierige Beitrittsverhandlungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Beitrittsverhandlungen zwischen der Türkei und der EU, beginnend mit dem Assoziierungsabkommen von 1963. Es analysiert die unterschiedlichen Perspektiven von Befürwortern und Kritikern, wobei die vagen juristischen Grundlagen des Beitrittsanspruchs hervorgehoben werden. Das Kapitel thematisiert die sicherheitspolitischen Hintergründe der Verleihung des Kandidatenstatus 1999 und die Inkonsistenz der EU-Politik bezüglich des türkischen Beitritts. Die unterschiedliche Zustimmung innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten und die sich verändernde Stimmung in der Türkei werden ebenfalls diskutiert, wobei der Einfluss der Langwierigkeit der Verhandlungen auf die öffentliche Meinung in der Türkei herausgestellt wird. Die Unsicherheit über die Zukunft der EU und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
EU-Beitritt, Türkei, Kopenhagener Kriterien, Demokratiedefizit, Menschenrechte, wirtschaftliche Folgen, Identitätsfrage, Beitrittsverhandlungen, Institutionelle Stabilität, Acquis Communautaire.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Europa und die Türkei – Die Langwierigkeit der Beitrittsverhandlungen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bereitschaft der Europäischen Union und der Türkei für einen EU-Beitritt der Türkei. Sie analysiert die Schwierigkeiten und deren Bewertung anhand der Kopenhagener Beitrittskriterien und der langwierigen Verhandlungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Langwierigkeit der Beitrittsverhandlungen und deren Auswirkungen, die Umsetzung der Kopenhagener Beitrittskriterien (politische und wirtschaftliche Kriterien sowie das Acquis Communautaire), das Demokratiedefizit und die Menschenrechtslage in der Türkei, die wirtschaftliche Situation der Türkei und die Folgen eines Beitritts für die EU sowie die Identitätsfrage und die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den langwierigen Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der Türkei, ein Kapitel zur Umsetzung der Kopenhagener Beitrittskriterien in der Türkei (inklusive Unterkapiteln zu den politischen Kriterien, den wirtschaftlichen Kriterien und dem Acquis Communautaire), ein Kapitel zur Identitätsfrage und einen Schluss.
Was sind die Kopenhagener Kriterien?
Die Arbeit befasst sich eingehend mit der Umsetzung der Kopenhagener Beitrittskriterien in der Türkei. Diese Kriterien umfassen politische Kriterien (demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte), wirtschaftliche Kriterien (wirtschaftliche Situation der Türkei und Folgen für die EU) und die Übernahme des Acquis Communautaire (das gesamte EU-Recht).
Welche Rolle spielt die Identitätsfrage?
Die Arbeit widmet ein eigenes Kapitel der Identitätsfrage und den damit verbundenen Herausforderungen im Kontext des türkischen EU-Beitritts. Dies beinhaltet die komplexen Fragen der kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen der Türkei und der EU.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit bietet eine kritische Bewertung der Vor- und Nachteile eines türkischen EU-Beitritts, basierend auf der Analyse der Kopenhagener Kriterien und der langwierigen Verhandlungen. Die genauen Schlussfolgerungen werden im Schlusskapitel zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: EU-Beitritt, Türkei, Kopenhagener Kriterien, Demokratiedefizit, Menschenrechte, wirtschaftliche Folgen, Identitätsfrage, Beitrittsverhandlungen, Institutionelle Stabilität, Acquis Communautaire.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und abschließend eine Liste der Schlüsselwörter.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Leser, die sich mit den Themen EU-Beitritt der Türkei, Kopenhagener Kriterien und den Herausforderungen des Integrationsprozesses auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Michaela Böhme (Author), 2010, Der EU-Beitritt der Türkei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154140