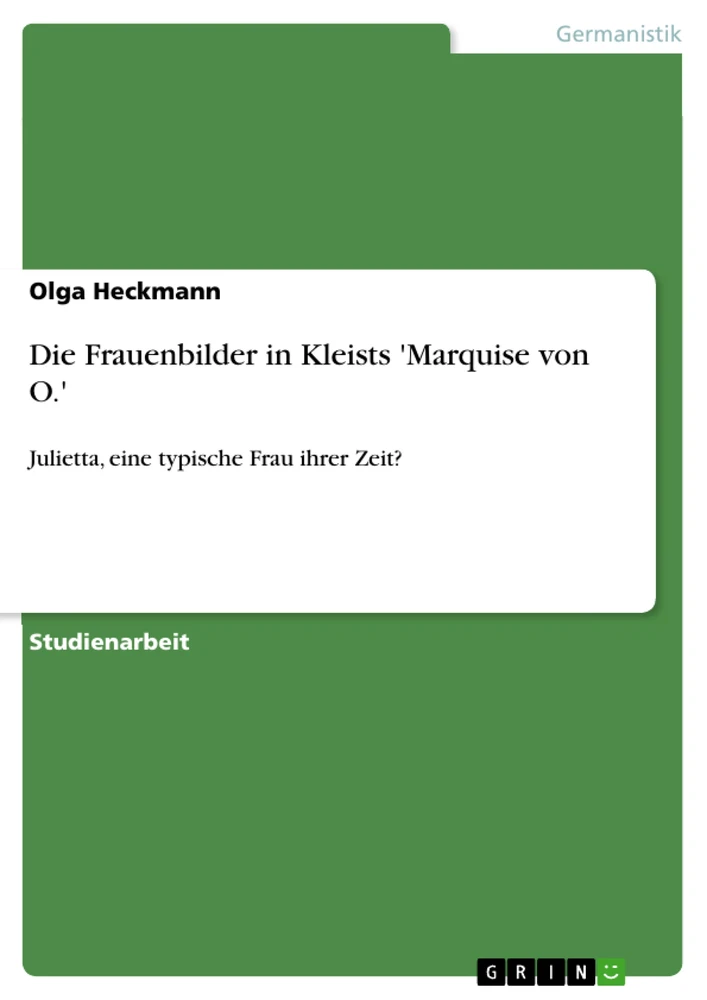Das erste Mal veröffentlicht wurde die Novelle Marquise von O…. im zweiten Heft des Phöbus im Februar 1808, einem Journal von Heinrich von Kleist und Adam Heinrich Müller. Wie in einigen seinen Werken „lässt Kleist auch hier die eigentliche Novellenhandlung im kritischen Moment des ganzen Geschehens beginnen.“ Nämlich genau in dem Moment, als die Marquise ihr Gesuch nach dem Kindsvater in einem Intelligenzblatt veröffentlicht und hiermit einen gesellschaftlichen Skandal auslöst. Sie gibt darin öffentlich zu, unwissentlich schwanger geworden zu sein und den Kindsvater nicht zu kennen. Um die Tragweite des gesellschaftlichen Skandals verstehen zu können, bedarf es einer Untersuchung der zeitgenössischen Frauenrolle um 1800. Diese stelle ich am Anfang dieser Arbeit vor. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung der Figur der Marquise von O…. , vor allem dem von ihr repräsentierten Weiblichkeitsbild. Es wird untersucht, ob sie als eine der wenigen zu dieser Zeit sich modern und zukunftsweisend verhält oder ob sie doch gefangen ist in den sozialen Zwängen ihrer Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Rolle der Frau um 1800
- Die Ehe um 1800
- Heinrich von Kleists Frauenbild
- Julietta, eine typische Frau ihrer Zeit?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Figur der Marquise von O. in Heinrich von Kleists gleichnamiger Novelle. Ziel ist es, das von der Marquise repräsentierte Weiblichkeitsbild zu untersuchen und zu beleuchten, ob sie als eine moderne und zukunftsweisende Frau ihrer Zeit zu betrachten ist oder ob sie den sozialen Zwängen der damaligen Zeit unterworfen ist.
- Die Rolle der Frau um 1800
- Das Frauenbild Heinrich von Kleists
- Die Figur der Marquise von O. und ihr Verhältnis zu den sozialen Normen ihrer Zeit
- Die Bedeutung der Ehe und des gesellschaftlichen Ansehens im 19. Jahrhundert
- Die Darstellung von Macht und Ohnmacht in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einleitung, die die Novelle "Marquise von O." im Kontext ihrer Veröffentlichung im Jahr 1808 sowie die besondere Dramaturgie Kleists, die den Leser in medias res in den Konflikt der Marquise stürzt, erläutert.
Die Rolle der Frau um 1800
Dieses Kapitel beleuchtet die soziale und rechtliche Situation der Frau um 1800. Es werden die unterschiedlichen Rollenbilder und -erwartungen in den verschiedenen Ständen sowie die strikte Trennung der Geschlechter in der Öffentlichkeit und im Privatleben erläutert.
Die Ehe um 1800
Dieser Abschnitt widmet sich der Institution der Ehe um 1800. Es werden die gesellschaftlichen Normen, die den Frauen auferlegt wurden, sowie die Rolle der Eltern bei der Eheschließung und die Auswirkungen einer vorehelichen Schwangerschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Frauenrolle, Gesellschaftskritik, Weiblichkeitsbild, Ehe, gesellschaftliches Ansehen, Moral und Recht im 19. Jahrhundert, Heinrich von Kleist, Marquise von O..
- Quote paper
- Olga Heckmann (Author), 2007, Die Frauenbilder in Kleists 'Marquise von O.', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154179