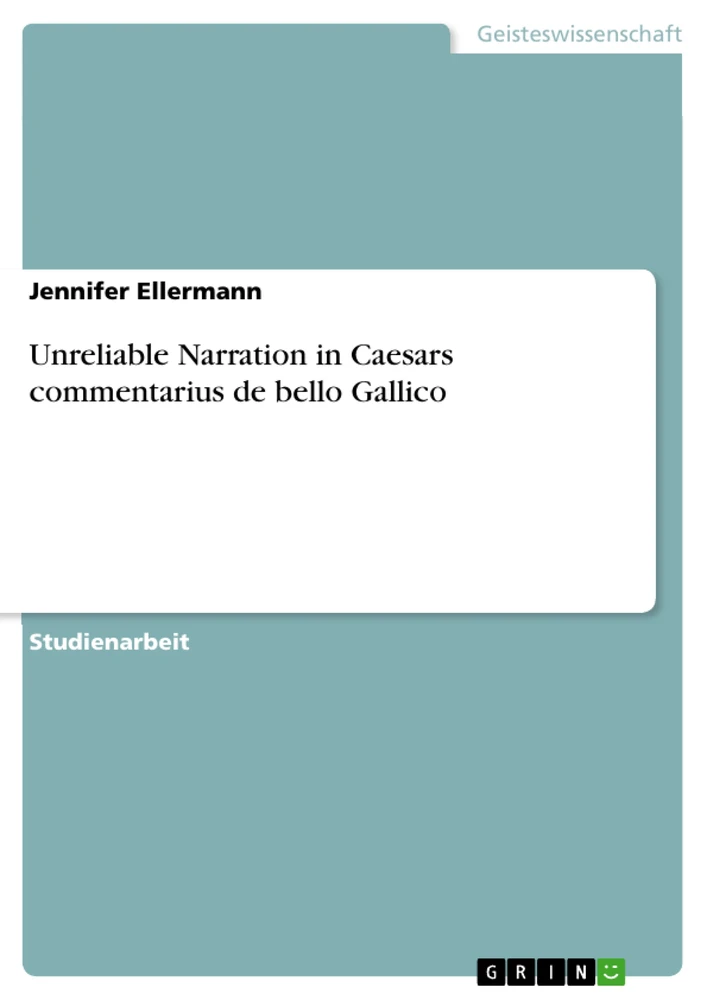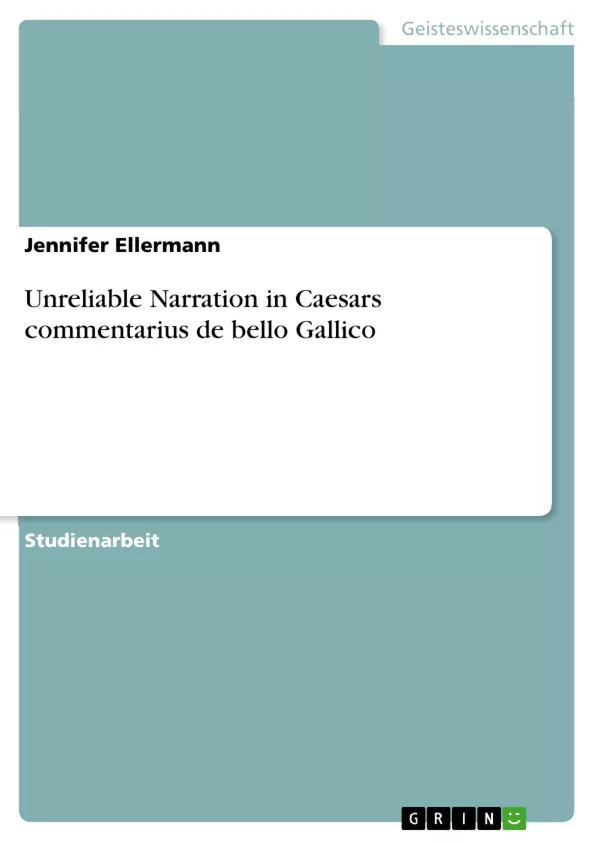„I have called a narrator reliable when he speaks for or acts in accordance with the norms of the work (which is to say, the implied author’s norms), unreliable when he does not.“ Mit dieser Definition konstituierte Wayne C. Booth 1961 den Beginn eines narratologischen Diskurses über ein Phänomen, dessen Betrachtung heute einen festen Bestandteil der Erzähltheorie einnimmt. Allerdings sei dieser Erzähltypus nach Martinez/Scheffel bereits „in der antiken Romanliteratur zu finden […] – man denke da an Lukians Wahre Geschichten […] oder an „Apulei-us’ Goldenen Esel“ . Ferner habe sich nach Solbach schon die antike Rhetorik insbesondere in Gestalt von Aristoteles und Cicero mit der Frage der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit des „Redner-Erzählers“ befasst und Theorien entwickelt, die den Heutigen im Kern sehr ähneln würden . Unter dieser Prämisse er-scheint es interessant zu überprüfen, ob die bis heute entwickelten Untersuchungs-methoden zur Analyse von Unreliable Narration auch auf Werke der Antike, in diesem Fall auf Caesars commentarius de bello gallico erkenntnisfördernd ange-wendet werden können. Allerdings muss eingeräumt werden, dass sich seit Booth zwar eine Vielzahl von Narratologen mit dem Konzept der unreliable narration sowohl zum Zwecke der Theorieoptimierung als auch in Hinblick auf seine Anwendbarkeit innerhalb interpretatorischer Untersuchungen befasst hat, diese Studien jedoch in ihrer Gesamtheit mehr Fragen aufgeworfen und Probleme aufge-zeigt als beantwortet und gelöst haben. So formuliert Ansgar Nünning, dass das Spektrum der erzähltheoretischen Defizite […] von der weitgehend ungeklärten Frage nach einer befriedigenden Definition des Begriffs unreliable narrator über das Fehlen eines operationalisierbaren Rasters von Kategorien für die Analyse der verschiedenen Signale von unreliable narration bis hin zum Mangel an einer typologischen Differenzierung der unter dem Etikett unreliable narrator subsumierten Erscheinungsformen (reiche).
Da sich diese Arbeit jedoch nicht als differenzierende Kumulation von Forschermeinungen zur unreliable narration versteht sondern vielmehr als anwendungsorientierte Untersuchung dieses Aspektes in Caesars Bellum Gallicum, werden im Folgenden nur die für dieses Vorhaben relevanten Fragestellungen erörtert und Probleme sowie divergierende wissenschaftliche Einschätzungen dort aufgezeigt, wo sie sich auf den verwendeten Analysemodus auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG.
- 2 THEORIE: DAS KONZEPT DER UNRELIABLE NARRATION
- 2.1. UNRELIABLE – COMPARED TO WHAT?
- 2.1.1 Die problematische Instanz des implied authors.
- 2.1.2 Frames of reference......
- 2.2 NARRATION VS. FOCALIZATION.
- 2.2.1 Stimme bzw. Wer spricht?
- 2.2.2 Modus bzw.,, Wer sieht?
- 2.3 SYNTHESE DER FRAMES UND NARRATOLOGISCHEN KATEGORIEN .
- 2.4 AUFLISTUNG DER FRAMES UND TEXTUELLEN SIGNALE FÜR UNRELIABLE NARRATION NACH NÜNNING.
- 2.4.1 LISTE DER FRAMES
- 3 ANWENDUNG: UNRELIABLE NARRATION IN CAESARS BELLUM GALLICUM
- 3.1 DIE ERZÄHLINSTANZ IM BELLUM GALLICUM
- 3.1.1 Wer spricht im Bellum Gallicum?
- 3.1.2 Wer sieht im Bellum Gallicum?
- 3.2 DISCORDANCE IN CAESARS BELLUM GALLICUM
- 4 FAZIT: HAT CAESARS COMMENTARIUS DE BELLO GALLICO EINEN UNZUVERLÄSSIGEN\nERZÄHLER?
- Die problematische Instanz des implied authors in der Erzähltheorie
- Das Konzept der frames of reference als Interpretationsstrategie
- Die Rolle der Erzählinstanz im Bellum Gallicum
- Die Identifizierung von Diskrepanzen und Widersprüchen im Text
- Die Analyse von textuellen Signalen für unreliable narration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob und inwieweit das Konzept der unreliable narration, ein viel diskutiertes Phänomen in der Erzähltheorie, auf Caesars Bellum Gallicum angewendet werden kann. Ziel ist es, mithilfe heutiger Analysemethoden festzustellen, ob Caesars Werk einen unzuverlässigen Erzähler beinhaltet und wenn ja, an welchen Textstellen sich dies nachweisen lässt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der unreliable narration ein und erläutert die Relevanz dieses Konzepts für die Interpretation von Caesars Bellum Gallicum. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Theorie der unreliable narration. Es werden die verschiedenen Definitionen des Begriffs, die Herausforderungen bei der Identifizierung eines unzuverlässigen Erzählers und die Bedeutung des Bezugspunktes für die Beurteilung der Zuverlässigkeit einer Erzählinstanz diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Konzept der frames of reference als Interpretationsstrategie gewidmet. Kapitel 3 wendet die Erkenntnisse der Theorie auf Caesars Bellum Gallicum an. Es werden die Besonderheiten der Erzählinstanz im Werk sowie die in Caesars Text erkennbaren Diskrepanzen und Widersprüche analysiert.
Schlüsselwörter
Unreliable narration, Erzähltheorie, Bellum Gallicum, Caesar, implied author, frames of reference, Diskrepanzen, Widersprüche, Interpretationsstrategie, Analysemethoden
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Unreliable Narration“?
Dieser Begriff aus der Erzähltheorie beschreibt einen Erzähler, dessen Glaubwürdigkeit aufgrund von Widersprüchen oder Abweichungen von den Normen des Werkes infrage gestellt wird.
Kann man moderne Erzähltheorie auf Caesars „Bellum Gallico“ anwenden?
Ja, die Arbeit untersucht, ob heutige Analysemethoden wie die von Wayne C. Booth oder Ansgar Nünning erkenntnisfördernd auf antike Texte angewendet werden können.
Warum wird Caesars Erzählinstanz als potenziell unzuverlässig betrachtet?
Durch die Verwendung der dritten Person und die gezielte Fokussierung kann Caesar eine objektive Berichterstattung vortäuschen, die jedoch oft subjektive oder politische Ziele verfolgt.
Was sind „Frames of Reference“ in der Textanalyse?
Es handelt sich um Bezugsrahmen oder Interpretationsstrategien, die der Leser nutzt, um die Zuverlässigkeit einer Erzählinstanz anhand von Weltwissen oder literarischen Normen zu beurteilen.
Welche textuellen Signale deuten auf Unzuverlässigkeit hin?
Dazu zählen Diskrepanzen zwischen dem Gesagten und den tatsächlichen Ereignissen, Widersprüche im Text sowie auffällige Lücken in der Berichterstattung.
Ist Caesar im „Bellum Gallico“ ein unzuverlässiger Erzähler?
Die Arbeit analysiert spezifische Passagen auf „Discordance“ (Unstimmigkeit) und kommt zu einem differenzierten Fazit über die Glaubwürdigkeit der Erzählinstanz.
- Quote paper
- Jennifer Ellermann (Author), 2010, Unreliable Narration in Caesars commentarius de bello Gallico, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154185