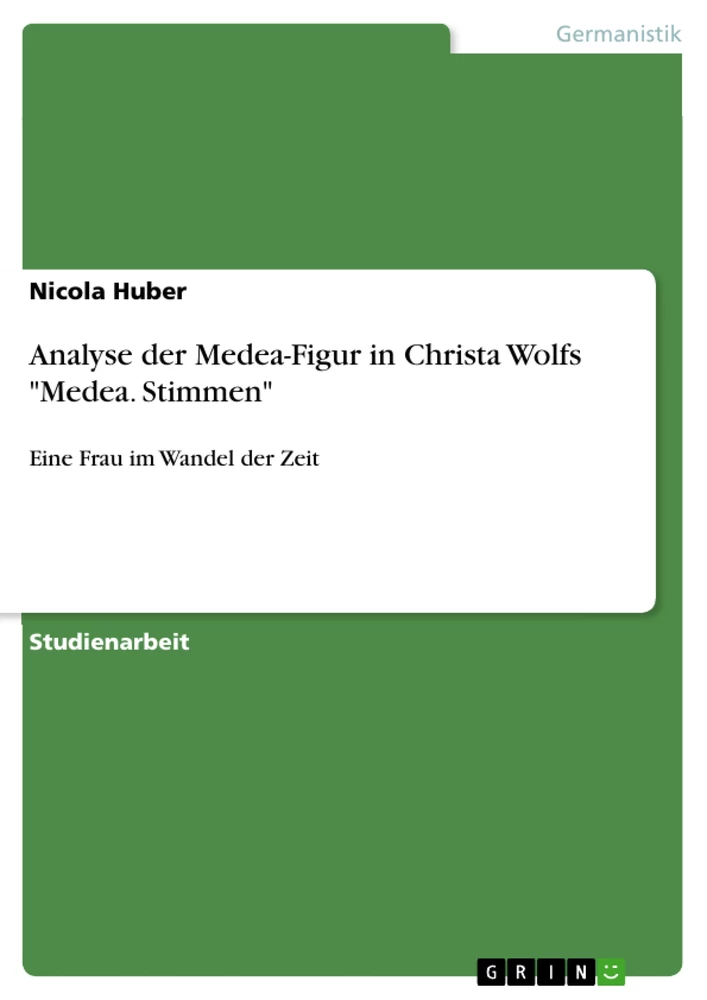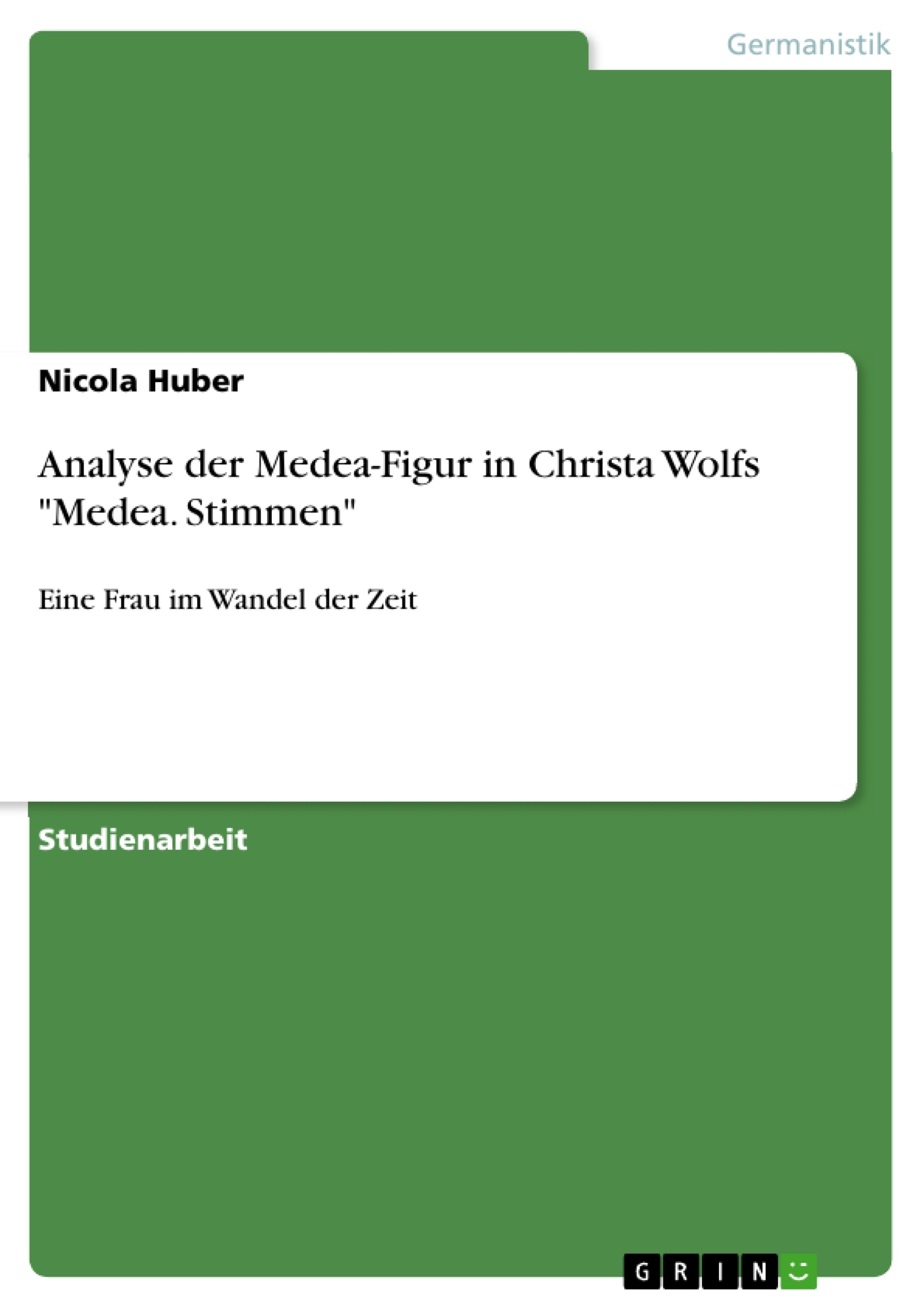Im Jahre 1993 kam ans Licht, dass Christa Wolf, aufgewachsen in der DDR, zwischen 1959 und 1962 als IM ‚Margarete’ für die Stasi tätig war. Nicht ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass sie bis zum Jahre 1989 ein Mitglied der SED war. Demnach zu schließen, müsste sie ja hinter dem System der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik gestanden haben, wenn sie sogar dessen Machenschaften unterstützte. Als Wolf noch in der DDR lebte, plädierte sie für den Zusammenhalt der Menschen, ihre Grundidee war geprägt von einem positiven Kollektivgedanken. Obwohl sie ein Bewusstsein für die Probleme im Staat entwickelte, war sie doch der Überzeugung, dieses könnten überwunden werden, wenn die Menschen etwas für den Sozialismus tun würden. Sie glaubte an eine Existenz der DDR, wenn die Bewohner dieses Staates dazu beitrügen, den Sozialismus zu fördern und zu unterstützen. Wolfs Werke sind also eher der systemtragenden Literatur zuzuordnen als der systemkritischen. Manche mögen auch von offizieller Propagandaliteratur sprechen, was in ihren frühen Werken durchaus berechtigt war, bei „Medea, Stimmen“ jedoch nicht mehr ausschließlich zutrifft, denn hier werden weder die Kolcher, mag man sie als Repräsentanten der ehemaligen DDR-Bürger sehen, noch die Korinther als Repräsentanten der BRD-Bürger, vollkommen dargestellt. „Medea. Stimmen“, erschienen 1996, zählt noch zur sog. Wendeliteratur: Die kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen des Mauerfalls und der Wiedervereinigung Deutschlands stehen im Mittelpunkt und dabei geht es mehr um die Menschen und ihre Situation, als um politische Entscheidungen. Nachdem auf den antiken Mythos der Medea (2. 1 Die antike Medea – ein kurzer Abriss) und den „neuen“ Mythos der Medea der Christa Wolf eingegangen wurde, wird „Medea. Stimmen“ näher beleuchtet: Der Inhalt (2. 2. 1 Inhaltsangabe) legt Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede offen, die sprachlichen Besonderheiten unter Punkt 2. 2. 2 bieten einen Einblick in die Schreibweise der Christa Wolf und anhand der formalen Kriterien (2. 2. 3 äußere Form) lässt sich der Aufbau des Romans aufzeigen. Das deutsch-deutsche Verhältnis wird unter Punkt 3 genauer betrachtet: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Christa Wolf als Für- oder Widersprecherin des DDR-Staates?
- Übersicht über die vorliegende Arbeit
- Literaturbericht
- Medea als Figur über die Jahrhunderte hinweg
- Die antike Medea bei Euripides – ein kurzer Abriss
- Christa Wolfs Medea
- Knappe Inhaltsangabe unter Berücksichtigung der Stimmen
- Sprachliche Besonderheiten
- Äußere Form
- Das deutsch-deutsche Verhältnis in „Medea. Stimmen“
- Eine verschlüsselte politische Botschaft?
- Medea als zentrale Figur zu einer Zeit politischer Umbrüche
- Ost-West-Konflikt? - Kolchis versus Korinth?
- Kolchis als matriarchale Gesellschaft
- Korinth als patriarchale Gesellschaft
- Gestalt auf einer Zeitengrenze
- Literatur
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“ und untersucht, inwieweit sich die Autorin in diesem Werk als Für- oder Widersprecherin des DDR-Staates positioniert. Darüber hinaus wird die Rolle der Figur Medea in der Zeit des deutsch-deutschen Verhältnisses und im Kontext politischer Umbrüche betrachtet.
- Die Positionierung Christa Wolfs gegenüber dem DDR-Staat
- Die Darstellung von Medea in „Medea. Stimmen“ im Vergleich zum antiken Mythos
- Das deutsch-deutsche Verhältnis im Kontext von „Medea. Stimmen“
- Die Rolle von Medea als zentrale Figur in Zeiten politischer Umbrüche
- Der Ost-West-Konflikt als symbolische Darstellung von Kolchis und Korinth
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Positionierung Christa Wolfs im Kontext des DDR-Staates, indem es ihre Rolle als IM „Margarete“ und ihre Mitgliedschaft in der SED beleuchtet. Kapitel zwei fokussiert auf den antiken Mythos von Medea und präsentiert die Interpretation von Euripides sowie die Relevanz dieses Stoffes für die moderne Literatur. Im dritten Kapitel wird der Roman „Medea. Stimmen“ im Hinblick auf seine Inhaltsangabe, sprachliche Besonderheiten und äußere Form untersucht. Kapitel vier geht tiefer auf das deutsch-deutsche Verhältnis im Roman ein und analysiert die Frage einer möglichen verschlüsselten politischen Botschaft. Abschließend wird die Rolle Medeas im Kontext der politischen Umbrüche und des Ost-West-Konflikts beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des deutsch-deutschen Verhältnisses, der Positionierung eines Autors im Kontext des DDR-Staates, der Rezeption von Mythologie in der Literatur und der Analyse von literarischen Figuren in Zeiten politischer Umbrüche. Schlüsselbegriffe sind: Christa Wolf, „Medea. Stimmen“, DDR-Staat, deutsch-deutsches Verhältnis, politischer Umbruch, Mythos, Medea, Kolchis, Korinth, Ost-West-Konflikt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“?
Der Roman deutet den antiken Medea-Mythos neu und verarbeitet dabei Themen wie Ausgrenzung, Machtstrukturen und das Verhältnis zwischen Ost und West nach der Wende.
Welche Rolle spielte Christa Wolf in der DDR?
Christa Wolf war Mitglied der SED und zeitweise als Inoffizielle Mitarbeiterin (IM) für die Stasi tätig, entwickelte jedoch später auch eine kritische Distanz zum System.
Wie wird der Ost-West-Konflikt im Roman symbolisiert?
Der Konflikt wird durch die Gegenüberstellung der matriarchalen Gesellschaft von Kolchis (Osten) und der patriarchalen Gesellschaft von Korinth (Westen) dargestellt.
Was unterscheidet Wolfs Medea von der antiken Figur?
In der antiken Version (Euripides) ist Medea eine Kindsmörderin. Bei Christa Wolf wird sie als Sündenbock einer korrupten Gesellschaft dargestellt, die ihre Kinder nicht tötet.
Ist „Medea. Stimmen“ als Wendeliteratur einzustufen?
Ja, das Werk erschien 1996 und thematisiert die kulturellen und sozialen Folgen des Mauerfalls sowie die Schwierigkeiten der Wiedervereinigung.
- Quote paper
- Nicola Huber (Author), 2010, Analyse der Medea-Figur in Christa Wolfs "Medea. Stimmen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154202