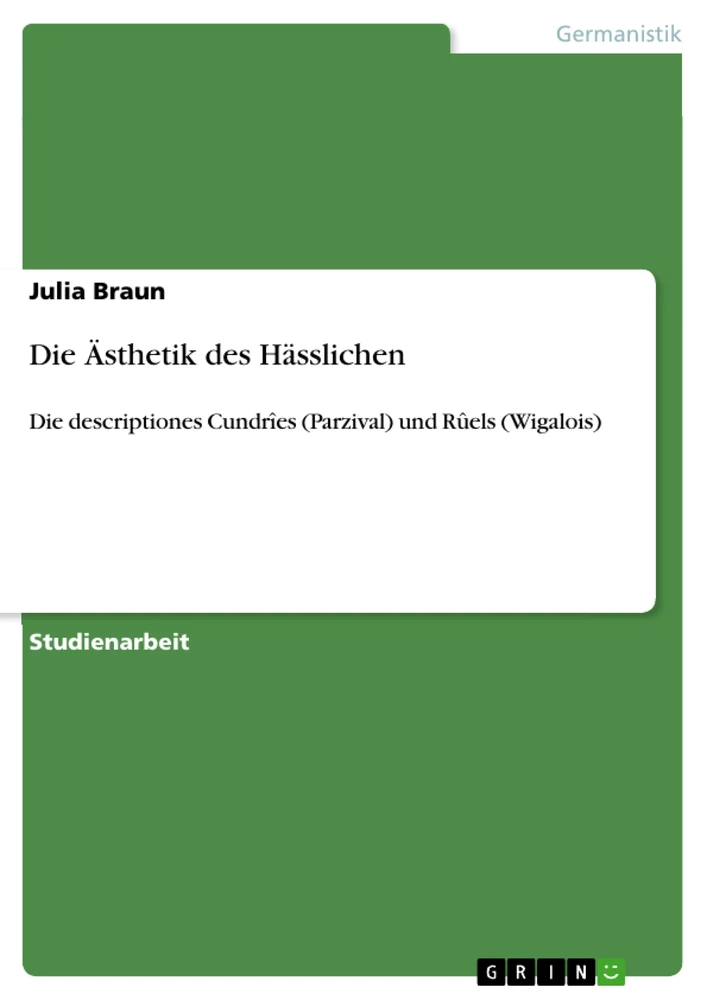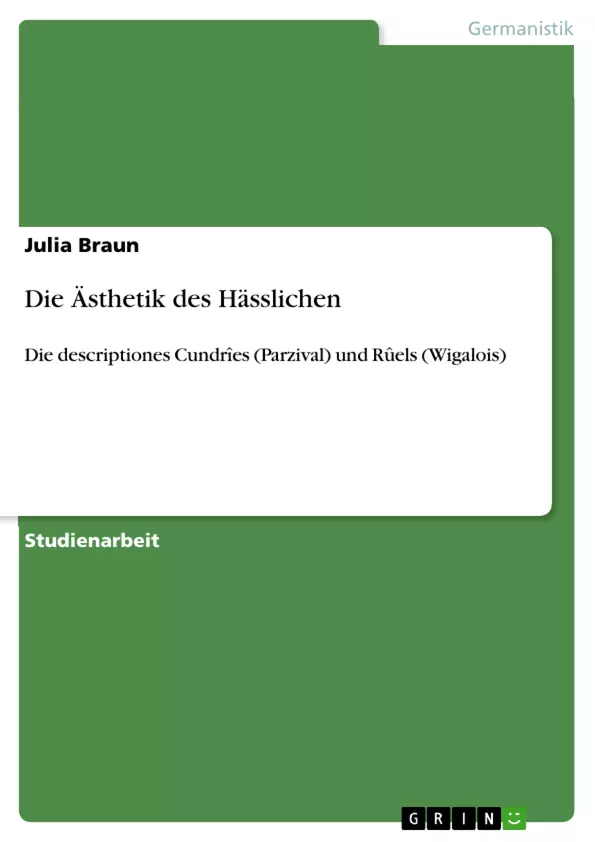Bei dem Titel „Die Ästhetik des Hässlichen“ handelt es sich um keinen Widerspruch. Bis ins 19. Jahrhundert wurde die Ästhetik zwar als Wahrnehmung dessen bezeichnet, was allgemein als schön und harmonisch gilt; in dieser Arbeit wird der Begriff Ästhetik aber streng wörtlich genommen und als rein sinnliche Wahrnehmung verstanden, die sich in diesem Fall eben nicht auf die schönen und angenehmen Dinge richten wird, sondern auf das Hässliche und Abstoßende zielt.
Dabei wird versucht, nicht nur als heutiger Rezipient die aufgeführten Textbeispiele zu bewerten und zu interpretieren, sondern auch darauf einzugehen, wie die verschiedenartigen descriptiones auf den mittelalterlichen Rezipienten gewirkt haben müssen.
Auf den ersten Seiten der Arbeit befasse ich mich mit den lexikalischen und semantischen Besonderheiten, die das Adjektiv „hässlich“ betreffen. Es wird darauf geachtet, die Unterschiede zwischen der mittelalterlichen und der heutigen Vorstellung herauszuarbeiten. Ein kurzer Exkurs über die Ekphrasis-
Theorien der Antike und des Mittelalters sollen zu den ausgesuchten Beispielen überleiten, an denen die mittelalterliche Methode der Ekphrasis aufgezeigt werden kann. Außerdem soll deutlich werden, dass die Beschreibung der Hässlichkeit festgelegten Mustern folgt, die beabsichtigte Wirkung aber, die die Hässlichkeit beim Rezipienten hervorrufen soll, nicht
immer dieselbe ist.
Es geht in dieser Arbeit nicht nur um die Darstellung von körperlich hässlichen Menschen, sondern auch darum, wie der hässliche Charakter eines Menschen dargestellt werden kann. Schlussendlich stellt sich die Frage, warum Beschreibungen von hässlichen Menschen oder grauenhaften Begegnungen in der Literatur überhaupt thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Allgemeines über das Hässliche
- Zur Lexik
- Zur Semantik
- Zur antiken und mittelalterlichen Praxis der Ekphrasis
- Die Inszenierung der Hässlichkeit bei ausgesuchten Figuren
- Die Gralsbotin Cundrî
- Das wilde wip Rûel
- Karriôz
- Marrîên
- Rôaz
- Allgemeines über das Hässliche
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Beschreibungen des Hässlichen in den mittelalterlichen Texten „Parzival“ und „Wigalois“ und untersucht, wie diese auf den mittelalterlichen Rezipienten gewirkt haben. Die Arbeit widmet sich insbesondere der Frage, wie sich die mittelalterliche Vorstellung von Hässlichkeit von der heutigen unterscheidet und wie diese Darstellung im Kontext der mittelalterlichen Ästhetik zu verstehen ist.
- Lexikalische und semantische Besonderheiten des Wortes „hässlich“ im Mittelalter
- Die Rolle der Ekphrasis bei der Darstellung des Hässlichen
- Die Verbindung von körperlicher Hässlichkeit und moralischem Charakter im Mittelalter
- Die Funktion von Beschreibungen des Hässlichen in der mittelalterlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Ästhetik des Hässlichen im Mittelalter ein und definiert den Forschungsgegenstand. Der Hauptteil beschäftigt sich zunächst mit dem Begriff „hässlich“ im Mittelalter, beleuchtet seine lexikalischen und semantischen Besonderheiten und stellt die mittelalterliche Vorstellung von Schönheit im Kontrast zur heutigen Sichtweise dar. Anschließend werden die Ekphrasis-Theorien der Antike und des Mittelalters vorgestellt, die als Grundlage für die Analyse der ausgesuchten Beschreibungen dienen.
Schlüsselwörter
Hässlichkeit, Ästhetik, Mittelalter, Ekphrasis, Beschreibung, Parzival, Wigalois, Cundrî, Rûel, Moral, Körper, Literatur, Semantik, Lexik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Ästhetik des Hässlichen“ in dieser Arbeit?
In dieser Arbeit wird Ästhetik wörtlich als „sinnliche Wahrnehmung“ verstanden. Es geht also nicht um das Schöne, sondern um die gezielte Wahrnehmung und Darstellung des Abstoßenden und Hässlichen in der Literatur.
Welche mittelalterlichen Texte werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Beschreibungen in den Werken „Parzival“ (Wolfram von Eschenbach) und „Wigalois“ (Wirnt von Grafenberg).
Was ist eine „Ekphrasis“?
Ekphrasis bezeichnet die literarische Technik der detaillierten Beschreibung von Personen oder Gegenständen. Die Arbeit untersucht, wie diese Technik im Mittelalter genutzt wurde, um Hässlichkeit zu inszenieren.
Wie hängen körperliche Hässlichkeit und Moral im Mittelalter zusammen?
Im Mittelalter wurde oft eine Verbindung zwischen dem äußeren Erscheinungsbild und dem inneren Charakter gezogen. Ein hässliches Äußeres konnte auf einen schlechten Charakter oder eine moralische Verwerfung hindeuten.
Welche Figuren dienen als Beispiele für Hässlichkeit?
Untersucht werden unter anderem die Gralsbotin Cundrî, das „wilde wip“ Rûel sowie die Figuren Karriôz, Marrîên und Rôaz.
- Quote paper
- Julia Braun (Author), 2010, Die Ästhetik des Hässlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154253